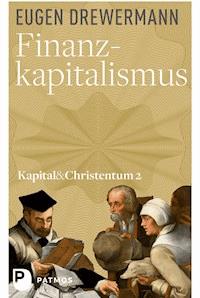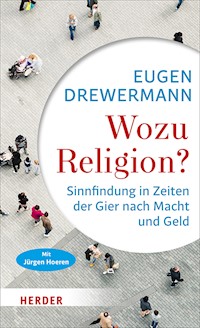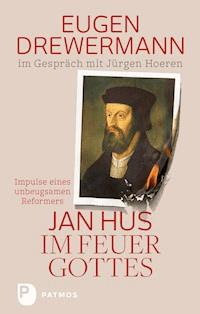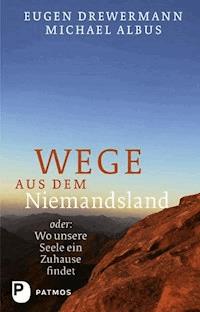
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In der Partnerschaft konkurrieren die Bedürfnisse von »Ich« und »Du« und die Sehnsucht nach Verschmelzung in der Liebe bleibt unerfüllt. Vor lauter Pflichten, die der Beruf auferlegt, kommen alle anderen Neigungen und Interessen zu kurz. Spannungsfelder dieser Art, die Menschen immer wieder und vielleicht immer häufiger erleben, erscheinen oft wie ein Niemandsland, in dem man sich orientierungslos und ohne Aussicht auf eine Lösung bewegt. Eugen Drewermann und Michael Albus beschreiben zahlreiche solcher Gegensätze im Denken, Fühlen und Handeln und zeigen auf, welche Auswege es gibt, damit die Seele wieder ein Zuhause findet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
ÜBER DIE AUTOREN
ÜBER DAS BUCH
IMPRESSUM
VERLAGSHINWEISE
Eugen Drewermann / Michael Albus
Wege aus dem Niemandsland
oder: Wo unsere Seele ein Zuhause findet
Patmos Verlag
INHALT
Vorwort
Das Niemandsland
Gefährliches Land zwischen den Fronten
Ohne Aggression kann man nicht leben
Wie sich die Fronten bilden: Es beginnt in Kindertagen
Der Hoffnungshorizont als religiöser Hintergrund
Zwischen den Fronten
Ich bin nicht der andere: Menschliche Beziehungen
Wie die Fronten aufbrechen?
Pflicht und Neigung
Bewusstsein und Unbewusstes
Staat, Parteien und Individuum
Kirche und Individuum
Medien, Internet und Lebenswirklichkeit
Ökologie und Ökonomie
Freiheit und Gerechtigkeit
Freiheit und Notwendigkeit
Jesus: Ein anderer Zugang zur Wirklichkeit
Vorwort
Eugen Drewermann und ich haben auf ganz unterschiedlichen Ebenen immer wieder die Erfahrung gemacht, und machen sie immer noch, dass viele Menschen, die auf der Suche nach einer sinnvollen Gestalt ihres Lebens unterwegs sind, wieder und wieder zwischen Fronten geraten, die sie ohnmächtig und müde, ja erschöpft werden lassen. Als Einzelne stehen sie allzu oft vor der Situation, dass sie erst einmal den Ansprüchen und Forderungen politischer, gesellschaftlicher und kirchlicher Institutionen genügen müssen, bevor sie »eingelassen« werden, eine Heimat, ein Zuhause finden können. Viele dieser Ansprüche und Forderungen können sie nicht in Übereinstimmung mit ihren eigenen Erfahrungen, mit ihrer eigenen Sehnsucht nach einem für sie tragbaren und vor allem lebbaren Zuhause bringen. Dann erfahren sie sich nicht selten als heimat- und obdachlos. Das zwingt sie schließlich entweder zu resignieren oder zu rebellieren. Sie befinden sich andauernd in einem Niemandsland – und wissen nicht mehr, wie sie herauskommen können.
Diese oft verzweifelt Suchenden, diese Heimatlosen im Niemandsland, in den Niemandsländern ihres Lebens hatten wir im Blick als wir uns zu einem langen und intensiven Gespräch zusammensetzten, um nach Gründen, vor allem aber nach Auswegen zu suchen, die ihnen eine Hilfe sein können oder sein könnten. Wir brachten dabei unsere eigenen Erfahrungen auf sehr unterschiedlichen Wegen und Ebenen zur Sprache. Unsere eigenen und die mit anderen Menschen, die uns begegneten und begegnen. So ist dieses Buch entstanden. Es ist die mehrfach überarbeitete Abschrift eines frei gehaltenen Gesprächs – mit dem Vorteil von Spontaneität und Lebendigkeit, mit Widerspruch und Zustimmung, aber auch mit dem Nachteil einer gewissen Sprunghaftigkeit und »Leichtigkeit«, nicht Leichtfertigkeit, in den Formulierungen. Diesen doppelgesichtigen Charakter wollten wir unbedingt erhalten, weil wir meinen, dass im Gespräch sich mehr Lebendigkeit entfalten kann als in einem Monolog. Das Gespräch zwischen Zweien hält Fragen und Antworten im Fluss, lässt Verfestigungen weniger zu, als das Gespräch oder die Auseinandersetzung mit sich selbst, es zwingt fortlaufend zur Korrektur und zu neuen Anläufen, trägt auch den Charakter des Fragmentarischen, des Bruchstückhaften, bleibt am Ende, bei aller Bemühung zur Schlüssigkeit, offen, ermöglicht weitere Gespräche und eigenes Nach-Denken. Das waren Absicht und Ziel unseres Unternehmens. Ob wir die Absicht verwirklichen und das Ziel erreichen konnten, müssen die Leserinnen und Leser selbst entscheiden. Es ist ein Angebot, mit dem Frau und Mann nicht anders als subjektiv umgehen können und sollen. Uns ging es um einen Gang ins Offene, auf dem wir andere Menschen mitnehmen wollten. Wir hoffen und wünschen, dass uns dies halbwegs gelungen ist. Wir lassen unserem Gespräch nun freien Lauf. »Freier Lauf« heißt auch: innehalten und schauen, wohin man gehen könnte – dann weiterlaufen und weiterlaufen lassen.
Eugen Drewermann ist ein Gesprächspartner, der zur Aufmerksamkeit zwingt und immer wieder aufhorchen lässt. Seine durch Erfahrung gesättigten Einsichten und Fragen rufen – immer wieder und immer noch – Widerspruch hervor. Aber auch Zustimmung – und die Feststellung, dass da einer redet, der selber auf der Suche, der nicht »fertig« ist. Solche Menschen können – keine leichten – Wege weisen aus dem Niemandsland. Ich danke ihm von Herzen, dass er sich auf das Gespräch eingelassen hat.
Danken möchte ich persönlich auch den Freunden Elfriede und Rupert Quaderer sowie Verena Baader, die mir eine Hilfe waren im konzentrierten Arbeitsprozess vom gesprochenen Wort zum geschriebenen Text.
MICHAEL ALBUS
Niemandsland
Der Begriff Niemandsland (lateinisch terra nullius) bezeichnet ein Gebiet, das niemandem gehört, also herrenlos ist, staatsrechtlich herrenlos ist, oder von niemandem besiedelt und gepflegt oder bewirtschaftet wird, oder zwischen den Fronten eines Krieges liegt.
Im übertragenen Sinn wird damit auch ein besonders unwirtliches Gebiet bezeichnet.
Terra nullius war ein bereits im römischen Recht geläufiger Begriff.
Umgangssprachlich wird das Niemandsland auch das Gebiet zwischen den Kontrollstellen bei Grenzübergängen, bzw. auch der von den jeweiligen Staaten kontrollierte Grenzgebietsstreifen bezeichnet, der üblicherweise nicht unkontrolliert betreten werden darf.
Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Das Niemandsland
Gefährliches Land zwischen den Fronten
MICHAEL ALBUS: Niemandsland, das Land, das niemandem gehört. In die Umgangssprache ist das Wort im Ersten Weltkrieg (1914–1918) gekommen. Es gibt viele Geschichten und Berichte darüber, was sich im Niemandsland oder in den Niemandsländern während der großen Kriege abgespielt hat. Es war ein lebensgefährliches Land. Wenn man sich hinein begab, drohte der sichere Tod. Was ist Niemandsland – angewendet auch auf unser Leben?
EUGEN DREWERMANN: Der Hintergrund ist eine Welt voller Gewalt, in der Recht durch die herrschende Macht diktiert wird. Es gibt kein Gebiet der Erde, das von Natur aus jemandem gehört hätte. Irgendwann ist es besetzt worden. Die Regel war, dass derjenige, der zuerst kam, auch das Besitzrecht beanspruchte. Dann aber, gezwungen durch Not, durch Vertreibung, durch Klimakatastrophen, durch Völkerbewegungen, wurde ein bestimmtes Gebiet zum Desiderat eines anderen, der nicht aus Willkür, sondern aus Überlebensnot Anspruch darauf erhob. Also gab es quer durch die ganze menschliche Geschichte aggressive Auseinandersetzungen um Besitzansprüche. Kein Gesetz im Umgang von Lebewesen miteinander ist so alt ist wie das Revierprinzip. Irgendwo muss jemand sich zu Hause fühlen können, irgendwo muss er ein Recht haben, Nachkommen zu zeugen. Irgendwo muss er ein Areal haben, in dem er erwarten darf, seine Ernährungsgrundlage zu finden. Wenn ihm das streitig gemacht wird, wenn er daraus vertrieben wird, verliert er nicht etwas, sondern alles.
MICHAEL ALBUS: Das gilt nicht nur für den Menschen. Aus der Verhaltensforschung wissen wir, dass es bei Tieren auch so ist.
EUGEN DREWERMANN: Jeder, der ein Aquarium hat, wird sehen, dass die kleinsten Guppys sich nach dieser Regel verhalten. Und dass ein kleinerer Fisch sogar einen größeren Artgenossen im kleinen Gebiet zwischen den Wasserpflanzen vertreiben wird, denn das ist seine Heimat. Normalerweise wird das auch akzeptiert. Aber wenn von außen Not herandrängt, wird ein Gebiet strittig. Dann soll die Macht entscheiden, was vom Recht her nicht festgelegt ist. Quer durch die Evolution der Biologie zieht sich dieses »Prinzip« und bestimmt auch weite Teile der Kulturgeschichte. Ein Beispiel: Die Grenzen Polens – heute sind sie rechtens. Wer sie streitig machen wollte, würde sich am Völkerrecht versündigen. Aber sie sind, wie jeder weiß, zustande gekommen durch reine Machtwillkür.
Wenn wir genauer hinschauen und direkt in die militärische Wahrnehmung gehen, ist Niemandsland das Gebiet, das noch keiner dem anderen entreißen konnte, wo eine Pattsituation in der aggressiven Auseinandersetzung eingetreten ist und eine Zone entsteht, die noch nicht definitiv zu besetzen war. Also liegt sie unter Beschuss. Es ist lebensgefährlich, sich da hineinzuwagen. Schlimmer noch: Jeder, der darin verletzt wird, wird unversorgt liegen gelassen. Frontsoldaten schildern immer wieder, wie ihre Kameraden geschrien und geschrien haben, bis sie tot waren. Nicht einmal die Sanitäter haben sich da hineingetraut. So war Niemandsland. Die Parole war entscheidend: Wer gehört zu uns? Wer ist da? Dann musste man die richtige Formel wissen. Sie nicht zu kennen, wurde mit dem Tod bestraft. – Ich wüsste kein besseres Bild für das Niemandsland als die Darstellung von Franz Radziwill: Ein Stahlhelm, durchlöchert, auf einem Pfahl, – ein Mahnsymbol dafür, dass es solche Niemandsländer nicht geben dürfte. Schon weil zwei Gruppen das gleiche Terrain beanspruchen, sollte man imstande sein, zu reden darüber, wie man es gemeinsam teilt, denn nur das wäre Leben.
MICHAEL ALBUS: Also muss man festhalten, dass der Begriff des Niemandslands etwas mit Machtanspruch zu tun hat.
EUGEN DREWERMANN: Und mit der Unfähigkeit, Gewalt zu vermeiden durch einen gepflegten Dialog über die Ansprüche, die jeder als rechtens von seiner Perspektive aus betrachtet. Die Gewalt ist die Ersatzsprache für eine Verständigung, die nicht mehr zustande kommt. Im 16. Jahrhundert hat Erasmus von Rotterdam richtig bemerkt, wie absurd die ganze Kriegsführung ist. Man führt sie um Rechtsansprüche. Kein Krieg, der nicht geführt würde im Namen Gottes, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen der Moral, im Namen der Bestrafung für völkerrechtliche Verbrechen, doch wesentlich wird Krieg geführt, weil man nicht einig wird über die Frage, was nun rechtens sei; und dann soll der tüchtigere Mörder auf dem Schlachtfeld als Sieger festsetzen dürfen, dass ihm immer schon das Recht gehörte. Die Rechtlosigkeit diktiert, wenn sie nur stark genug gewesen ist, sich durchzusetzen, die Gültigkeit des Rechts. Wenn es dabei bleibt, gibt es kein Recht, sondern allein ein Gleichgewicht der Kräfte, ein »Gleichgewicht des Schreckens« – so nannte man den »Frieden« in der Zeit des Kalten Krieges.
Ohne Aggression kann man nicht leben
MICHAEL ALBUS: Jetzt taucht schon die Frage nach der Aggression auf. Ich kann dem anderen nicht das lassen, was er beansprucht, worauf er ein Anrecht hat. Ich muss zugreifen. Da ist etwas in uns, in mir, das plötzlich ausbricht.
EUGEN DREWERMANN: Psychologisch oder verhaltensethologisch ist Aggression im Grunde eine gute, eine notwendige Sache. Sie sorgt dafür, dass Ansprüche geltend gemacht werden. Das Entscheidende ist, dass wir die Bedürfnisse, die wir haben, zu artikulieren lernen, so dass der andere uns verstehen kann.
MICHAEL ALBUS: Sie sagen: Aggression ist im Grunde etwas Positives. Warum mutiert sie dann in fast den meisten Fällen zu etwas Negativem?
EUGEN DREWERMANN: Das Hauptproblem ist die mangelnde Verständigung. Statt einmal vorauszusetzen, es sei möglich, durch Pflege von Sprache, von Dialog sich dem anderen begreifbar zu machen, fürchtet man, dass der andere so verschieden von einem selber ist, dass er überhaupt nicht begreifen wird, was man selber möchte. Dann stauen sich die Wünsche auf, dann ist das Misstrauen, abgelehnt zu werden, fast schon eine Gewissheit. Dann mobilisiert man Energien, um die vermutete Abwehr des anderen zu durchbrechen. Der wieder bekommt Angst vor der Gewalt, die er langsam wachsen spürt, und sinnt auf Ähnliches. Er hat gar kein Interesse mehr, den anderen zu verstehen, er will sich vor ihm schützen; also zieht er einen Schützengraben oder setzt Palisaden, um den Angriff abzuwehren. Und dann muss er den Feind besiegen, damit er die Gefahr für alle Zeiten loswird. So kann jeder Konflikt eskalieren. Das Rezept zur Deeskalation müsste darin liegen, dass wir die besten Fähigkeiten intensivieren, über die wir Menschen verfügen: miteinander zu reden. Das Problem der Evolution ist: Wir haben beliebig viele Jahrhunderttausende vor dem Spracherwerb die Keule erfunden und noch früher den Faustkeil. Damit können wir immer noch besser umgehen als mit den Schwierigkeiten, die die menschliche Sprache uns bereitet.
MICHAEL ALBUS: Sigmund Freud gibt im Briefwechsel mit Albert Einstein auf die Frage von Einstein, wie man denn der Aggression begegnen könne, die Antwort, der Eros sei eine Möglichkeit, der Aggression zu begegnen. Aber nun ist der Eros doch auch eine Kraft, die voller Probleme und Aggressionen ist.
EUGEN DREWERMANN: Freud dachte triebtheoretisch und in diesem Punkt fast mythologisch. Der Briefwechsel mit Einstein ist ja recht spät zustande gekommen, bereits unter dem Eindruck des Aufmarschs des Faschismus in Deutschland. Was Freud meinte, ist nicht übel. Aggression ist unter anderem ein Ausdruck von Verlangen. Man geht auf einen anderen zu. Das ist die lateinische Urbedeutung von »aggredi«. Da kommt etwas in Bewegung. Man hat positiv oder negativ an einem anderen ein Interesse. Und sonderbarerweise ist sogar das negative Interesse am anderen, vermischt mit Neugier, oft genug eine Einladung, es gemeinsam zu versuchen. Mancher Mann wird sich erinnern, wie er als Junge mit zwölf Jahren das Mädchen, das er eigentlich lieb hatte, erst einmal mit einem Schneeball beworfen hat als Anfang einer Kontaktaufnahme. Das war aggressiv, aber das Mädchen sollte ihn daraufhin freundlich anlächeln, und wenn es das tat, konnte man noch besser als mit Schneebällen Kontakt aufnehmen. – Oder verweisen wir auf ein geschichtliches Beispiel: Zwischen Abendland und Orient haben die Kreuzzüge einen ungeheuren Kulturaustausch eröffnet, weil man anfing – wenn auch aggressiv zunächst – sich langsam kennenzulernen und dann auch besser zu verstehen.
Was Freud in seiner Theorie von dem Triebgegensatz von Eros und Thanatos, von Liebe und Tod, vorschwebte, ist die Möglichkeit, durch gefühlsmäßige Verbindung etwas Neues gemeinsam in die Welt zu bringen. Das Problem der Aggression, der Destruktion, sah er in die Balance gebracht durch die Kraft der Sexualität. Uralte Triebmächte, die von der Abgrenzung der Aggression hinführen zur gemeinsamen Fähigkeit, Leben zu zeugen und damit das gesamte Geschehen in der Welt zu bereichern, bedingen einander. Ich glaube, dass es recht spekulativ gedacht ist, von der Aggression zur Erotik zu kommen, doch die Triebvermischung von Aggression und Sexualität, die Freud beschrieb, hat eine lange psychologische Entwicklung.
Ein einfacherer Ansatz für das Zusammenspiel von Distanz (Aggression) und Nähe (Eros) wird in der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg, in der Schule der GFK, geübt. Man macht Trainingskurse, Gruppenstunden, in denen nichts anderes versucht wird, als jede aggressive Äußerung zurückzuführen auf ein originäres Bedürfnis. Wie äußert man ein Bedürfnis so, dass es den anderen nicht beleidigt, sondern sich mitteilt? Und wie hört man dem anderen so zu, dass er eine Chance bekommt, verstanden zu werden? Man übersetzt also die Aggression, die man wahrnimmt, in die Frage: Was für ein Bedürfnis steht dahinter? Wenn das sprachfähig gemacht wird, verliert die Aggression ihre Gefährlichkeit, geht man nicht mehr konfrontativ aufeinander zu, sondern besetzt man das Niemandsland von zwei Seiten friedlich und stellt fest: Man kann gemeinsam mitten zwischen die Fronten, die als solche gar nicht mehr existieren, ein gemeinsames Haus errichten, eine Wohnstätte für beide.
Wie schwierig das freilich im Konkreten ist, lässt sich vielleicht am besten zeigen an einem Beispiel aus der Zeit der Völkerwanderung, als die Westgoten jahrzehntelang auf der Suche waren nach nichts anderem als nach einem Land, in dem sie sich hätten niederlassen können. Ihr König Alarich wollte keinen Krieg mit Rom. Er wollte lediglich für Zehntausende von Menschen einen Raum haben, auf dem sie ihre Äcker bestellen und leben könnten, unter Kontrolle der Römer, mit den Abgaben, die nötig waren, um sie zufriedenzustellen, und dann einfach geduldet werden. Hinter ihnen war kein Leben mehr. Hinter ihnen kamen die Hunnen. Hinter ihnen lagen Naturkatastrophen. Es gab Leben eigentlich nur in der Richtung, wo es gesucht wurde: im Gebiet des römischen Imperiums. Dass die Römer dies verweigert haben, hat am Ende dazu geführt, dass man Rom im Jahre 410 plünderte. Aber wieder nicht, um es zu plündern, geschah das, sondern nur um zu sagen: »Jetzt lasst uns doch hier leben! Wir wollen euch nichts tun.« Das ganze scheiterte an den Machtkabalen in Ravenna. Man wollte Macht haben aus rein persönlichem Egoismus. Man sah nicht Menschen, man sah im Grunde nur sich selber. Das führte schließlich dazu, dass die Westgoten weiterzogen, dass sie bis nach Spanien marschieren mussten. Dort bauten sie für zweihundert Jahre ein eigenes, wunderbares Reich auf, das dann von den Arabern zerstört wurde. Wie viel ist nötig, dass man Menschen leben lässt? Das ist im Grunde die Frage des Niemandslandes.
MICHAEL ALBUS: Und sie vermischt sich mit der Frage der zwischenmenschlichen Beziehungen. Ganz im Grunde steht auch die Frage: Kann der Mensch leben ohne Aggression? Geht das überhaupt?
EUGEN DREWERMANN: Nein, ich glaube, man kann nicht leben ohne Aggression. Man muss lernen, darf lernen, sollte lernen, die Dinge, die sich lohnen, offensiv zu vertreten und mit der gebührenden Deutlichkeit dem anderen mitzuteilen. Wenn das nicht geschieht, ist die erste Folge, dass die Abgrenzungen schon zwischen Mann und Frau, zwischen zwei Menschen in der Ehe oder zwischen einem Liebespaar nicht mehr eindeutig sind. Dann überrennt der eine die unsichtbaren Grenzen des anderen, die nicht angezeigt wurden, und fügt ihm in seiner Welt Schaden oder Schmerzen zu, ohne das eigentlich zu wollen. Plötzlich bekommt er Vorwürfe – aber viel zu spät: Dies hier ist meine Grenze, du hast sie überschritten, heißt es. Der andere konnte die Grenze aber gar nicht sehen, weil sie nicht markiert war. Er fühlt sich jetzt zu Unrecht beschuldigt. Also beginnt die nächste Stufe der Auseinandersetzung: Der eine gilt als ein Grobian, weil er die Grenze nicht gesehen hat, die der andere nicht definiert hat. Der andere hinwiederum gilt als Schwächling, der vielleicht, wenn er allzu scheu ist oder rücksichtsvoll, nie den Mut hatte, seine Aggression ins Spiel zu bringen – er wird sich jetzt vermutlich noch mehr ins Schneckenhaus zurückziehen. Und dann kann eine Beziehung, die eigentlich von beiden Seiten her als äußert wünschenswert erschien, buchstäblich in Sekundenschnelle ins Dilemma geraten.
Es ist also wichtig zu lernen, dass man subjektiv berechtigte Interessen hat. Es ist sehr wichtig zu lernen, wie man für diese Interessen eine angemessene Sprache findet. Unterdrückt man diese Fähigkeit, tut man dem anderen Unrecht, weil man von vornherein ihm nicht zutraut, dass er überhaupt die Bereitschaft besitzt, die eigenen Interessen zu verstehen, dass er im Grunde zu unsensibel ist, zu brutal ist, zu wenig rücksichtsvoll ist, – dass er ein Mensch ist, mit dem man nicht zusammenleben kann. Eine solche Unterstellung ist tatsächlich eine unwiderlegbare Beleidigung, die nur dadurch zustande kommt, dass man die eigenen Sphären nicht wirklich markiert.
Aggressionen haben im Ursprung den Sinn, zu zeigen: Bis dahin bin ich bereit, dir entgegen zu kommen, und von da an betrachte ich – möglicherweise – dich als übergriffig, grenzwertig, zudringlich, eindringlich; von da an fängst du an, mir wehzutun und unangenehm zu sein. Nichts weiter ist zunächst die Aufgabe der Aggression. Wird sie unterdrückt, vielleicht sogar chronisch, kann sie dazu führen, dass Menschen überhaupt das Gefühl haben, dass sie selber immer kleiner werden und die anderen immer größer, – eine Welt von Zwergen und Riesen.
Speziell alle Depressionen sind mehr oder minder so geartet. Man hat – Freud würde jetzt sagen – orale Gehemmtheiten, weil man nie hat lernen dürfen, eigene Wünsche über die Lippen zu bringen. Es war verboten. Man durfte dem anderen nicht lästig werden, man durfte nicht in die Interessen der anderen eingreifen, weil es überhaupt nicht passend schien, weil man darum betteln musste, überhaupt leben zu dürfen. Wenn das die Welt in Kindertagen bereits war, muss man sehr vorsichtig und leise auftreten.
Es gibt einen Mythos in der Antike, der das beleuchtet, die Geschichte von einem Mädchen, dem die Göttin Hera die Sprache genommen hat. Dieses Mädchen heißt Echo. Echo hat, eigentlich sehr redefreudig, Hera bei dem Versuch aufgehalten, ihren Gatten Zeus auf frischer Tat beim Ehebruch zu ertappen, und die Göttin rächt sich nun, indem sie Echo dazu verurteilt, nicht mehr sprechen zu können, sondern nur noch nachzureden, was andere ihr vorsagen, und davon auch nur noch den letzten Teil. – Ich kann mir schwer denken, dass ein psychischer Sachverhalt der aggressiven Gehemmtheit sich deutlicher beschreiben ließe als in einem solchen Zustand der Echo. Man will niemandem mehr widersprechen, man will niemandem in die Quere kommen, man will nur noch freundlich sein, man wirft sich in den anderen hinein, man wiederholt seine Worte. Man ist eigentlich nur noch das, was der andere in den Wald hineinruft, in Wiedergabe. Die Frage lautet: Wie kann man einer Echo jetzt sagen, dass sie ein Recht besitzt, sich selbst zu artikulieren, selber von sich zu reden, in ganzen Zusammenhängen sich begreifbar zu machen? Das zu vermitteln ist eine lange, lange Übung.
MICHAEL ALBUS: Das heißt, um noch einmal zum Begriff des Niemandslandes zurückzukommen: Es wird unausweichlich Niemandsländer geben, solange wir leben?
EUGEN DREWERMANN: Das Niemandsland ist leichter erträglich als der Zustand einer Echo. Eine Echo ist gar nicht mehr. Sie ist eigentlich nur noch eine akustische Wahrnehmung. Sie hat gar kein »Land« mehr zu eigen. Sie schwebt im Grunde nur noch über dem Gelände, sie ist als Person gar nicht mehr gegenwärtig. Sie ist aufgelöst in einer Schallbildung, die von anderen ausgeht. Zum Niemandsland gehört wenigstens noch die konfrontative Auseinandersetzung zwischen realen Partnern, die dann auch die Chance haben, sich auf besserem Niveau als auf dem der kriegerischen Auseinandersetzung zu begegnen. Eine Echo muss man allererst zurückrufen aus ihrem Geisterstatus. Das ist, wie wenn man eine Tote wieder aus dem Hades auf diese Erde zurücklockt – es ist unendlich mühsam.
MICHAEL ALBUS: Die Gefahr im Niemandsland ist auch, dass man sich auflöst, dass man zu nichts wird.
EUGEN DREWERMANN: Mir fällt das bittere Bonmot des preußischen Militärtheoretikers Carl von Clausewitz ein: »Der Aggressor ist immer friedfertig.« Er wollte damit sagen: Jeder Angreifer hat kein anderes Interesse als die komplette Unterwerfung desjenigen, den er angreift. Er braucht kein Niemandsland, weil das Terrain, auf das er Anspruch erhebt, nach seiner Vorstellung ihm sowieso gehört. Es ist also bereits ein Unrecht des Gegners, dass er sich verteidigt und den Einmarsch behindern will. Das muss man ihm abgewöhnen. Der Aggressor ist in dem Sinne immer friedfertig, als er gar keinen Krieg möchte. Das muss man erst einmal begreifen. Diejenigen, die sich dem Totalanspruch der stärkeren Macht nicht beugen, sind von vornherein die Terroristen, die Guerillakämpfer, die Verbrecher, sie sind diejenigen, bei denen man von vornherein das Recht hat, sie nach Den Haag vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen; die Supermacht selber kann man nicht nach Den Haag bringen, sie hat qua Macht immer schon recht.
MICHAEL ALBUS: Niemandsländer entstehen oder werden sichtbar durch Sprachlosigkeit.
EUGEN DREWERMANN: Sprachlosigkeit drängt zur Gewalt. Aber das Niemandsland besteht in der Neutralisierung eines Anspruchsfeldes bei Gleichgewichtigkeit der Kombattanten. – Ein solcher Streifen, der seit über einem halben Jahrhundert derart existiert, ist zum Beispiel der 38. Breitengrad in Korea. Man hat in den Waffenstillstandsverhandlungen 1954 – von Frieden ist bis heute nicht die Rede – sich auf eine Pattsituation verständigt, nichts weiter. Das ist ein klassisches Niemandsland. Der 38. Breitengrad ist immer noch gefährlich. Wenn irgendein Schiff die Demarkationslinie überfährt, kann sofort scharf geschossen werden. Dann gibt es wieder die Unklarheit: Liegt eine Verletzung der Waffenstillstandslinien vor oder nicht, oder ist das ein geplanter Übergriff, eine Provokation der Gegenseite? Dadurch können alle möglichen neuen Kriegshandlungen ausgelöst werden.
MICHAEL ALBUS: Im Grunde genommen ist das Niemandsland auch ein Land, in dem es, vom ersten Anschauen her, keine Wege gibt. Man irrt darin umher.
EUGEN DREWERMANN: Es gibt keine ausreichende Kommunikation. Um bei dem koreanischen Beispiel zu bleiben: Man hat in Panmunjom 1951 angefangen zu verhandeln, indem man buchstäblich gar nichts sagte. Man traf sich jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit in einer Baracke, man verbeugte sich voreinander, und dann hatte das Affenspiel sein Ende; man drehte sich um und ging wieder auseinander – ohne ein einziges Wort. Die Lösung sollte nicht in der Gemeinsamkeit liegen, schon gar nicht im Austausch, sondern vielleicht in der Veränderung der äußeren Kräfteverhältnisse: Wenn der Sowjetblock einbräche, dann wäre Südkorea im Vorteil gegenüber Nordkorea. Wenn der Kapitalismus unterginge, wäre das Umgekehrte der Fall. Bis dahin musste man abwarten.
MICHAEL ALBUS: Also ist das Niemandsland ein Land, in dem sich nichts ändern soll, in dem der Status quo einfach bestehen bleibt. Und der wird zusätzlich bewaffnet mit Angst.
EUGEN DREWERMANN: Es gibt keinen anderen Weg heraus, als zu der Feststellung zu gelangen, dass die Erde niemandem gehört, sondern allen gemeinsam ist. Erst wenn das feststeht, müsste man nicht um Land streiten, sondern um die Art des Umgangs miteinander. Aber das setzt die Zurücknahme all dessen voraus, was in die Auseinandersetzung hineingeführt hat. Man müsste ganz von vorne anfangen. Man müsste die Sprache wiederfinden, die man nicht gehabt hat, als man gegeneinander mit Gesang und Bajonett oder schon sprengbereiter Handgranate aufeinander losging.
MICHAEL ALBUS: In dieser Betrachtung liegt ein ganz großes Stück Pessimismus.
EUGEN DREWERMANN: Es liegt mit darin, dass es erwiesenermaßen kaum möglich ist, dass innerhalb der Auseinandersetzungen, in denen Niemandsländer entstehen, die Kombattanten noch fähig sind, sich in ein realistisches Gespräch der Versöhnung zu begeben. Auch das hat Clausewitz ganz richtig gesagt: »Jeder Krieg hat die Tendenz in sich, zum äußersten zu schreiten, insofern nicht hemmende Faktoren auf ihn einwirken.« Dieses Hemmende kann die überanstrengte Wirtschafts- und Produktionslage an der Heimatfront sein, das können aber auch Interessen anderer Staaten sein, die sich mit einmischen. Darin liegt natürlich auch ein Ansatzpunkt zur Konfliktlösung. Wie organisieren wir hemmende Kontrollfaktoren eskalierender Konflikte? Wir bräuchten eine Vermittlungs- und Appellationsinstanz, an welche Partner, die sich miteinander nicht verständigen können, sich wenden dürften oder müssten.
Dieser Aspekt ist sehr wichtig, und er hat gewissermaßen die Logik der Geschichte auf seiner Seite. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das Gewaltmonopol des Staates etabliert haben. Das hat die Rechtsüberzeugung zur Grundlage, dass innerhalb des einzelnen Staatsgebildes Bürger, die nicht imstande sind, sich zu verständigen, sich an die örtlichen Gerichte wenden müssen, damit ein auf die Rechtsbasis gestützter Urteilsspruch erfolgen kann. Keiner der Bürger jedenfalls hat das Recht, seine eigenen Ansprüche mit Gewalt gegenüber einem anderen geltend zu machen. Das ist gemeint mit Gewaltmonopol des Staates. Ein solches funktioniert heute bereits innerhalb jedes einzelnen Staates, aber es funktioniert noch nicht international zwischen den Staaten. Das aber müssten wir erreichen. Es ist der nächste Schritt der geschichtlichen Logik: Wir bräuchten eine internationale Schiedsstelle, an welcher lokal nicht lösbare Konflikte unter bestimmten Voraussetzungen zur Appellation delegiert und dann entschieden werden könnten – mit Durchsetzungsanspruch und -fähigkeit. Wir bräuchten dann so etwas wie ein Gewaltmonopol der UNO.
Ich betone das deshalb, weil völlig konträr dazu derzeit eine Art Gewaltmonopol der US-Amerikaner besteht: Amerikaner können beschließen, anzugreifen wen und was sie wollen, sogar mit humanen Gründen; sie sind immer im Recht, egal was sie tun, ob sie die ganze Welt abhören, ob sie die ganze Welt kontrollieren, ob sie bombardieren, ob sie mit Drohnen gezielt töten, – sie brauchen dafür keinen Gerichtsbeschluss. Es genügt, dass sie befinden, es müsste zu ihrem Vorteil sein. Das ist das Gegenteil dessen, was gemeint ist mit Gewaltmonopol der Völkergemeinschaft. Es müsste eine internationale Schiedsstelle geben, die neutral bleibt gegenüber allen einzelstaatlichen oder gruppenbezogenen Interessen, so wie wir von einem Richter erwarten, dass er sich an die Rechtslage hält und an nichts weiter, dass er nicht bestechlich ist, nicht korrumpierbar, dass er nicht von vornherein Partei ergreift für irgend ein Machtgebilde oder ein Finanzsystem, sondern dass er nach Rechtslage urteilt und neutral entscheidet. Wenn ein solches Appellationsgericht international rechtswirksam zu etablieren wäre, gäbe es eigentlich auf dieser Welt keine Niemandsländer mehr, die nicht auflösbar wären.
MICHAEL ALBUS: Wenn, wenn, wenn ... Warum immer wenn?
EUGEN DREWERMANN: Weil wir immer noch dazu neigen, dass der Egoismus einzelner Staatengebilde, Kulturgruppen, Religionsgemeinschaften, Totalansprüche stellt und dann die Durchsetzung gegenüber beliebig vielen Widerständen sich zum Ziel macht.
MICHAEL ALBUS: Das Niemandsland als Bühne, auf der, im Grunde genommen, das Drama des Menschen spielt.
EUGEN DREWERMANN: Noch, noch ist das leider so. Das Leid derer, die im Niemandsland umgekommen sind, ist für beide Seiten längst schon unerträglich gewesen im Ersten Weltkrieg. Jeder wusste: Das mag jetzt ein Deutscher sein, der da stirbt, das kann aber auch ein Franzose sein oder wer auch immer – nein, es ist ein Mensch, er schreit jetzt nicht mehr auf Französisch oder Deutsch, er schreit wie ein Mensch, der Schmerzen hat und der dabei ist zu krepieren und der am liebsten erschossen werden möchte, weil der Schmerz nach einem Bauchschuss unerträglich ist. Es kann ihn aber keiner holen. Es kann ihm noch nicht einmal jemand den Gnadenschuss geben. Daraus konnte man vor beinahe 100 Jahren schon im tausendfachen Maßstab erkennen, dass die ganze Situation, die wir Krieg nennen, menschlich nicht haltbar ist. Wir führen noch Kriege, aber …
MICHAEL ALBUS: Woher nehmen Sie den Optimismus, wenn Sie »noch« sagen?
EUGEN DREWERMANN: Ich nehme ihn aus der Wahrnehmung von Menschen, die imstande sind zu hören, zu fühlen, persönlich zu reagieren und sich die Erlaubnis zu nehmen, die Evidenz der Humanität als Handlungsgrundlage, als Anspruch rückzumelden. Die Schwierigkeit ist, dass auf der höheren Entscheidungsebene alles überhört wird, nicht gesehen wird, was im unmittelbaren Kontakt selbstverständlich ist, ja, dass man die Menschen Generation für Generation immer wieder neu dazu erzieht, blind und taub zu werden gegenüber menschlichem Leiden. Dann vermitteln sich die Erfahrungen nicht. Die Leute, die aus dem Ersten Weltkrieg kamen, haben, wie Erich Maria Remarque, zwölf Jahre gebraucht, bis sie »Im Westen nichts Neues« schreiben konnten, und als das Buch herauskam, waren große Teile im deutschen Sprachraum schon wieder dabei, aufzumarschieren für den nächsten Weltkrieg.
MICHAEL ALBUS: Es gibt überhaupt keinen Krieg, der zu Ende geführt werden kann.
EUGEN DREWERMANN: Das war ja die Meinung des Friedensfreundes Erasmus von Rotterdam schon im 16. Jh.: Der Krieg ist eine einzige Widersprüchlichkeit, wenn man ihn moralisch oder rechtlich betrachtet, indem er vorgibt, dass man mit Gewalt Recht durchsetzen könnte.
MICHAEL ALBUS: Sie müssen noch besser erklären, woraus Ihr Optimismus kommt, dass diese Haltung eigentlich doch zu überwinden wäre. Ich bin mir da nicht mehr sicher.
EUGEN DREWERMANN: Ich habe ganz großes Vertrauen zu Menschen, die man in ihrer Welt erst einmal belässt. Wir mögen groß geworden sein unter sehr schwierigen Bedingungen, aber wir haben auch gelernt, aufeinander zu reagieren. Wenn jemand sieht, wie ein anderer weint, ist es spontan, darauf mit Mitleid zu reagieren. Wenn man jemanden schreien hört in Not, ist man unmittelbar motiviert, ihm zu helfen. So sind wir Menschen auch. Das Problem ist, dass auf der Entscheidungsebene von Politik und Wirtschaft, von größeren Organisationsformen, die Basisevidenz des Menschlichen ausgeschaltet wird. Man lässt die Einzelnen nicht handeln, wie sie fühlen würden, wenn sie dürften, sondern man trainiert ihnen das Mitleid, die unmittelbare Reaktion der Menschlichkeit weg. Man zwingt sie, darauf keine Rücksicht zu nehmen.
Ein Mann, der über den Zweiten Weltkrieg viel nachgedacht hat, ist der Berliner Historiker Jörg Friedrich. Er hat vor ein paar Jahren eine intensive Diskussion zu der Frage ausgelöst, wie es denn möglich ist, den Zweiten Weltkrieg als Legitimation dafür zu nehmen, dass den ganzen Rest des 20. Jahrhunderts, fünfzig Jahre lang, immer wieder Kriege begründet wurden damit, dass der Zweite Weltkrieg gegen Hitler-Deutschland nötig war und dass es doch ein guter Krieg war: Er musste sein. Auch die Bombardements mussten sein. Weil die Deutschen mit dem Kriege angefangen hatten, war es umso wichtiger, dass man es den Deutschen heimzahlte. Am Ende, 1945, waren die Alliierten erstaunt, dass es nur 500 000 Tote gab in den Häuserschluchten so ziemlich aller total zerbombten deutschen Großstädte – nur 500 000. Die Luftabwehr war bis zuletzt entsprechend stark gewesen. An der Front herrschte ungefähr ein Verhältnis von 1:10 – und ähnlich waren die Totenzahlen der Bombenopfer gemessen an der Zahl der abgeschossenen Piloten. Friedrich fragte, von wann an denn die Skrupel bei der Rechnerei beginnen sollten? 500 000 Tote rechtfertigen »natürlich« den Zweiten Weltkrieg als erfolgreich angesichts der Verbrechen der Nazis. Das mag rechnerisch sogar noch irgendwie in militärischer Logik plausibel klingen. Wenn man aber jetzt bedenkt, wer unter die 500 000 Toten zu zählen ist? Das waren Leute in Altenheimen, die nicht gerettet werden konnten, das waren Kinder, die in den Bunkern bei lebendigem Leibe verbrannt sind, das waren Menschen, die tagelang unter dem Schutt verröchelt sind. In all dem sind Zivilisten vom Krieg berührt worden, die den Krieg überhaupt nicht wollten und ganz sicher subjektiv völlig unschuldig waren. Von wann an sollen die Skrupel beginnen? Friedrich fragte so zynisch, wie man es in dem Zusammenhang wohl muss, um den Zynismus der gesamten Denkweise zu demaskieren: Sollen die Skrupel beginnen bei zwei Millionen Toten oder bei sechs Millionen Toten? Ab wann ist ein Krieg eigentlich schlecht? Wann fangen wir an, die Mittel zu problematisieren, wenn uns der Zweck genehm ist? Vielleicht stimmt die ganze Logik von instrumentalisierter Unmenschlichkeit und vermuteter Menschlichkeit im Enderfolg nicht. Vielleicht kehren wir zurück zu den Ideen von Immanuel Kant, der davon spricht, dass Menschen niemals als Mittel zum Zweck zu gebrauchen wären. Wenn Krieg immer wieder darin besteht, Menschen als Mittel zum Zweck einzusetzen, dann ist die ganze Rechnung von Anfang an unmoralisch. Man darf nicht töten, um Leben zu schützen. Es ist von Anfang an der falsche Ansatz. Man kann nicht Recht durchsetzen durch Rache und Gewalt. Man kann die Wahrheit nicht befördern durch die Lüge, nicht Menschlichkeit durch Grausamkeit. Wir müssen anfangen, prinzipiell zu denken. – Nun habe ich die Vermutung, und bin nicht ohne Optimismus, dass wir von den Stadtstaaten der alten Sumerer lernen können, vor rund fünftausend Jahren bereits, zu begreifen, dass die Geschichte eine Logik hat. Die Stadtstaaten in Mesopotamien um 3000 vor Christus haben zum ersten Mal so etwas eingeführt wie jenes Gewaltmonopol der staatlichen Kontrolle, von dem wir lernen müssten, es international nach dem gleichen Lösungsansatz zu Ende zu denken.
Wie sich die Fronten bilden: Es beginnt in Kindertagen
MICHAEL ALBUS: Ich will einen neuen Anlauf nehmen. Die Situation, die wir in Umrissen beschrieben haben, ist komplex bis kompliziert. Ich frage mich immer intensiver: Wie ist das alles zustande gekommen? Wie hat sich das aufgebaut? Sie haben das jetzt kulturgeschichtlich, politisch ein wenig beschrieben, an Bewegungen im letzten Jahrhundert und bis in unsere Zeit hinein. Aber wie baut sich das ganz konkret bei Personen auf? Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, wie ich erzogen worden bin, dann habe ich so ein Aufbaumodell, das ich heute menschlich eher als ein Abbaumodell empfinde. Wie baut sich so etwas auf, dass ich schrecklich kontrolliert lebe? Als Kind hat man mir systematisch versucht, die Abenteuerlust, das Ausleben auszutreiben. Da gab es starke Verbündete meiner Eltern. Das war die bürgerliche Gemeinde, das war die Schule, das war die Polizei, das war die Kirche. Man hat uns ganz bewusst zu einem Sicherheitsdenken und -leben erzogen, das im Grunde genommen einem Wahn geglichen hat. Ich trauere dem manchmal nach, dass ich damals nicht über die Stränge geschlagen habe, wie ich es eigentlich hätte tun wollen und tun sollen. Ich war eingesperrt in einen Drahtverhau von lauter Regeln, Vorschriften, Geboten und Ängsten, die immer die Ängste der Erwachsenen waren, nicht meine Ängste. Später habe ich gemerkt, wie leicht ich zu vereinnahmen war von Systemen aller Art. Wie baut sich so etwas auf? Das ist ja auch die Situation des modernen Menschen, dass er sich im Drahtverhau befindet. Ich empfinde mich manchmal so ohnmächtig, dass ich mich kaum befreien kann aus den Fesseln, die mir andere angelegt haben. Ohnmacht – genauso! Manchmal Verzweiflung fast.
EUGEN DREWERMANN: Es beginnt alles in Kindertagen, und so schildern Sie es ja auch. Das Entscheidende ist, dass ein Kind die Wirklichkeit nicht einschätzen kann, nicht kennen kann, und dass sie ihm vermittelt werden muss durch die Personen seines Vertrauens, durch die Eltern. Ein Kind hat zunächst nicht Angst vor der Wirklichkeit draußen, schon weil es sie nicht kennt. Es hat aber absolute Angst, verlassen zu werden von den Eltern, von den Vertrauenspersonen, die ihm die Wirklichkeit erklären, aber es auch schützen vor der Wirklichkeit. Die Grundangst eines Kindes ist nicht die Realangst, sondern die Verlassenheitsangst. Es stellt fest, dass die Eltern mit Liebesentzug reagieren können. Und diese Strafe des Liebesentzugs bedingt die konkrete Form der Angst vor Verlassenheit: Die Eltern könnten sich zurückziehen. Sie könnten sich sogar abwesend stellen, wenn sie anwesend sind. Sie sind dann halt für das Kind nicht da, sie haben Wichtigeres vor. Das ist ein Mittel, ein Kind zur Anpassung zu nötigen. Es ist hilflos genug, es hat keine Chance, ohne die Eltern zu überleben. Es unterliegt also den Prägungen der Eltern. Dagegen kommt es nicht an. Die Eltern unterliegen der Verantwortung insofern, als die Art, wie sie ihr Kind prägen, gesellschaftskonform sein soll. Sie wollen eigentlich ja nicht einen Eskapisten, einen Wirklichkeitsflüchtling großziehen, sondern ein Kind, das unter den Bedingungen der gegebenen Kultur eine sinnvolle Überlebens- und Gestaltungsform erhält.
MICHAEL ALBUS: Das lebenstüchtig sein soll …
EUGEN DREWERMANN: Deshalb nennt man die Eltern auch Kulturagenten. Sie vermitteln die Werte, die in der Kultur relevant sind, die Verhaltensweisen, die erwünscht sind. So formen sie bis in die Feinheiten hinein, wie man redet, wie man sich kleidet, wie man isst, wie man spricht, wie man sich benimmt.
MICHAEL ALBUS: »Mach einen Diener!«, »Sag danke!«
EUGEN DREWERMANN: Dagegen ist nichts zu sagen, es muss sein. Die Frage ist, in welcher Art es stattfindet. Eine Erziehung, die stark angstgeprägt ist, wird vor allem in der Zeit, von der Sie jetzt sprechen, autoritär und leistungsorientiert gewesen sein. Das heißt, man fragte nicht, was im Kinde vor sich geht, man hatte bereits ein fertiges Leistungs- und Wertsystem, das eins zu eins vermittelt wurde: So hat man zu sein, weil man hier lebt: »Und weil du mein Junge bist und weil du deine Füße unter meinen Tisch setzt, musst du gehorchen, und du fügst dich dem, was ich sage, denn ich – der Vater – kenne die Welt, und du darfst sie nicht kennenlernen, außer du begreifst, dass sie ist, wie ich sage!« Das ist, was man jetzt Gehorsam nennt, und sofern man nicht gehorsam ist, setzt es die entsprechenden Strafen, um den Gehorsam zu erzwingen. Dann ist Angst latente Aggression, unterdrückte Lust zum Aufstand. Alles das, was Sie schildern, erzeugt ein permanentes Gefühl der Unsicherheit und des Schuldgefühls: Darf man dem, was man selber denkt, trauen? Eigentlich möchte man das, man hat aufgrund der eigenen Intelligenz keine Zweifel, dass zwei mal zwei vier ist. Aber wenn es zugeht wie bei George Orwell: Wie viele Finger sind dies? – und die Antwort soll lauten: sieben, obwohl man sieht, es sind vier Finger, dann wird man sich bequemen müssen, sich die Folter zu ersparen, und man wird sagen: »Es sind sieben Finger.« Am Ende hat das richtig zu sein, was die gebietende Autorität für richtig definiert. Dann ist die Entfremdung total.
MICHAEL ALBUS: Die perfekte Erfahrung von Ohnmacht.
EUGEN DREWERMANN: Es ist die absolute Erfahrung von Ohnmacht. Es ist die Erfahrung, dass man das Eigene unterdrücken muss zugunsten der Anpassung nach außen. Es ist der Verlust des Anspruchsrechts, dass man sich selber noch in einen wirklichen Dialog einbringen könnte. Das ergibt ein gestohlenes Leben, es bewirkt die Delegation an die Funktionsinteressen der verwalteten Autorität im eigenen Familienverband und dahinter dann an die erweiterten Institutionen von Kirche, Schule, Staat, Gesellschaft, Beruf. Ins Unendliche wachsen sich dann die Zonen der Entfremdung, des Niemandslandes aus in Reaktion auf die Schäden, die man in der alten Pädagogik, in der Paukerschule, deutlich wahrnahm, die im übrigen nicht ineffizient war, die in ihrer Weise sogar funktionierte, wie sie sollte.
MICHAEL ALBUS: Nur, zu was war sie effizient?
EUGEN DREWERMANN: Dahinter standen auch damals bereits wirtschaftliche Interessen. Es war eine Zeit, in der der freie Unternehmer gefordert war, wo Kreativität, Erfindungsreichtum, Machtorientiertheit wirklich wünschenswert waren für die Gesellschaft. Denken wir nur daran, dass in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts das Handwerk bei uns noch einen ganz großen Raum einnahm. Staunenswert war, was da gemacht wurde. Auf den autoritären Erziehungsstil haben wir dann vor 45 Jahren mit der Experimentalphase der antiautoritären Erziehung geantwortet: Alexander Neill und die Folgen. Wir haben geglaubt, dass, wenn Autorität so schädlich ist, wie im Faschismus zu sehen, wir die Selbstbestimmung den Kindern überlassen sollten, und damit völlig illusionär den Kindern etwas zugemutet, das sie nicht leisten können. Sie können nicht wissen, warum eine heiße Herdplatte gefährlich ist, wenn man sie berührt. Das muss man ihnen sagen. Wie man mit Messer, Schere, Strom und Licht umzugehen hat, das können Kinder nicht wissen. Man muss ihnen Gefahren ersparen, indem man auch Befehle gibt, Grenzen zeigt und damit Erfahrungen verhindert, die man gar nicht machen sollte, weil sie tatsächlich gefährlich sind. In solchen Zonen gibt es keine andere Erziehung, als normativ Gehorsam einzufordern, wo Autorität zu wahren sinnvoll ist. In der antiautoritären Erziehungsform hat man erlebt, dass die Kinder bis ins Unendliche hinein rebellieren konnten, Konflikte provozieren konnten, bis man dahinter kam, dass das Ganze den Zweck hat, so lange an die Wand zu klopfen, bis man spürbar Autorität wiedergemeldet bekommt. Man wollte so viel Anarchie erzeugen, dass am Ende Ordnung aus dem Chaos neu generiert würde. Man meinte, Kinder wollen das. Sie wollen einfach nicht in einer Welt aufwachsen, die nicht überschaubar ist.
Ich gehe einmal zurück auf das vielleicht wunderbarste Beispiel des Lernens in Autorität, den Spracherwerb. Es ist wunderbar, dass ein Kind lernen kann, in einer biologisch, neurologisch festgelegten Zeitspanne, wie man aus dem Durcheinander, das Eltern ihrem Kind vorsprechen, einen grammatikalischen Apparat generiert, der das alles als Ordnung repräsentiert und durchschaubar macht. Das ist ein Wunder, zeigt aber, dass Kinder mitten im Chaos erwarten, dass sie auf eine in sich geordnete Welt treffen. Eltern werden niemals grammatikalisch so korrekt sprechen, wie die Grammatik es vorschreibt. Aber ein Kind ist imstande, aus dem Durcheinander genau diese Ordnung zu extrahieren. Es ist möglich. Mit dem Vokabelgedächtnis ist es auf charakteristische Weise anders. Sie treffen irgendwo in New York City oder in Rio de Janeiro Leute, die große Mühe haben, deutsche Vokabeln zu finden, denen Sie dabei helfen müssen, aber sie reden Deutsch exakt in ihrer Grammatik. Dann können Sie sicher sein, sie haben bis zum sechsten, achten Lebensjahr Eltern gehabt, die sie in deutscher Sprache erzogen haben. Der Vokabelgebrauch ist ausgedünnt, der heutigen Lebenssituation nicht angepasst worden, aber die Mechanik, richtige Sätze zu generieren, funktioniert immer noch. So stark ist das Ordnungsbedürfnis jedes Kindes, das heranwächst.
Entscheidend ist jetzt, dass man weder die Freude des Kindes, Sprachen zu lernen, noch die Leichtigkeit des Spracherwerbs, noch die Lust, sich selber experimentell neue Formen des Sprechens beizubringen, unterbinden darf. Da genügt es, ein Gegenüber zu haben, das die Freude am Sprechen einfach vermittelt dadurch, dass man spricht. Man wird die Lesefreudigkeit eines Kindes anregen, indem man ihm Geschichten vorliest. Man wird seine Freude an Märchen, an Romanen später, dem Kind beibringen, indem man ihm Geschichten erzählt, die es in den Schlaf begleiten, indem man eine Welt, die dem Kind gemäß ist, zwischen Fantasie und Wirklichkeit, so spannend macht, dass es davon kaum genug bekommen kann, bis es im Vertrauen, da die Mutter ja dabeisitzt, schließlich in Ruhe einschläft.
Diese Welt zu erhalten, sollten wir nun übertragen als Erziehungsmodell in das Gegensatzpaar von Freiheit und Bindung, dann hätten wir einen ganz wichtigen Teil in einem der möglichen Niemandsländer geschlossen. Freiheit und Bindung könnten wir auf das Allerselbstverständlichste zueinander vermitteln durch persönliche Begegnung.