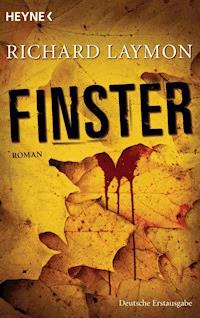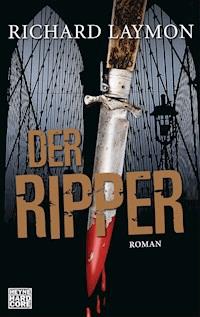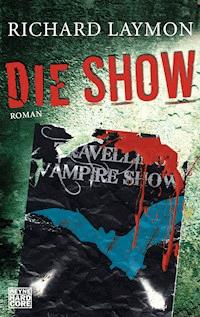Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe NIGHT IN THE LONESOME OCTOBER erschien 2002 bei Leisure Books, New York.
Folgende Zitate mit freundlicher Genehmigung der Verlage: »Ulalume«, Edgar Allan Poe, Das gesamte Werk in zehn Bänden, Walter-Verlag 1966
»Präludium oder das Reifen eines Dichtergeistes«, William Wordsworth, Reclam 1974
»Der alte Seefahrer«, Samuel Taylor Coleridge, Insel-Verlag 1963
Vollständige deutsche Erstausgabe 01/2011
Copyright © 2001 by Richard Laymon
Copyright © 2011 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Published by arrangement with Lennart Sane Agency AB
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-05311-6V002
www.heyne.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Anmerkung des Autors
Copyright
Zum Buch
In diesem Semester bricht für den zwanzigjährigen Ed Logan eine Welt zusammen – seine Freundin Holly, die große Liebe seines Lebens, schreibt ihm einen verhängnisvollen Brief: Sie hat einen anderen kennengelernt und will die Beziehung beenden. Verzweifelt und krank vor Liebeskummer beschließt Ed, sich mit einem nächtlichen Spaziergang abzulenken und sich dann mit ein paar Donuts und einer Tasse Kaffee zu trösten. Es ist eine dunkle, unheilvolle Oktobernacht, und Ed ist nicht allein – er trifft ein hübsches Mädchen, das ihm die Geheimnisse der Finsternis zeigen will. Doch die Nacht kann auch grausam und unbarmherzig sein, und sie steckt voller Gefahren …
»Einer der furchterregendsten und direktesten Horrorromane der letzten Jahrzehnte.« Publishers Weekly
Der Autor
Richard Laymon wurde 1947 in Chicago geboren und studierte in Kalifornien englische Literatur. Er arbeitete als Lehrer, Bibliothekar und Zeitschriftenredakteur, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete und zu einem der bestverkauften Spannungsautoren aller Zeiten wurde. 2001 gestorben, gilt Laymon heute in den USA und Großbritannien als Horror-Kultautor, der von Schriftstellerkollegen wie Stephen King und Dean Koontz hochgeschätzt wird. Richard Laymon im Internet: www.rlk.cjb.net
Lieferbare Titel
Rache – Die Insel – Das Spiel – Nacht – Das Treffen – Der Keller – Die Show – Die Jagd – Der Regen – Der Ripper – Der Pfahl – Das Inferno – Das Grab
Für Jerry und Jackie Lentz, unsere guten Freunde, die immer zu wissen scheinen, worüber wir lachen.
Der Himmel war grau im Oktober, das Laub eine müde Zier - das Laub eine dorrende Zier: es war einsame Nacht im Oktober eines Jahrs unerinnerlich mir …
»Ulalume«
EDGAR ALLAN POE
1
In der Nacht, in der alles begann, war ich zwanzig und mein Herz gebrochen.
Mein Name ist Ed Logan.
Ja, auch Männern kann das Herz brechen. Nicht nur Frauen.
Allerdings fühlt es sich eher wie ein leerer Magen als wie ein gebrochenes Herz an. Eine schmerzende Leere, die kein Essen lindert oder füllt. Sie kennen das sicher. Sie haben es bestimmt schon selbst erlebt. Es tut ständig weh, man ist ruhelos, kann nicht klar denken, wünscht sich beinahe, man wäre tot, aber eigentlich will man nur, dass alles wieder so ist wie vorher, als man noch mit ihr oder ihm zusammen war.
In meinem Fall hieß sie Holly Johnson.
Holly Johnson.
Mein Gott, ich sollte lieber nicht von ihr anfangen. Es reicht wohl, wenn ich sage, dass ich mich im letzten Frühling, als wir beide im zweiten Jahr an der Willmington University studierten, Hals über Kopf in Holly verliebt habe. Und sie schien auch in mich verliebt zu sein. Aber dann war das Semester zu Ende. Ich fuhr nach Hause nach Mill Valley und sie in ihre Heimatstadt Seattle, wo sie als Betreuerin bei irgendeinem beschissenen Sommerlager arbeitete und was mit einem ihrer Kollegen anfing. Wovon ich allerdings erst zwei Wochen nach Beginn des Herbstsemesters erfuhr. Ich wusste, dass sie nicht auf dem Campus war, aber hatte keine Ahnung, warum. Die Frauen aus ihrer Studentenvereinigung spielten die Unwissenden. Ihre Mutter wich mir am Telefon aus. »Holly ist gerade nicht zu Hause, aber ich richte ihr aus, dass du angerufen hast.«
Dann, am ersten Oktober, kam ein Brief. »Lieber Ed, ich werde unsere gemeinsame Zeit nie vergessen …« Und so weiter. Sie hätte mir auch eine Briefbombe schicken können … einen Brief mit einer Voodoo-Bombe, die mich erst tötet und dann als Zombie wiederauferstehen lässt.
Nach dem Brief blieb ich abends in meiner Wohnung und trank Wodka (den mir ein volljähriger Freund besorgt hatte) mit Orangensaft, bis ich die Besinnung verlor. Am nächsten Morgen wischte ich das Erbrochene auf. Dann musste ich den übelsten Kater meines Lebens durchstehen. Zum Glück war der Brief an einem Freitag eingetroffen. Am Montag hatte ich mich größtenteils von meinem Kater erholt. Von meinem Verlust nicht.
Ich ging der Form halber zu meinen Seminaren, tat, als interessierte mich der Stoff, und versuchte, mich zu verhalten wie der Junge, den die Leute als Ed Logan kannten.
An diesem Abend lernte ich bis ungefähr halb elf, oder besser gesagt versuchte zu lernen. Meine Augen wanderten die Zeilen entlang, aber meine Gedanken waren bei Holly. Ich schwelgte in Erinnerungen an sie. Und sehnte mich nach ihr. Und marterte mich mit plastischen Vorstellungen davon, wie sie mit meinem Nachfolger, Jay, ins Bett ging. Er ist so außergewöhnlich und einfühlsam, stand in ihrem Brief.
Wie konnte sie sich in einen Typen verlieben, der Jay heißt?
Ich hatte drei oder vier Jays gekannt, und alle waren Arschlöcher.
Er ist so außergewöhnlich und einfühlsam.
Ich wollte ihn umbringen.
Ich wollte sie umbringen.
Ich hasste sie, aber ich wollte sie zurück. Ich stellte mir vor, wie sie zurückkam und ich weinte, während wir uns umarmten und küssten. Sie weinte ebenfalls und stieß hervor: »Ich liebe dich so sehr, Ed. Es tut mir leid. Ich habe dich verletzt. Ich werde dich nie mehr verlassen.«
Ja, klar.
So ging es mir jedenfalls Montagnacht. Gegen elf gab ich das Lernen auf. Ich schaltete den Fernseher ein, starrte aber nur auf den Bildschirm, ohne wirklich wahrzunehmen, was dort geschah. Dann überlegte ich, ins Bett zu gehen, aber ich wusste, dass ich hellwach daliegen und mich mit Gedanken an Holly und Jay quälen würde.
Schließlich beschloss ich, einen Spaziergang zu machen. Um aus meiner Wohnung rauszukommen. Um irgendwas zu tun. Um die Zeit totzuschlagen.
Thoreau hat geschrieben: »Als könnte man die Zeit totschlagen, ohne die Ewigkeit zu verletzen.«
Scheiß drauf, dachte ich. Scheiß auf Thoreau. Scheiß auf die Ewigkeit. Scheiß auf alles.
Ich wollte durch die Nacht laufen, darin verlorengehen und niemals zurückkehren.
Vielleicht würde mich ein Auto überfahren. Vielleicht würde mich jemand überfallen und ermorden. Vielleicht würde ich zu den Gleisen wandern und mich vor den nächsten Zug werfen. Oder vielleicht würde ich einfach immer weiter laufen, aus der Stadt hinaus, aus dem Staat, einfach raus.
Raus war alles, was ich wollte.
Die Dunkelheit draußen roch süß und feucht, und ein sanfter Wind wehte. Die Oktobernacht fühlte sich eher nach Sommer als nach Herbst an. Da ich zügig lief, fing ich in meinem Chamois-Hemd und der Jeans an zu schwitzen. Also ging ich langsamer. Schließlich hatte ich es nicht eilig.
Obwohl ich ohne Ziel gestartet war, ging ich nach Osten.
Ohne Ziel?
Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Ich hatte meinen Spaziergang nicht mit dem Vorsatz begonnen, zu Hollys Studentenwohnheim zu pilgern, aber genau dort ging ich hin. Meine Füße schienen mich von allein in die Richtung zu tragen. Die Strecke war ich viele Male gelaufen. Anstatt mich zum Vordereingang zu begeben, näherte ich mich der Rückseite des Gebäudes. Ich blieb nicht stehen, ging aber sehr langsam.
Dort war die Veranda, auf der Holly und ich uns nachts so oft zum Abschied geküsst hatten – manchmal eine ganze Stunde oder länger.
Das dritte Fenster von der südlichen Ecke des Gebäudes im ersten Stock war das große Panoramafenster von Hollys Zimmer. Ihres ehemaligen Zimmers. Das Fenster war dunkel. Ein anderes Mädchen schlief wahrscheinlich in dem Raum dahinter … in demselben Bett, in dem Holly immer geschlafen hatte.
Und wo war Holly jetzt? In ihrem eigenen Bett im Haus ihrer Eltern in Seattle? Oder in Jays Bett?
Wahrscheinlich fickt er sie gerade.
Ich konnte es mir vorstellen. Ich konnte es fühlen. Ich konnte Hollys weichen warmen Körper unter mir spüren, ihren begierigen Mund auf meinen Lippen, ihre Zunge in meinem Mund, eine ihrer Brüste in meiner Hand, ihre schlüpfrige feuchte Enge, die sich an mich presste.
Nicht an mich, sondern Jay.
Er ist so außergewöhnlich und einfühlsam.
»Ed?«
Verdammt!
Ich lächelte gezwungen und drehte mich um. »Ach, hallo Eileen.«
Eileen Danforth, ein Mädchen aus Hollys Verbindung und eine ihrer besten Freundinnen. Sie kam vermutlich aus der Bibliothek oder dem Studentenhaus. Der Wind blies durch ihr langes dunkles Haar.
»Wie geht’s?«, fragte sie.
Ich zuckte mit den Schultern.
»Du hast bestimmt Hollys Brief bekommen.«
Natürlich wusste Eileen alles über den Brief.
»Ja«, sagte ich.
»Krass.«
Ich nickte nur.
»Unter uns gesagt, ich finde, Holly hat Mist gebaut.«
»Danke.«
»Ich habe keine Ahnung, was in sie gefahren ist.«
»Ich schon«, murmelte ich.
Eileens Gesicht zuckte, als hätte sie einen kurzen scharfen Schmerz gespürt. »Ja«, sagte sie. »Ich auch. Tut mir echt leid.«
»Danke.«
Sie seufzte und schüttelte den Kopf. »Es ist wirklich eine Schande. Aber wer weiß? Vielleicht bist du ohne sie besser dran.«
»Fühlt sich nicht so an.«
Eileen presste die Lippen zusammen. Sie sah aus, als würde sie anfangen zu weinen. »Ich weiß, wie das ist«, sagte sie. »Bei Gott.« Sie hob die Augenbrauen. »Und, bist du nur hergekommen, um das Haus anzustarren?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich wollte nur zum Donutshop.«
»Dandi?«
»Ja.«
»Um diese Zeit?«
»Er hat durchgehend geöffnet.«
»Ich weiß, aber … es ist ziemlich weit außerhalb.«
»Zehn Kilometer.«
Sie verzog das Gesicht. »Das ist wirklich ein langer Weg.«
»Ich hab nichts Besseres zu tun.«
Sie sah mir eine Weile in die Augen. »Kannst du ein bisschen Gesellschaft gebrauchen?«, fragte sie dann. »Gib mir ein paar Minuten, damit ich meine Bücher wegbringen kann, und …«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich glaube, ich möchte lieber allein sein.«
»Du solltest aber nicht den langen Weg ganz alleine gehen.«
»Das ist schon in Ordnung.«
»Es ist mitten in der Nacht.«
»Ich weiß, aber …«
»Lass mich mitkommen, okay?«
Wieder schüttelte ich den Kopf. »Vielleicht ein anderes Mal.«
»Gut, deine Sache. Ich will dir nicht … auf die Nerven gehen.«
»So war das nicht gemeint.«
»Ich weiß. Ich versteh schon. Du willst einfach allein
sein.«
»Ja.«
»Aber sei vorsichtig, ja?«
»Okay.«
»Und mach keine … Dummheiten.«
»Ich werd mir Mühe geben.«
»Das ist nicht das Ende der Welt.«
Ich stellte mir vor, dass meine Mutter genau dasselbe gesagt hätte, wenn ich zu Hause angerufen und ihr die Sache mit Holly erzählt hätte.
»Es kommt einem nur so vor.«
Das hätte meine Mutter vermutlich nicht hinzugefügt.
»Ja«, sagte ich.
»Aber es wird wieder besser. Bestimmt. Du lernst eine andere kennen und …«
Das hätte wahrscheinlich mein Vater gesagt.
»Du wirst dich wieder verlieben.«
»Mein Gott, hoffentlich nicht.«
»Sag so was nicht.«
»Entschuldigung.«
»Tu mir einen Gefallen, ja? Bring mir zwei Donuts mit.« Das war typisch Eileen. Ich wusste, dass sie mich nicht nur darum bat, weil sie gerne Donuts mochte – obwohl Dandis Donuts wirklich hervorragend waren. Zum einen hatte sie ein Auto und konnte zu Dandi Donuts fahren, wann immer sie Lust hatte. Zum anderen war sie schlank und sehr hübsch und versuchte es zu bleiben, indem sie solche Leckereien wie Donuts vermied.
Das bedeutet nicht, dass sie niemals Donuts aß. Aber sie tat es nur selten.
Und ich wusste, dass sie mir in dieser Nacht eine Aufgabe geben wollte … um zumindest einen Teil meiner Aufmerksamkeit von Holly abzulenken.
»Klar«, sagte ich. »Welche Sorte willst du?«
»Die klassischen mit Glasur.«
»Die Spezialität des Hauses.«
»Ja.« Eileen lächelte ein wenig traurig und leckte sich die Lippen. »Ich kann sie jetzt schon schmecken.«
»Ich weiß nur nicht, wann ich zurückkomme.«
»Bevor ich zu meinem Zehn-Uhr-Seminar muss, hoffe ich.«
»Ich versuch’s.«
»Ich warte im Studentenhaus, während mir das Wasser im Mund zusammenläuft.«
»Ich sorge dafür, dass du nicht verhungerst.«
»Danke.« Während sie mit dem linken Arm ihre Bücher vor der Brust hielt, drückte sie mit der rechten Hand sanft meine Schulter. Ich rechnete damit, dass sie noch etwas sagen würde. Doch sie ließ mich los, wandte sich schweigend ab und trippelte über die Straße zur Vorderseite des Wohnheims. Ihr dunkles Haar wehte hinter ihr im Wind, der Faltenrock tanzte um ihre Schenkel.
Wenn sie Holly gewesen wäre, hätte mich ihr Aussehen bezaubert.
Aber sie war nicht Holly.
Bei ihrem Anblick empfand ich nichts.
Das stimmt nicht ganz. Tatsächlich verspürte ich den unbestimmten Wunsch, sie würde sich irgendwie in Holly verwandeln.
Nicht in die treulose Schlampe, die mich wegen ihres Liebhabers aus dem Sommerlager sitzengelassen hatte, sondern in die Holly des letzten Frühlings, die Holly, die ich geliebt hatte. Diese Holly.
Mein Gott, wie sehr ich sie mir zurückwünschte!
Auf der Veranda blickte Eileen zu mir zurück und winkte. Dann öffnete sie die Tür. Als sie ins Wohnheim ging, konnte ich einen Blick in den Empfangsbereich werfen.
Ich hatte oft dort gewartet, bis Holly aus ihrem Zimmer herunterkam. Im letzten Frühling hatte ich so viele Stunden in der Rezeption verbracht, dass sie mir wie ein zweites Zuhause vorkam. Es gab dort bequeme Sessel, ein paar Sofas, Stehlampen und Tische. Für die Besucher lag Lesestoff bereit, damit sie sich die Zeit vertreiben konnten, während sie auf ihre Freundinnen oder Töchter warteten.
Zerlesene Zeitschriften, Hefte mit Kreuzworträtseln, ein paar abgegriffene Taschenbücher. Und eine alte gebundene Ausgabe von Schau heimwärts, Engel. Ich nahm meistens das Buch von Thomas Wolfe, las darin und betrachtete die wundervollen Illustrationen von Douglas W. Gorsline, während ich auf Holly wartete. Es kam mir immer vor, als dauerte es ewig. Aber schließlich würde sie lächelnd durch den Eingang kommen und dabei so schön aussehen, dass es mir beinahe wehtat, sie anzuschauen.
O verlornes, vom Wind gekränktes Gespenst, kehre zurück!
2
Als ich Montagnacht meine Wohnung verließ, hatte ich nicht vorgehabt, zehn Kilometer zu Dandi Donuts und wieder zehn Kilometer zurück zu wandern. Ich wollte nur raus, nur weg.
Nun hatte ich dank Eileen einen Grund, dorthin zu gehen.
Meine Wanderung hatte einen Zweck.
Wenn mich jemand fragt, dachte ich, kann ich ihm erklären, dass ich auf dem Weg zu Dandi Donuts bin, um für eine Freundin zwei klassische glasierte Donuts zu besorgen.
Allerdings war es nicht gerade wahrscheinlich, dass mich jemand fragen würde.
Außerhalb des Campus’ liefen nur wenige Leute herum. Selten fuhr ein Auto vorbei. Die meisten Studenten waren in ihren Zimmern, lernten oder spielten mit ihren Computern herum, führten tiefgründige Gespräche mit ihren Freunden über philosophischen Blödsinn, hatten Sex oder schliefen. Die anderen Leute, die nicht studierten, waren vermutlich auch größtenteils zu Hause. Lasen, sahen fern, machten Liebe oder schliefen.
Während ich die Division Street entlangging, brannte in einigen Häusern hinter ein oder zwei Fenstern Licht. Andere Häuser waren dunkel, bis auf das flackernde Licht der Fernseher. An den meisten Gebäuden brannte nur die Verandalampe.
Manchmal hörte ich Stimmen, dumpfe Geräusche, Lachen oder andere Laute aus den Häusern, an denen ich vorbeikam. Doch in vielen war es still. Ein paar Vögel waren wach und flatterten durch die Luft oder saßen in Bäumen. Ich hörte sie zwitschern und trällern. Aber in erster Linie hörte ich meine eigenen Schritte auf dem Beton des Bürgersteigs. Es war ein gleichmäßiges Geräusch. Jeder Schritt klang wie der vorherige, wenn ich nicht gerade auf etwas trat: ein Blatt, einen Stein, einen Zweig.
Mir fiel auf, wie schnell die Schritte aufeinanderfolgten, und ich ging langsamer. Warum sollte ich mich beeilen? Mein einziges Ziel war ein Donutshop, der niemals schloss.
Und außerdem war das nur ein zufällig gewähltes Ziel. Letztlich gab es keinen wichtigen Grund, dorthin zu gehen.
Was war mit den Donuts, die ich Eileen versprochen hatte?
Versprochen hatte ich eigentlich nichts.
Aber ich hatte gesagt, ich würde ihr welche mitbringen, und ich wollte mein Wort halten.
Sehr wahrscheinlich wäre ich auch zu Dandi Donuts gegangen, wenn sie nicht aufgetaucht wäre. Also war es keine große Sache. Nur dass ich nun verpflichtet war, dorthin zu gehen.
Und mit den Donuts zurück zu sein, bevor ihr Zehn-Uhr-Seminar begann.
Ich muss nicht, sagte ich mir. Ich muss überhaupt nicht zurück zum Campus oder zu meiner Wohnung oder sonst wohin. Wenn ich will, kann ich einfach immer weitergehen.
Dann kam mir in den Sinn, dass ich nach Norden lief. Wenn ich weiter in diese Richtung ginge, würde ich irgendwann in Seattle landen … der Heimat von Holly und Jay.
Sehnsucht, Wut und Trauer stiegen in mir auf.
Aber ich ging weiter.
Ich werde nicht nach Seattle gehen, sagte ich mir.
Tatsächlich hatte ich erwogen, hinzufliegen, nachdem ich am Freitag Hollys Brief erhalten hatte. Doch ich hatte mich dagegen entschieden. Wenn sie mich für ein Arschloch aus dem Sommerlager abservierte, lag es mir fern, mich aufzudrängen … oder um ihre Liebe zu betteln wie ein totaler Loser. Sie konnte ihren Jay behalten und ich meinen Stolz. Ich betrank mich.
Ich würde nicht nach Seattle reisen.
Mit ein wenig Glück würde ich Holly Johnson nie wiedersehen.
Ich wünschte nur, auch nicht mehr an sie denken zu müssen. Kurz darauf ging mein Wunsch in Erfüllung, als mir ein Mann mit seinem Hund auf dem Bürgersteig entgegen kam. Der Mann war untersetzt, dunkelhäutig und bärtig und trug einen schwarzen Turban. Der Hund an der Leine sah aus wie ein Rottweiler.
Ein Rottweiler an einer dieser endlos langen Leinen, die ihm ein paar Minuten Zeit lassen würden, sein Opfer zu zerfetzen, ehe der Halter ihn zu sich zerren konnte.
Beinahe hätte ich die Straßenseite gewechselt, aber es wäre zu offensichtlich gewesen. Der Mann hätte gekränkt sein oder mich für einen Feigling halten oder gar annehmen können, ich wäre einer dieser Eiferer, die Vorbehalte gegen Turbanträger haben. Deshalb blieb ich auf meiner Seite der Straße.
Als sie näher kamen, lächelte ich, nickte dem Mann zu und trat höflich vom Bürgersteig, um sie vorbeizulassen.
Der Hund, der ein gutes Stück vor dem Mann lief, trottete zu mir und schnüffelte am Schritt meiner Jeans.
Ein kräftiger Biss …
Der Mann am anderen Ende der Leine schien sich für die Aktivitäten seines Hundes nicht zu interessieren.
»Schöner Hund«, sagte ich mit sanfter Stimme.
Er stieß mich mit der Schnauze an. Ich trat einen Schritt zurück, und der Hund knurrte.
Schließlich erreichte der Mann uns. Er sah stur nach vorn und ging vorbei, ohne uns auch nur einen Blick zuzuwerfen. Der Hund leckte an meinem Hosenschlitz.
»Geh weg da«, brummte ich.
Obwohl der Mann schon fünf Meter entfernt war, wandte er nun den Kopf und sah mich finster an. »Es ist verboten, mit meinem Hund zu sprechen.«
»Entschuldigung.«
Er ging weiter und rollte die Leine ein. Der Hund stupste mich noch ein letztes Mal mit der Schnauze an, dann drehte er sich um und folgte seinem Herrchen.
Ich blickte missmutig in ihre Richtung, aber keiner der beiden bemerkte es.
Ich glaube, der Typ war der Meinung, ihm gehöre der Bürgersteig und seinem Hund mein Schritt.
»Arschlöcher«, murmelte ich.
Auch das bekamen sie nicht mit. Was wohl auch besser war. Der Mistkerl hätte den Hund auf mich hetzen oder mit einem Krummschwert auf mich losgehen können. (Falls er eines dabeihatte, ich konnte es nicht sehen … aber wer weiß, was er unter seinem fließenden Gewand verbarg.)
Jedenfalls ging ich weiter und hielt aufmerksam Ausschau nach Hunden. Es schienen zwar keine weiteren aufzutauchen, aber wenn ich an Häusern vorbeikam, löste das gelegentlich Anfälle von wildem Gebell hinter den Zäunen und Toren aus. Die Hunde konnten mich nicht erreichen, ihr stumpfsinniger Krawall verkündete jedoch der gesamten Nachbarschaft meine Anwesenheit. Ich wollte nur still und unsichtbar vorbeigehen, niemand sollte überhaupt wissen, dass ich da war.
Bald wurden die Bellattacken seltener. Entweder ging ich leiser oder hatte einfach eine Gegend mit weniger Hunden erreicht. Was auch immer der Grund war, ich begann, mich ein wenig zu beruhigen.
Die Nacht war sehr friedlich.
Ich sah eine weiße Katze über die Straße huschen und unter einem parkenden Auto Schutz suchen. Ich hörte eine Eule rufen. Manchmal war es so still, dass ich das leise Summen der Straßenlaternen wahrnahm.
Als ich von einem Bürgersteig auf die Straße trat, ließ mich ein lautes Ring-ring-ring nach Luft schnappen. Ich sprang zurück, und ein Fahrrad zischte an mir vorbei.
»Scheiße!«, stieß ich hervor.
»Hui!«, schrie die Radfahrerin, eine dürre ältere Frau in hautenger Stretchhose und mit nach hinten gedrehter Baseballkappe.
Eine modebewusste alte Schachtel.
Sie blickte über die Schulter zurück und grinste mich an. Ich konnte ihr Gesicht nicht besonders gut erkennen, aber es war bleich und dünn, und ich hatte den Eindruck, dass die meisten Vorderzähne fehlten. Aus irgendeinem Grund bekam ich eine Gänsehaut, die auch dann nicht verschwand, als sie sich abwandte und davonstrampelte.
An der nächsten Kreuzung bog sie ab. Ich war froh, dass sie aus meinem Blickfeld verschwunden war, aber zugleich fürchtete ich, sie würde eine Runde drehen, um noch einmal an mir vorbeizufahren.
Vielleicht hatte ich sie gekränkt. Vielleicht wollte sie sich rächen. Vielleicht hatte sie vor, beim nächsten Mal ihren Arm auszustrecken, mich mit einem knorrigen Finger zu berühren und »Lös dich in Luft auf« oder »Kröte« oder »Rektum« oder so was zu flüstern.
Ich glaubte nicht, dass es wirklich geschehen würde, aber es ging mir auf jeden Fall durch den Kopf.
Deshalb wechselte ich die Straßenseite.
Eine Weile ging ich langsam weiter und blickte häufig zurück. Ich fühlte ein seltsames Kitzeln in meiner Brust, wie ein unterdrücktes Kichern oder Schreien, das nur darauf wartete auszubrechen, wenn die Hexe um die Ecke geradelt kam.
Um auf Nummer sicher zu gehen und mich zu beruhigen, bog ich schließlich in eine Seitenstraße. Ich ging ein kurzes Stück, bis ich zwei Kreuzungen weiter die Franklin Street erreichte und meine Reise nach Norden fortsetzte.
Hier wird sie mich nicht finden, dachte ich.
Eine halbe Stunde lang passierte nichts. Ich lief einfach weiter die Franklin Street entlang. Die Häuser schienen hier ein wenig älter zu sein als an der Division Street. Hin und wieder bellte ein Hund. Hier waren noch weniger Häuser beleuchtet. Nur ein oder zwei Autos fuhren vorbei. Ich sah niemanden herumlaufen … oder mit dem Fahrrad fahren.
Doch dann kam aus östlicher Richtung ein Mädchen.
Ungefähr zehn Meter vor mir näherte sie sich von rechts der Kreuzung. Sie blickte nach vorne. Zufälligerweise befand ich mich im Schatten eines Baums.
Ich blieb stehen und hielt die Luft an.
An der Ecke drehte sie mir den Rücken zu, um die Seitenstraße zu überqueren.
Ich stand regungslos da und beobachtete, wie sie der Franklin Street folgte.
Erst als sie die Hälfte des nächsten Häuserblocks hinter sich gebracht hatte, setzte ich mich wieder in Bewegung. Ich trat aus dem Schatten des Baums, ging zur Kreuzung und überquerte ebenfalls die Seitenstraße.
3
Ich verfolgte sie nicht. Ich hielt einfach nur meinen Kurs zu Dandi Donuts.
Aber ich folgte ihr nicht.
Wenn sie an der Ecke einen anderen Weg eingeschlagen und ich meine ursprüngliche Route verlassen hätte, dann könnte man sagen, ich würde sie verfolgen. Aber das war nicht der Fall. Sie hatte sich einfach auf dem Bürgersteig, den ich entlangging, vor mich gesetzt.
Das war ihr gutes Recht, genauso wie es mein gutes Recht war, weiter bei meiner Route zu bleiben.
Ich lief eine Zeit lang in meinem normalen Tempo weiter und verringerte den Abstand zwischen uns. Dann ging ich langsamer. Ich wollte sie nicht überholen.
Wenn ich eine Frau nachts auf dem Bürgersteig überhole, wenn niemand sonst in der Nähe ist, finde ich das immer unangenehm. Während ich mich nähere, befürchten die Frauen, ausgeraubt, vergewaltigt oder ermordet zu werden. Sie werfen mir einen nervösen Blick zu. Und wenn ich an ihnen vorbeieile, versteifen sie sich.
Ich bin kein Monster. Ich wirke nett, fröhlich und harmlos. Aber ich bin ein Mann. Das genügt offenbar, um manchen Frauen Angst einzujagen.
Weil ich sie nicht quälen möchte, habe ich mir angewöhnt, sie nicht auf dem Bürgersteig zu überholen. Ich gehe auf die andere Straßenseite oder biege ab, um nicht an ihren Fersen zu hängen, oder reduziere meine Geschwindigkeit.
Meistens Letzteres. Ich schlage ein Bummeltempo ein, bleibe manchmal für einen Moment stehen und hoffe, dass die Frau abbiegt, ihr Ziel erreicht oder mir auf andere Weise aus dem Weg geht. Erst wenn es offensichtlich ist, dass sie weiter vor mir bleibt, ringe ich mich durch, sie zu überholen oder schlage eine andere Route ein.
Da ich es nicht eilig hatte, zu Dandi Donuts … oder wohin auch immer … zu kommen, sah ich keinen Grund, die Straßenseite zu wechseln oder abzubiegen.
Jag ihr bloß keinen Schrecken ein, sagte ich mir. Geh schön langsam weiter und achte auf einen ordentlichen Abstand.
Sie wird überhaupt nicht bemerken, dass ich da bin.
Bis jetzt schien die junge Frau vor mir mich noch nicht wahrgenommen zu haben. Sie ging einfach mit federndem sorglosem Schritt weiter, ließ die Arme schwingen und sah in alle möglichen Richtungen, aber kein einziges Mal hinter sich. Ihr helles Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, der munter hin und her schwang. Sie trug ein dunkles Sweatshirt, eine dunkle Hose und dunkle Turnschuhe. Sie hatte nichts dabei, nicht einmal eine Handtasche. Das kam mir seltsam vor. Die meisten Frauen gehen nie ohne Handtasche los.
Wo geht sie wohl hin?, fragte ich mich.
Vielleicht zu Dandi Donuts?
Das wäre zu viel des Guten. Höchstwahrscheinlich war sie auf dem Heimweg. Ich fragte mich, ob ihre Eltern wussten, dass sie zu dieser Uhrzeit draußen herumlief.
Wer sagt denn, dass sie bei ihren Eltern wohnt?
Sie hätte auch Mitte zwanzig sein und alleine wohnen können, oder vielleicht war sie verheiratet.
Aber das bezweifelte ich.
Obwohl ich sie nur aus der Ferne und nie in gutem Licht gesehen hatte, hatte ich den Eindruck, dass sie ein wenig jünger war als ich – ungefähr achtzehn Jahre alt. Wenn das stimmte, wohnte sie wahrscheinlich bei ihren Eltern.
Außerdem schien sie äußerst attraktiv.
Im Schein der Laternen sah ihr Gesicht aus, als könnte es hübsch sein. Aber Entfernung und Dämmerlicht können täuschen.
Jedenfalls war es hell genug, um ihre tadellose Figur unter dem Sweatshirt und der Hose erkennen zu können.
Nicht, dass ich sie begehrt hätte. Dank Holly hatten Frauen ihre Anziehungskraft auf mich verloren.
Doch ich fühlte mich ihr auf eine Art verbunden. Wir waren zwei Fremde, die den gleichen Weg einschlugen. Sie lief an denselben parkenden Autos, denselben Bäumen, Wiesen, Häusern vorbei wie ich … nur ein paar Sekunden früher. Wir beide sahen dieselben Lichter, hörten ähnliche Geräusche, rochen und atmeten fast die gleiche Luft, spürten denselben Beton unter unseren Füßen. Auf immer und ewig existierten wir zur selben Zeit am selben Ort … beinahe.
Ich konnte nicht anders, als mich mit ihr verbunden zu fühlen.
Mit ihr verbunden und als ihr Beschützer.
Sie schien viel zu jung, um zu dieser Nachtzeit allein durch die Straßen zu ziehen, deshalb wollte ich dafür sorgen, dass sie sicher nach Hause kam.
Jetzt hatte ich zwei Aufgaben: Donuts für Eileen besorgen und meine neue Gefährtin beschützen.
Ich war ihr Gefährte, auch wenn sie es nicht wusste.
Ich lasse nicht zu, dass dir etwas zustößt, sagte ich im Geiste zu ihr.
Plötzlich blieb sie stehen. Als ich ebenfalls anhielt, wandte sie den Kopf nach links.
Sie wird sich umdrehen!
Obwohl ich im Licht einer Laterne stand, unternahm ich nicht den Versuch, in Deckung zu gehen; jede Bewegung hätte ihre Aufmerksamkeit erregen können. Absolute Reglosigkeit war meine beste Tarnung.
Ich beobachtete sie und wagte nicht zu atmen.
Ein paar Augenblicke später bemerkte ich, dass ihre Augen einer mageren weißen Katze folgten, die von der anderen Seite der Franklin Street auf sie zuschlich.
Sie wandte sich der Katze zu, und ich sah zum zweiten Mal in dieser Nacht ihr Profil. Ihre Figur … ihr hoch angesetzter Pferdeschwanz, der geneigte Kopf, die Form ihres Gesichts, ihr schlanker Nacken, ihre Brüste und ihr Hintern, der sich unter der Hose abzeichnete. Ich will nicht sagen, dass sie athletisch aussah, weil das Kraft suggerieren würde. Das würde einen falschen Eindruck vermitteln. Vor allem wirkte sie selbstsicher, munter und kess.
Sie ging in die Hocke. Ihr Hintern berührte beinahe den Bürgersteig, als sie den Kopf senkte und mit der Katze sprach. »Komm her, Kätzchen«, konnte ich hören. Sie streckte ihre Hand neben dem rechten Knie aus, um die Katze anzulocken.
Die Katze riss ihr Maul weit auf und stieß ein lautes »Miiiau« aus, als wollte sie sagen: »Ich habe dich gesehen. Immer mit der Ruhe, ich bin schon unterwegs.« Zuerst war sie abweisend und scheu, doch dann näherte sie sich schließlich der Hand.
Kurz darauf ließ sie sich fallen und schien vor Wohlbehagen zu schmelzen. Die Frau sprach sanft mit dem Tier, während sie es streichelte, aber ich konnte nicht hören, was sie sagte. Sie verbrachte ungefähr drei oder vier Minuten damit, das Tier zu liebkosen. Als sie aufstand und weitergehen wollte, rieb sich die Katze an ihren Schienbeinen und Waden, glitt zwischen ihren Beinen hindurch, wickelte sich fast um ihre Unterschenkel, damit sie stehen blieb.
Die Frau stolperte beinahe über die Katze, lachte leise und befreite sich mit einem Hüpfer. Als sie weiterging, duckte ich mich hinter einem nahen Baum. Ich spähte hinter dem Stamm hervor und sah, wie die Katze mit erhobenem Schwanz hinter ihr hertänzelte.
»Miiiau!«
Sie blickte zu dem Tier zurück und sagte: »Na gut, aber nur eine Minute.«
Dann drehte sie sich vollständig um und sah in unsere Richtung.
Ich zog meinen Kopf hinter den Stamm zurück. Während ich abwartete, starrte ich auf die Rinde des Baums wenige Zentimeter vor meiner Nase.
»Ja«, hörte ich sie sagen. »Du bist ein armes kleines Kerlchen, stimmt’s? Das bist du.«
Ich konnte sie nicht sehen. Ich konnte sie nur hören. Sie hatte eine wundervolle, seltsame Stimme. Es lag nichts Mädchenhaftes darin. Man könnte sie als maskulin bezeichnen, wenn sie nicht zugleich weich und melodisch geklungen hätte. Sie schnurrte beinahe, als sie mit der Katze sprach.
»Ja, das gefällt dir, oder? Hm, ja. Das fühlt sich wirklich gut an.«
Als ich einen Blick um den Baumstamm herum wagte, sah ich, dass sie über der Katze hockte und beide Hände zwischen ihren gespreizten Knien hindurchstreckte, um sie zu streicheln. Die Katze lag ausgestreckt auf der Seite.
»Meinst du, das reicht jetzt?«, fragte sie das Tier. »Davon kann man nie genug bekommen, was?« Sie tätschelte die Katze noch einmal und machte Anstalten, sich aufzurichten, deshalb konnte ich nicht länger zusehen.
Ein paar Sekunden vergingen. Dann sagte das Mädchen mit ihrer vollen, tiefen Stimme: »Bis dann, Kätzchen.«
Ich blieb hinter dem Baum und horchte. Es drangen keine Geräusche mehr aus Richtung des Mädchens und der Katze herüber. Schließlich riskierte ich einen weiteren Blick. Die Katze lag immer noch ausgestreckt auf dem Bürgersteig, offenbar zu träge, um weiterzuziehen. Das Mädchen hatte bereits die nächste Straße überquert.
Sie blickte nicht zurück.
Ich verließ mein Versteck hinter dem Baum und lief die Straße entlang. Während ich über die Katze hinwegschritt, hörte ich sie schnurren. Dann hob sie den Kopf und maunzte, als würde sie sich von mir gestört fühlen.
Ich ging weiter.
Als ich zurückblickte, war die Katze immer noch dort, lag dünn und lang ausgestreckt auf dem hellen Beton, schien in Erinnerungen an die Hände des Mädchens zu schwelgen und zu hoffen, sie käme zurück.
Ich überquerte ebenfalls die Straße. Das Mädchen war schon bis zur Mitte der nächsten Häuserzeile gekommen, und ich beeilte mich, um den Abstand zwischen uns zu verringern.
Ich hatte das Gefühl, meine Augen würden magisch von ihrem Rücken angezogen.
Doch ich musste für einen Moment zur Seite gesehen haben. Ich bin nicht sicher, was mich ablenkte.
Als ich wieder nach vorn blickte, war der Bürgersteig vor mir leer.
Das versetzte mir einen Stich.
Wo war sie?
Mein erster Gedanke war, dass ein Entführer sie sich geschnappt hatte. Wo ich sie zuletzt gesehen hatte, war der Garten rechts von ihr teilweise von dichten Hecken umgeben. Er könnte sie aus meinem Blickfeld gezerrt haben … Ich rannte los.
Aber was, wenn sie den Garten aus freien Stücken betreten hatte … vielleicht, um zu einem streunenden Hund oder einer weiteren Katze zu gehen?
Ich hörte auf zu rennen.
Immer noch ging ich zu schnell und sagte mir: Langsam. Ich bin nur ein Typ, der hier zufällig vorbeiläuft.
Ich bemühte mich, langsam zu gehen, doch mein Herz raste.
Und wenn sie da am Boden liegt? Wenn irgendein Dreckskerl sie vergewaltigt?
Sie würde schreien, dachte ich.
Nicht, wenn er sie k. o. geschlagen hat. Oder sie getötet hat.
Mühsam unterdrückte ich den Impuls, erneut loszulaufen, und schritt an der Hecke entlang. Das Haus dahinter war dunkel, der Rasen in Schatten gehüllt. Langsam ging ich weiter. Sehr langsam. Ich hielt die Augen offen und lauschte.
Niemand schien dort am Boden zu liegen.
Ich hörte keine Kampfgeräusche.
Hat er sie hinter das Haus gebracht?
Auf der dunklen Veranda bewegte sich etwas.
4
Mit nach vorne gerichtetem Blick ging ich weiter. Nachdem ich an der Hecke, die den Rasen umgab, vorbei war, tat ich sogar noch ein paar zusätzliche Schritte. Dann duckte ich mich und schlich zu den Büschen zurück. Ich spähte an den Sträuchern vorbei zum Haus.
Vom Gartenweg führten ein paar Stufen hinauf zur Veranda, die von einem hölzernen Geländer umgeben war. Ein Vordach schirmte das schwache Licht der Nacht ab. Während ich in die Dunkelheit starrte, fragte ich mich, wie es überhaupt möglich war, dass ich dort eine Bewegung gesehen hatte. Vielleicht hatte ich mir das nur eingebildet.
Dann tauchte in der Schwärze der Veranda ein ungefähr zwei Meter langer, grauer horizontaler Streifen auf.
Zuerst wusste ich nicht, was es war. Erst als der Streifen langsam breiter wurde, begriff ich, dass es sich um gedämpftes Licht aus dem Inneren des Hauses handelte. Die Tür wurde geöffnet.
Aber sie wurde so langsam geöffnet, so verstohlen, als wäre es ein verbotener Akt.
Mir lief ein Schauder über den Rücken.
Was geht hier vor?
Als die graue Fläche groß genug war, schlüpfte eine schwarze Gestalt hindurch. Die Gestalt trug einen Pferdeschwanz.
Einen Augenblick später begann sich die graue Fläche zu verkleinern. Dann war sie verschwunden.
Plötzlich musste ich lächeln.
Natürlich!
Das Mädchen war heimlich aus dem Haus gegangen. Wahrscheinlich hatte sie sich herausgeschlichen, nachdem ihre Eltern ins Bett gegangen waren, vielleicht um sich mit ihrem Freund zu treffen, und ich war Zeuge ihrer Rückkehr geworden.
Das raffinierte kleine Ding!
Beinahe hätte ich gelacht. Mir fiel nicht nur ein Stein vom Herzen, ich war auch beeindruckt von ihrem Mut.
Von meinem Platz am Rand der Hecke beobachtete ich weiter das Haus. Alle Fenster blieben dunkel. Das passte ins Bild. Nachdem sie sich so vorsichtig hineingeschlichen hatte, würde sie bestimmt nicht durchs Haus rennen und die Lampen anschalten. Nein, sie würde im Dunkeln weitergehen.
Wahrscheinlich hatte sie in der Diele die Schuhe ausgezogen. In der einen Hand trug sie die Schuhe, mit der anderen tastete sie sich am Geländer entlang lautlos die Treppe hinauf.
Ich kannte die Prozedur; ich hatte es als Jugendlicher selbst so gemacht. Ich wusste, dass sie sich sehr langsam bewegte, aus Angst, eine Diele könnte unter ihren Füßen quietschen. Und ich kannte die Aufregung, die sie wahrscheinlich verspürte.
Ich wusste auch, dass sie schließlich eine Lampe anschalten würde.
Wenn sie sich geschickt anstellte, würde sie sich oben in ihr Zimmer schleichen und im Dunkeln ihre Kleidung ablegen. Einmal unbemerkt ins Haus gelangt, ist die Kleidung das Einzige, was einen verraten kann. Man muss sie ausziehen und den Pyjama oder das Nachthemd oder was immer man zum Schlafen trägt, anziehen, dann hat man es geschafft. Nun kann man ruhig das Licht in seinem Zimmer einschalten, ins Bad gehen und auch dort das Licht anmachen … Selbst wenn man gesehen wird, weiß niemand, dass man draußen war.
Während ich darauf wartete, dass ein Licht anging, fiel mir auf, dass ich auf das dritte Fenster im ersten Stock starrte.
Dämlich.
Das war nicht Hollys Wohnheim, sondern das Zuhause einer Fremden. Jedes der Fenster hätte zu dem Zimmer des Mädchens gehören können. Oder keines davon; ihre Fenster hätten auch zur Rückseite hinausgehen können. Ihr Zimmer könnte sogar im Erdgeschoss gelegen haben, auch wenn das eher unwahrscheinlich war; in den alten zweigeschossigen Häusern befanden sich die Schlaf- und Kinderzimmer fast immer oben.
Einige Minuten vergingen, doch hinter keinem der Fenster erschien Licht.
Mittlerweile hatte sie reichlich Zeit gehabt, in ihr Zimmer zu gelangen. Wahrscheinlich war sie schon dort und zog sich im Dunkeln aus. In meiner Vorstellung war es jedoch nicht völlig dunkel. Schwacher Mondschein drang durch das Fenster und beleuchtete sie, während sie ihr dunkles Sweatshirt auszog.
Aber in welchem Zimmer?, fragte ich mich. Hinter welchem Fenster?
Plötzlich wurde mir klar, dass ihr höchstwahrscheinlich eines der Zimmer gehörte, dessen Fenster sich direkt über der Veranda befanden. Drei Fenster blickten auf das Vordach hinaus. Es wäre ein Leichtes gewesen, aus einem dieser Fenster zu klettern, zum Rand des Verandadachs zu gehen, an einem der Stützpfosten zum Geländer hinunterzurutschen und dann auf den Rasen zu springen.
War sie auf diese Weise früher in der Nacht aus dem Haus gelangt?
Ich blickte zu den Fenstern über der Veranda. Zwei davon – oder auch alle drei – gehörten vermutlich zu ihrem Zimmer. Wahrscheinlich stand sie unmittelbar hinter einer der Glasscheiben … nah genug, um das spärliche Licht von außen zu nutzen.
Aber ich konnte sie nicht sehen.
Die Fenster wirkten wie Spiegel, die die dunkle Nacht und das Mondlicht reflektierten. Nur jemand, der auf dem Verandadach gestanden und das Gesicht an die Scheibe gedrückt hätte, wäre in der Lage gewesen hineinzublicken.
Ich stellte mir vor, dort oben zu sein.
Der Gedanke erregte und entsetzte mich zugleich.
Du machst wohl Witze.
Dann wurde mir mit einem Mal klar, dass ich schon ziemlich lange hinter der Hecke kauerte und das Haus beobachtete … fünf Minuten? Zehn? Und wenn mich jemand dort lauern gesehen und die Polizei gerufen hatte?
Ich möchte einen Voyeur melden.
Einen Spanner.
Verängstigt wirbelte ich herum, sprang auf und ging schnell davon. Jeden Moment könnte ein Nachbar nach mir rufen oder mich mit einer Waffe in der Hand aufhalten. Oder ein Streifenwagen könnte um die Ecke biegen und die Straße entlangrasen, um mich einzusacken.
Ich hatte das Bedürfnis, zu rennen und das Haus des Mädchens weit hinter mir zu lassen.
In Joggingklamotten wäre ich losgerannt. Aber ich trug Hemd und Jeans. Diese Kleidung hätte bei jedem, der mich durch die Nacht rennen sah, Verdacht erweckt. Also riss ich mich zusammen. Ich ging sogar etwas langsamer und gab mir größte Mühe, einen unbekümmerten Eindruck zu machen.
Ich spitzte tatsächlich die Lippen, um eine Melodie zu pfeifen, doch der gesunde Menschenverstand hielt mich davon ab.
Mit hämmerndem Herzen und ausgedörrtem Mund ging ich still weiter, während mir aus allen Poren der Schweiß brach.
Niemand rief nach mir. Niemand verfolgte mich. Und es kamen auch keine Autos angerast.
Schließlich erreichte ich das Ende des Häuserblocks. Ich überquerte die Franklin Street und folgte einer Seitenstraße nach Westen, bis ich wieder auf die Division Street gelangte. Äußerst erleichtert, davongekommen zu sein, ging ich zwei oder drei Blocks nach Norden, ehe ich mich wieder an die Fahrradhexe erinnerte.
Ein Schauder lief über meinen heißen, verschwitzten Rücken, und meine Nackenhaare stellten sich auf.
Ich wirbelte herum und sah hinter mich.
Keine Spur von ihr. Natürlich nicht.
Ich ging weiter und kam mir ein wenig albern vor, weil ich mir überhaupt von ihr Angst hatte einjagen lassen.
Andererseits war ich auch froh darüber. Den Umweg über die Franklin Street hatte ich nur eingeschlagen, weil ich ihr aus dem Weg gehen wollte. Wenn ich das nicht getan hätte, wären das Mädchen und ich zwei Blocks entfernt aneinander vorbeigegangen und uns nie nahe gekommen.
Eine Weile spielte ich mit der Idee, es sollte so sein, dass ich vor der Hexe floh und das Mädchen fand. (Mitten in der Nacht kommen mir oft seltsame Gedanken.) Vielleicht hatten die Mächte des Guten oder des Bösen der Hexe einen Auftrag erteilt: Erschreck Ed Logan zu Tode, so dass er hinüber zur Franklin Street läuft …
Unwahrscheinlich.
Aber ich hatte gefürchtet, sie würde mich im Vorüberfahren mit einem verdorrten Finger berühren und mit einem Fluch belegen. Deshalb war ich geflohen. Und vielleicht war ich, indem ich vor einer harmlosen, leicht verrückten alten Schachtel geflüchtet war, an eine Art von Fluch geraten, den ich niemals erwartet hatte.
Fluch oder Segen.
Während ich die Division Street zu Dandi Donuts entlangging, fühlte ich mich verflucht und gesegnet … und verzaubert. Nicht von der Fahrradhexe, sondern von einem gewissen geheimnisvollen Mädchen, das den Bürgersteig und seine Geheimnisse mit mir geteilt hatte, unbemerkt im Schutz der Nacht von mir beobachtet.
5
Schon aus mehr als einem Block Entfernung konnte ich den trüben Schein aus den großen Fenstern von Dandi Donuts über dem Bürgersteig schweben sehen.
Wohnhäuser gab es hier keine mehr. Beide Seiten der Straße waren mit Geschäften gesäumt: ein Imbiss, ein Friseursalon, eine Tankstelle, ein italienisches Restaurant namens Louie’s, ein Blumengeschäft, ein Secondhandladen. Alle waren geschlossen. In den meisten Geschäften war es dunkel, doch einige waren auch beleuchtet.
Das Schaufenster des Secondhandladens zum Beispiel. Dort standen im schummrigen Licht zwei armselige Schaufensterpuppen, von deren Gesichtern die verblasste Farbe abblätterte. Sie waren in seltsamen Posen eingefroren und blickten grundlos fröhlich.
Der dünne flotte Mann mit staubigem Zylinder und Frack versuchte, Clark Gable zu imitieren, aber eine Seite seines Schnurrbarts fehlte. Seine Freundin, deren rote Perücke etwas schief saß, trug ein mit roten Pailletten besetztes Kleid wie ein modisches Mädchen aus den stürmischen Zwanzigerjahren. Die ursprüngliche Besitzerin des Kleids hatte sich wahrscheinlich mittlerweile genauso aufgelöst wie die zweite Hälfte von Clarks Schnurrbart.
Als ziemlich regelmäßiger Kunde von Dandi Donuts hatte ich den Secondhandladen schon früh in meinem ersten Jahr an der Uni entdeckt. Am Anfang hatten mich die ramponierten Schaufensterpuppen und ihre altmodische Kleidung amüsiert. Es hatte mir auch Spaß gemacht, die anderen im Fenster ausgestellten Dinge zu betrachten: altes Geschirr, Vasen, Schellackplatten und ein paar gerahmte Bilder. Aber dann, als ich eines Nachts allein zu Dandi Donuts gegangen war, war ich länger als gewöhnlich vor dem Fenster stehen geblieben. Damals hatte ich festgestellt, dass die Puppen, Kleider und eigentlich auch alles andere in dem Fenster Relikte des Todes waren.
Ihr Anblick machte mich beklommen und niedergeschlagen.
Bei meinem nächsten Ausflug zu Dandi Donuts ging ich auf der anderen Straßenseite und sah nicht hin, als ich an dem Laden vorbeikam. Aber ich wusste trotzdem, dass er dort war.
Danach mied ich den Donutshop. Eigentlich hatte ich vorgehabt, mich für immer davon fernzuhalten, aber in einer warmen Nacht im Spätfrühling des letzten Jahres gingen Holly und ich spazieren. Wir waren eine sehr lange Strecke gelaufen, und ich hatte nur Augen für Holly, nicht für die Umgebung. Wir hielten uns an den Händen. Plötzlich blieb sie stehen. Und ich auch. Vor dem Fenster des Secondhandladens.
»Wow«, sagte sie. »Guck dir das Zeug an.«
Ich sah hin. Mit Holly an meiner Seite berührte mich die düstere Stimmung aus irgendeinem Grund nicht. »Clark Gable«, sagte ich.
»Sieht aus, als wäre die Hälfte seines Schnurrbarts vom Winde verweht!«
Ich lachte.
»Soll das da Scarlet darstellen?«, fragte sie.
»Wohl eher Zelda Fitzgerald, glaub ich.«
»Aber es muss Scarlet sein. Das rote Haar.«
»Tja, vielleicht.«
»Wenn du möchtest, dass es Zelda ist …«
»Nein, schon in Ordnung.«
»Fitzgerald hat über seine Frau geschrieben, stimmt’s?«
»Ich glaub schon. Ich meine, sie taucht in Zärtlich ist die Nacht auf. Aber er hat sie nicht Zelda genannt.«
Holly drehte sich zu mir und legte die Arme um mich, so wie sie es oft tat. Sie zog mich nicht an sich, sondern lehnte sich nur leicht gegen mich, so dass ich ihre Brüste spüren konnte, als sie den Kopf in den Nacken legte und mir in die Augen sah. »Werde ich irgendwann in einem deiner Bücher vorkommen?«
»Natürlich.« Es brachte mich immer in Verlegenheit und erregte mich, wenn sie davon sprach, dass ich ein Schriftsteller sein würde – als glaubte sie, dass es tatsächlich geschehen könnte.
»Aber benutz meinen richtigen Namen, ja? Findest du nicht auch, dass Holly ein guter Name für mich in einem Roman wäre?«
Ich nickte. Mit einem anderen Namen konnte ich sie mir gar nicht vorstellen.
»Wenn du erfolgreich und berühmt bist«, sagte sie, »zeige ich das Buch meinen Kindern und erzähl ihnen von den alten Zeiten mit dir.«
»Du meinst unsere Kinder?« Ich wusste, dass sie nicht unsere Kinder gemeint hatte, aber ich fühlte mich gezwungen nachzufragen.
Sie blickte mich zärtlich und mit ernstem Gesichtsausdruck an und sagte: »Du hast etwas Besseres verdient als mich.«
»Was?« Ich hatte sie sehr gut verstanden.
»Du wirst eine andere finden, jemanden, der schöner und schlauer ist und …«
»Ich will aber keine andere.«
»Das glaubst du nur.«
»Ich liebe dich, Holly.«
»Du liebst deine Vorstellung von mir.«
»Was meinst du damit?«
»Vielleicht bin ich nicht die, für die du mich hältst.«
»Wer bist du dann?«
Mit einem sanften Lächeln schmiegte sie sich an mich und zitierte Emily Dickinson: »Ich bin Niemand! Wer bist du?«
»Du bist kein Niemand. Du bist Holly Johnson, und ich liebe alles an dir.«
»Erinnere dich einfach an meinen Namen, Liebster, wenn es so weit ist, dass du über mich schreibst.«
Meine Kehle schnürte sich zusammen, aber es gelang mir zu sagen: »Ich werde deinen Namen niemals vergessen. Aber wenn du mich verlässt und weggehst, wie soll ich dann wissen, wohin ich dein Exemplar schicken soll?«
»Ich verlasse dich nicht. Du wirst mich verlassen. Aber mach dir keine Sorgen, du brauchst mir nichts zu schicken. Ich werde alle deine Bücher lesen und dein größter Fan sein.«
Dann küssten wir uns vor dem Schaufenster des Secondhandladens, während Rhett und Scarlet (oder Zelda) uns angafften. Ich hatte das Gefühl, etwas in mir wäre zerbrochen. Doch danach gingen wir in den Donutshop, und Holly benahm sich, als wäre nichts Schlimmes vorgefallen. Wir aßen Donuts und gingen anschließend in einen Park, wo wir unter den Bäumen miteinander schliefen, und alles war süßer, erregender und intensiver als je zuvor.
An all das erinnerte ich mich, während ich vor dem Schaufenster stand und zum ersten Mal, seit Holly mich abserviert hatte, die Puppen ansah.
Ich verlasse dich niemals, hatte sie gesagt, du wirst mich verlassen.
Ja, klar.
Miststück, dachte ich.
Und dann dachte ich noch schlimmere Dinge.
Die zerfledderten Schaufensterpuppen grinsten mich durch die Scheibe an. Sie sahen genauso aus wie in der Nacht, als ich mit Holly dort gestanden hatte. Für sie hatte sich nichts verändert. Die Glücklichen.
Ich hätte niemals hierherkommen sollen, dachte ich. Nach Norden zu gehen war ein Fehler gewesen.
Aber alle anderen Richtungen wären auch nicht besser gewesen. Es gab fast keinen Platz, an den ich hätte gehen können, wo ich nicht schon mit Holly war, als wir noch zusammen waren. Ein Ort war genauso schlimm wie der andere, vermutete ich.
Und im Norden gab es wenigstens Donuts.
Ich ging durch den trüben Lichtschein aus dem Dandi Donuts und blickte in den Laden hinein. Jemand stand an der Theke und kaufte etwas. Die Auswahl in der Auslage war spärlich, aber ich entdeckte ein paar klassische Donuts. Einige hatten einen Schokoladenguss. Bei den anderen konnte ich nicht erkennen, ob sie glasiert waren oder nicht. Ich öffnete die Tür und tauchte ein in die warmen, süßen Düfte, die ich so gut kannte.
Der Angestellte – jemand, der letztes Jahr noch nicht dort gearbeitet hatte – gab dem Kunden gerade das Wechselgeld.
Ich ging zur Theke und beugte mich darüber.
Drei der klassischen Donuts waren glasiert. Sie sahen knusprig und lecker aus. Ich entschied mich, alle drei zu kaufen; zwei würde ich für Eileen verwahren und einen gleich hier zu einer heißen Tasse Kaffee verspeisen.
Nach so einem langen Marsch hatte ich zwei Donuts verdient.
Welchen sollte ich noch nehmen? Einen mit Schokoladenguss? Einen mit Ahornsirup? Oder einen dieser dicken, mit Zucker bestreuten Donuts, die mit Marmelade gefüllt waren?
Es gab so viele Möglichkeiten.
Die meisten Donuts sahen köstlich aus.
Hinter mir erklang eine vertraute Stimme. »Hey, Eddie. So ein Zufall.«
6
Ich richtete mich auf, drehte mich um und entdeckte Eileen, die mir von einem Ecktisch aus zuwinkte. Sie war allein. Vor ihr auf dem Tisch stand ein Styroporbecher mit Kaffee, und auf einer Serviette lag ein halber Donut.
Sie war hierhergekommen!
Lächelnd und kopfschüttelnd ging ich zu ihr.
»Los, hol dir was«, sagte sie. »Ich lauf nicht weg.«
»Ich dachte, ich sollte dir Donuts mitbringen.«
»Ich hab es mir anders überlegt.«
»Also … willst du deine Bestellung stornieren?«
»Ich glaube schon. Ich habe schon anderthalb im Magen.«
»Soll ich dir was anderes mitbringen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Geh einfach und kauf dir was.«
Ich ging zurück zur Theke, bestellte einen Kaffee und zwei glasierte klassische Donuts, bezahlte und ging mit den Sachen wieder zu Eileens Tisch.
So wie sie dort saß und mich beobachtete, sah sie sehr hübsch und munter aus. Ihr dunkelbraunes Haar hing offen herab und bedeckte die Schultern. Sie hatte den Pullover und den Faltenrock, die sie vorhin getragen hatte, gegen eine Jeans und ein helles kariertes Hemd getauscht. Unter ihrem Hals war ein Dreieck nackter Haut. Die Knöpfe des Hemds standen fast bis zur Mitte auf. Es hing leicht schief, und der Schlitz war breit genug, um den Rand ihres BHs sehen zu können.
Als ich mich ihr gegenüber hinsetzte, sagte sie: »Ich habe mich entschieden, doch eine Nervensäge zu sein.«
»Du bist keine Nervensäge.«
»Du wolltest alleine sein.«
»Ist schon okay. Ich bin froh, dass du hier bist.« Das war zumindest keine richtige Lüge.
Sie strahlte. »Wirklich?«
»Klar.«
»Ich wollte nur … also, es ist ein verdammt langer Marsch bis hierher. Da dachte ich, ich gebe dir einfach einen ordentlichen Vorsprung, fahre dann hier raus und biete dir wenigstens an, dich nach Hause zu fahren. Für den Fall, dass zehn Kilometer dir für eine Nacht genug sind.«
»Wie lange hast du gewartet?«, fragte ich.
»Ehe ich losgefahren bin?« Sie zuckte mit den Schultern. »Ungefähr eineinhalb Stunden. Ich hab mir den Wecker gestellt und ein kleines Nickerchen gemacht. Ich dachte, ich würde dich auf dem Weg einholen. Als ich dich dann nicht gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, dass du schon hier bist. Das war wohl ein Irrtum. Spielt aber keine Rolle. Es hat mir nichts ausgemacht zu warten.«
»Ich bin sozusagen einen Umweg gegangen.« »Das dachte ich mir.«
Es schien ihr gleichgültig zu sein. Offenbar war sie einfach froh, dass ich nun bei ihr war.
»Du hast dir reichlich Mühe gemacht.«
»Ach, das war doch nichts.«
»Es war eine ganze Menge.«
»Tja … kein Problem. Ich schaffe mein Zehn-Uhr-Seminar. Was ist mit dir?«
»Ich muss erst um eins zur Uni.«
»Du Glückspilz.«
Ich musste grinsen und probierte einen der Donuts. Meine Zähne brachen durch die Kruste und gruben sich in den saftigen Teig. Die Süße füllte meinen Mund.
»Was hast du denn um eins?«, fragte Eileen.
Ich schluckte ein Stück Donut. »Ein Shakespeare-Seminar.«
»Ah. Mit der Haarsträubenden Hillary Hatchens.« Ich lachte. »Genau.«
»Ich hatte sie letztes Jahr. Schrecklich.«
Eileen war ein Jahr älter als ich, also auch ein Jahr älter als Holly. Sie hatte voriges Jahr im Wohnheim das Zimmer mit Holly geteilt. Nun war sie im letzten Studienjahr und hatte wie ich Englisch als Hauptfach.
Hollys Hauptfach war Psychologie gewesen. Eigentlich kein Wunder. Jeder weiß, dass Psychologie kaputte Typen anzieht.
»Falls du es noch nicht bemerkt hast, Hatchens hasst Männer.«
»Ist mir auch schon aufgefallen.«
»Bestimmt wurde sie mal von einem Kerl sitzengelassen.«
»Es gibt vermutlich niemanden, der sie nicht loswerden will.«
»Obwohl sie eigentlich ziemlich süß ist, oder?«
»Süß, aber beängstigend.«
Eileen nickte grinsend. »Man kann sich kaum vorstellen, dass ein Mann sich traut, sie anzusprechen und zu fragen, ob sie mit ihm ausgeht. Sie mag mich, und ich hab trotzdem Angst vor ihr.«
Ich nippte an meinem Kaffee, aß noch etwas von meinem Donut und nickte hin und wieder, während Eileen fortfuhr.
»Jedenfalls habe ich letztes Jahr ziemlich gute Noten bekommen. Ich habe alle Klausuren aufbewahrt, die ich bei ihr geschrieben hab. Du kannst sie gerne ausleihen. Ich würde dich auch meine Hausarbeit benutzen lassen, aber das würde sie bestimmt spitzkriegen. Sie ist eine Zicke, aber nicht blöd.« Lächelnd fügte Eileen hinzu: »Trotzdem glaub ich, dass sie nicht so schlau ist, wie sie denkt. Wie auch? Niemand ist so schlau.«
Das brachte mich zum Lachen. Es fühlte sich gut an.
Doch während ich mich über ihren Seitenhieb gegen Dr. Hatchens amüsierte, fragte ich mich, was mit Eileen los war. War sie mitten in der Nacht die ganze Strecke hier hinausgefahren, nur um mich aufzuheitern? Oder wollte sie etwas mit mir anfangen?
Letztes Jahr war sie mir wie eine ältere Schwester von Holly vorgekommen. (In der Studentenverbindung war sie ja auch sozusagen ihre Schwester.) Sie war immer sehr nett zu mir gewesen, aber nur, weil sie fand, dass ich ein guter Freund für Holly wäre.
Das hatte ich jedenfalls gedacht.
Vielleicht hatte ich mich getäuscht.
Oder vielleicht war es letztes Jahr so gewesen. Jetzt war Holly von der Bildfläche verschwunden. Vielleicht spekulierte Eileen darauf, ihren Platz einzunehmen.
Schwer vorstellbar, warum sie das wollen sollte. Ich war nicht gerade ein Hauptgewinn. Sie war viel zu hübsch, um sich für einen Typen wie mich zu interessieren.
Nachdem sie mich eine Weile meinen Kaffee trinken und essen gelassen hatte, sagte Eileen: »Und, wie war dein Spaziergang?«
»Nicht schlecht. Es war gut, aus der Wohnung rauszukommen. Und es hat mir geholfen, mal an was anderes zu denken als an …« Ich konnte mich nicht überwinden, den Namen auszusprechen.
»La belle dame sans merci?«, schlug Eileen vor.
»So kann man es ausdrücken. Mir würde eine andere Bezeichnung einfallen. Aber die ist nicht jugendfrei.«
Eileen lachte ein wenig traurig.
»Die kann mich am Arsch lecken«, sagte ich.
»Etwas gewählter, bitte.«
»Okay. Sie kann mich im Arsche lecken.«
Jetzt lachte Eileen noch mehr, dann schüttelte sie den Kopf. »Es ist so schrecklich. Und es tut mir so leid.«
»So läuft das eben.«
»Ich kenne das.«
Ich nickte. Mir war klar, dass sie ihre eigenen Erfahrungen gemacht hatte. Während meines ersten Jahrs in Willmington hatte ich Eileen ziemlich oft auf dem Campus gesehen. Ich wusste, wer sie war, dass sie Englisch als Hauptfach hatte und ein Jahr über mir war, und ich hatte gehört, dass sie mit ihrem Freund von der Highschool verlobt war. Ihr Verlobter wohnte allerdings nicht auf dem Campus. Er studierte an der University of California in Berkeley … mit dem Auto brauchte man von Willmington aus ungefähr zwei Tage. Irgendwann bevor Holly und ich zusammenkamen, hatte der Typ Eileen den Laufpass gegeben. Danach sah man sie mit vielen verschiedenen Männern, aber mit keinem besonders lange.
»Vielleicht sind wir beide so besser dran«, sagte sie.
»Ich weiß nicht.«
»Es ist nur blöd, dass diese Sachen immer so übel enden.«
»Ich hab das Gefühl, alles endet so.«
»Ach, ich weiß nicht.« Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Ich war immer sehr froh, wenn das Shakespeare-Seminar zu Ende ging, aber die Haarsträubende Hillary Hatchens …«
»Das ist ein bisschen was anderes.«
»Ich weiß. Du hast die guten Sachen gemeint. Beziehungen und so.«
»Ja.«
»Ich habe von Leuten gehört, die hinterher Freunde geblieben sind.«
»Das ist Blödsinn«, sagte ich. »Wie können sie Freunde bleiben? Wenn sie sich lieben und der eine dem anderen in den Rücken sticht … ich glaub das nicht. Der Stecher will vielleicht die Freundschaft aufrechterhalten, aber nicht der Gestochene.«
Eileen lachte leise. »Da ich selber eine Gestochene bin, muss ich dir wohl zustimmen. Mein Hauptgefühl für Warren ist Hass. Aber ich mag solche Gefühle nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Und ich hasse die Vorstellung, du würdest Holly hassen.«
»Verstehe.«
Ich aß meinen zweiten Donut. Wenn auch ohne besonderen Genuss.
Ebenso wenig genoss ich es, über Holly und zerbrochene Beziehungen zu reden.
Als ich meinen Kaffee austrank, sagte Eileen: »Also, was meinst du? Möchtest du mit mir zurückfahren? Oder willst du die zehn endlos langen Kilometer zu deiner Wohnung lieber wandern?«
Die Frage überraschte mich nicht gerade.
Bis ich Eileen im Dandi Donuts getroffen hatte, war ich davon ausgegangen, zurückzulaufen … mit einem Umweg über die Franklin Street, um noch einen Blick auf das Haus des geheimnisvollen Mädchens zu werfen.
Ich wollte wirklich nochmal bei dem Haus vorbeischauen, vor allem wegen der Möglichkeit, das Mädchen wiederzusehen.
Ich wollte sie dringend wiedersehen.
Aber ich konnte Eileen nicht zurückweisen. Ihr Angebot, mich nach Hause zu fahren, war ein unliebsames Geschenk, doch ich brachte es nicht übers Herz, es abzulehnen.
»Ich würde gern mit dir zurückfahren«, sagte ich.
Als ich ihren Gesichtsausdruck sah, war ich froh, das Angebot angenommen zu haben.
Wir standen auf. »Möchtest du noch Donuts für unterwegs?«, fragte ich.
»Nein, bloß nicht. Sonst verwandle ich mich in eine Tonne.«
Draußen bogen wir um eine Ecke. Kein Mensch war in der Nähe. Die Luft hatte einen seltsam feuchten Geruch angenommen, so wie sie es nur in den Stunden nach Mitternacht tat. Ich hörte das Rattern eines Einkaufswagens, aber es kam von weit her.
Eileens Auto stand nicht direkt an der Division Street, deshalb hatte ich es auf dem Weg zum Donutshop nicht gesehen.
Sie hatte es nicht abgeschlossen.
Wir schnallten uns an, und sie startete den Motor. Als sie losfuhr, sagte ich: »Das ist auf jeden Fall angenehmer als Laufen.«
»Stets zu Diensten, Sir.«
Es ist besser so, sagte ich mir. Zum Haus des Mädchens zurückzukehren und einen weiteren Blick zu riskieren, wäre eine sehr schlechte Idee gewesen.
Tue dir einen Gefallen und vergiss sie einfach.
Eileen fuhr einmal um den Block, stieß wieder auf die Division Street und bog links ab.
»Bist du hier langgekommen?«, fragte sie.
»Ich bin rüber zur Franklin gegangen. Hier waren mir zu viele Leute mit ihren Hunden unterwegs und so.«
»Vielleicht hast du deshalb so lange gebraucht.«
»Ich bin eine Menge Umwege gelaufen.«
»Hast du was Interessantes gesehen?«
»Eigentlich nicht. Nur reichlich dunkle Häuser.«
»Es ist seltsam, zu dieser Zeit unterwegs zu sein«, sagte Eileen. »Alles ist so still. Es ist fast, als wären wir die einzigen Menschen auf der Erde.«
»Stimmt«, sagte ich.
Dann sah ich jemanden den Bürgersteig auf der rechten Seite der Straße entlanggehen. Ein Mädchen in dunklem Sweatshirt und dunkler Hose. Sie schritt zügig und mit federndem Gang voran, ihre Arme schwangen hin und her, der Pferdeschwanz hüpfte hinter ihrem Kopf auf und ab.
Mein geheimnisvolles Mädchen.
Sie ist wieder unterwegs?
Offenbar.
Als wir an ihr vorbeifuhren, wandte ich den Kopf, um sie von vorne zu sehen.
»Was ist da?«, fragte Eileen.
Ich blickte ungezwungen nach vorne und sagte: »Es läuft nur jemand vorbei.«
»Vielleicht ein anderer Donutjäger«, meinte Eileen.
»Könnte sein.«
7
»Wohnst du noch in der Church Street?«, fragte sie.
»Ja.«
Letztes Jahr war Eileen aus dem einen oder anderen Grund öfter dort gewesen, was aber immer mit Holly zu tun gehabt hatte. Sie hatte Holly häufig bei mir abgesetzt oder sie abgeholt. Bei verschiedenen Gelegenheiten hatten wir uns auch in kleiner Runde getroffen.