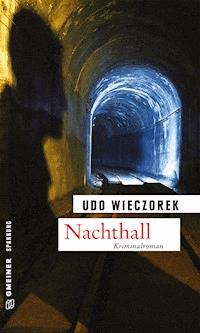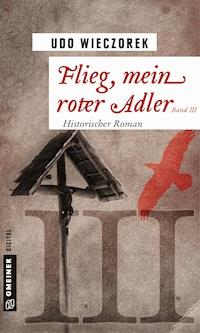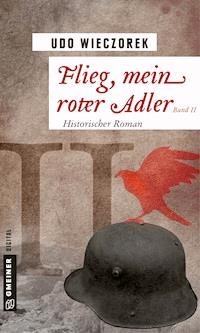Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Flieg, mein roter Adler
- Sprache: Deutsch
Erster Weltkrieg: Vinzenz und Josef, einst beste Freunde, stehen sich auf gegnerischen Seiten gegenüber. Aufgewachsen in einem Tiroler Bergdorf wurden sie getrennt, als Josefs Mutter einen italienischen Grafen heiratete. Doch Josefs schönes neues Leben birgt auch Schattenseiten. Im Dunkeln verborgen entspinnt sich gegen ihn und seine Familie die tödliche Intrige eines mächtigen Gegners. Umgeben von den majestätischen Alpen, getrieben vom Grauen des Krieges müssen sich die ehemaligen Freunde entscheiden, welchen Weg sie wählen. Eine falsche Entscheidung könnte ihr Ende bedeuten. Teil eins des dreiteiligen Historienromans.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Udo Wieczorek
Flieg, mein roter Adler
Band I
Historischer Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-digital.de
Gmeiner Digital
Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlagbild: Collage unter Verwendung von: © fakegraphic – Fotolia.com, © love1990 0 Fotolia.com, ©don limpio / photocase.com
Umschlaggestaltung: Simone Hölsch
ISBN 978-3-7349-9336-7
Widmung
In einem schrecklichen Krieg zwischen grünen Hängen, schroffen Wänden und Gletschereis haben einst Tausende junger und alter Menschen selbstlos ihr Leben gegeben. So paradox es auch anmutet, kämpften sie auf beiden Seiten in derselben Absicht; erbittert und grausam für Gott, ihren König und Kaiser und ihr geliebtes Vaterland.
In unserer heutigen Welt, die von völlig anderen Werten geprägt ist, scheint jene bedingungslose Aufopferung nicht mehr nachvollziehbar. Doch in diesen kargen, vergangenen Tagen der Not waren gerade diese Grundfesten des Lebens alles, was die Menschen besaßen, woran sie glauben konnten.
Zwischen Selbstverwirklichung und unserer inneren Einsamkeit fehlt es uns längst an der notwendigen Zeit und dem geistigen Raum, um dieses einst so starke Zugehörigkeitsgefühl und jene rücksichtslose Bescheidenheit, ja Selbstaufgabe, begreifen zu können. Das Leid der Menschen, welche diesen Krieg über- und durchlebt haben, ist für immer und ungeteilt in der Tiefe der Geschichte versunken. Nicht aber das mahnende Wissen darüber.
Dieses Buch ist all jenen gewidmet, die ihr einsames Grab in den Bergen ihrer Heimat gefunden haben. In den Bergen, die wir heute so lieben, die auch sie einst geliebt haben.
Diese Zeilen gehören jenen, an die sich niemand mehr erinnert.
Das Davor
Es war ein verregneter Tag, als ich einsam über das Hochplateau ging. Zwischen den mächtigen Felstrümmern, welche vor Urzeiten mit ohrenbetäubendem Krachen von den hohen Gipfeln herabgepoltert sein mussten, lag ein grauer Dunstschleier. Schon vor Stunden hatte der Regen eingesetzt und verlieh den Bergen ein bedrohliches, abweisendes Antlitz. Alles troff vor Nässe; die Nordostwand der Croda, die spärlichen Lärchen und Zirben, das harte Gras und nicht zuletzt ich selbst.
Dort, wo ich ging, gab es keinen Weg, um an irgendeiner Hütte anzukommen und sich in der warmen Gaststube aufzuwärmen. Das aber stand von vornherein auch nicht in meiner Absicht. Ich war allein, zeitlos und wollte es auch sein.
Die Gegend kannte ich nur aus der Wanderkarte, zumindest bis zu diesem Morgen. Angesichts des miserablen Wetters stellte ich mir mehrmals die Frage, weshalb ich mich für jene Reise in die Dolomiten entschieden hatte und nicht stattdessen ans Meer gefahren war. Warum wählte ich gerade dieses enge Tal? Aus welchem Grund stolperte ich heute so gedankenversunken über diese unwirkliche Ebene?
Es gab keine Antwort auf meine Fragen. Und heute, nach all der Zeit, weiß ich nicht einmal mehr genau, wann mich jenes seltsame, unheimliche Gefühl zu beschleichen begann, schon einmal hier gewesen zu sein. Für meine fehlende Ortskenntnis in diesem Gelände wohnte meinem Gang zu viel Zielstrebigkeit inne. Es gab manches auf der unbekannten Hochfläche, was mir seltsam vertraut vorkam. Anfangs tat ich es noch als eine zufällige Ähnlichkeit des Geländes ab und suchte nach dem passenden Gegenstück in den heimischen Bergen, das ich irgendwann, vielleicht vor Jahren schon, bewandert und wieder vergessen hatte. Doch so sehr ich auch in meinen Erinnerungen stöberte, ein passendes Pendant wollte sich nicht finden lassen. Ich wurde stutzig und fing an, mich über mich selbst zu wundern. Es war nicht mehr zu leugnen. Ohne eigenes Zutun manifestierten sich in meinem Gehirn vage Denkanstöße zu beinahe konkreten Erinnerungen. Jeder Felsen, an dem ich vorüberging, jeder Ausblick, den der Hochnebel freigab, lösten in mir kurze, beängstigende Déjà-vus aus. Fast schien es mir, als drängte sich eine unerklärliche Ahnung mit jedem Schritt, den ich tat, stärker in meinen Geist, um sich, mit dem Ziel, aus Visionen unumstößliches Wissen zu formen, Raum in meinem Denken zu verschaffen. Obwohl ich wusste, dass niemand in der Nähe sein konnte, ging ich etwas schneller und drehte mich, wie ein gehetztes Tier, nach allen Seiten um. Mir war, als begleitete mich jemand still und unsichtbar. Ich versuchte es zu verdrängen und zwang mich mit aller Kraft dazu, an etwas anderes zu denken. Es gelang mir jedoch nur kurz. Nach einer Weile verlangsamte ich meinen Schritt und blieb keuchend stehen, den Blick starr auf den Boden gerichtet. Was um Himmels willen hatte mich nur überkommen? Woher stammten diese Erinnerungen? Ein versteckter Hinweis, ein kleiner Fingerzeig, wenn er auch noch so unscheinbar gewesen wäre, hätte mir genügt. Wer aber sollte ihn mir hier oben in dieser grenzenlosen Stille geben, wenn ich selbst schon die Einsamkeit suchte?
Vielleicht hatte es etwas mit diesem Traum, oder besser mit den unzähligen Träumen zu tun, die mich seit Jahren verfolgten. Böse Träume, fürchterliche Szenerien, die sich jedes Mal länger und intensiver aneinanderreihten um, so deutete ich es in meiner Unwissenheit, irgendwann ein Ganzes zu geben. Bis zu diesem Tag auf der Hochfläche verdrängte ich die Gedanken an das Wirrwarr, das die Träume an so vielen Morgen in mir hinterlassen hatten, ohne auch nur zu ahnen, was mir bald widerfahren sollte. Dabei stand ich so dicht vor jenem Ort, an dem für mich alles beginnen und enden würde.
Mein Puls hatte sich beruhigt. Ich verweilte ein paar Augenblicke, stieß den Atem in langen Stößen kondensierend in den Nebel und wartete ab, was geschah. Für einen Moment war es ganz still um mich. Keine Böe wehte um meinen Kopf und zerrte an meiner Kapuze, kein Vogel zwitscherte.
Jetzt wird es wohl vorüber sein, suggerierte ich mir ein. Und in der Tat vermittelte mir die Ruhe, die sich um mich legte, einen Hauch von Geborgenheit. Die eben noch so tief sitzende Angst, auf etwas zu stoßen, das mein Leben verändern könnte, verflüchtigte sich langsam und verließ mich ebenso wie der Nebel, der sich allmählich vom Hochplateau löste und nach oben zog. Ich blickte um mich. Dominant stieg vor mir die Südwand der Croda in den Himmel und verlor sich im Weiß des Nebels, der sich langsam mit den Wolken vereinte. Ich legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Es hatte endlich aufgehört zu regnen. Ich nahm die Kapuze ab und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Außer dem noch immer nicht vollständig freigegebenen Ausblick auf die Nordwände hatte jener Ort offenbar nichts Besonderes an sich. Zumindest nicht bis zu jenem Moment, als meine Augen auf einem Stück Metall haften blieben.
Ein verrostetes Gedenkkreuz lag verbogen, halb vom Geröll verschluckt, ebenso einsam und verloren in der Weite dieser bizarren Landschaft, wie ich selbst in diesem Moment dort stand. Die Gedanken, welche mir urplötzlich durch den Kopf schossen, jagten mir eine Gänsehaut über den Rücken. Sollte dies das Kreuz sein, welches ich schon so oft im Traum vor Augen gehabt hatte? Lag dort vor mir wirklich das letzte Zeugnis jenes armen Menschen, der mich, ausgerechnet mich, auf sein Schicksal aufmerksam machen wollte, welches bereits mehr als achtzig Jahre zurücklag? War ich tatsächlich am Ziel? Hatte es sich hier ereignet? Oder bildete ich mir nur schon eine erlösende Geschichte um ein verwittertes altes Kreuz ein, die es nicht gab, vielleicht nie gegeben hatte? Ich ging näher heran, bekreuzigte mich und strich über den rauen, nassen Rost. Es fühlte sich kalt an. Die Millionen kleiner Felsstückchen, die Jahr für Jahr die Wand herabgestürzt und über das Metall gerieselt waren, hatten von der Inschrift auf der zerbeulten Blechtafel nichts übrig gelassen. Nur die Vertiefungen der offenbar mit einfachsten Mitteln ausgeführten Stanzarbeit konnte man noch erkennen. Andächtig ließ ich meine Finger darüber gleiten und versank abermals in einem Stück erträumter und seltsam vertrauter Vergangenheit, während ich die wenigen Worte auf der Tafel leise vor mich hin sagte:
»Brugger Josef«, ein Kreuz, ein Datum und der Beginn eines Verses:
»Flieg, mein roter Adler …«
Unbehagen überkam mich. Was soeben mit mir passierte, wurde mir mehr und mehr unheimlich. Selbst die unleserlichen Buchstaben dieses Verses deckten sich mit dem, was ich aus meinen nächtlichen, trivialen Ausflügen in die Zeit um die Jahrhundertwende her kannte.
Ich wandte mich von dem Kruzifix ab und setzte mich ein paar Meter entfernt auf einen Stein. Die Nässe drang kalt auf meine Haut, doch ich spürte sie nicht. Mein Puls raste und meine Lunge schrie förmlich nach mehr Luft, als hätte ich eben einen Spurt über die Hochfläche hinter mich gebracht. Ich bückte mich zu einem kleinen Rinnsal hinunter, schöpfte mit der hohlen Hand ein wenig Wasser daraus und benetzte mir das glühende Gesicht. Respektvoll, als hätte ich Angst vor einer weiteren Erkenntnis, blickte ich zur Wand des Berges auf. Da stand sie, die mächtige, in unzählige Schluchten und Rinnen zerklüftete Wand der Croda. Der Nebel hatte sie für ein paar Minuten freigegeben und ganz oben, da thronte in fast dreitausend Metern Höhe der Gipfel. Jene einsame Spitze, von der dieses Kreuz herabgefallen sein musste; jener Ort, von dem auch meine Träume zu entspringen schienen.
Seit ich einigermaßen erwachsen denken konnte, wähnte ich mich, Realist zu sein, glaubte nur an das, was ich mit meinen einfachen menschlichen Sinnen wahrnehmen konnte, und fühlte mich als Teil dieser realen Welt, in der alles, ja selbst das kleinste Fragezeichen logisch erklärt werden konnte. Diese Welt gab mir jene trügerische Sicherheit, die mich bislang unbeschwert durchs Leben gehen ließ. Und eben jene Welt, mit all ihren so sicher geglaubten Grundfesten und Wertigkeiten brach in der Sekunde, in welcher ich die Inschrift auf dem Kreuz entziffert hatte, für immer in sich zusammen.
Ich kannte diesen Namen. Und ich wusste nur zu genau, was sich dort oben inmitten des Krieges ereignet hatte. Neben den vielen anderen Episoden, welche sich langsam zu einer Geschichte fügten, hatte ich es des Nachts in immer wiederkehrenden, erschreckend realen Träumen vor Augen gehabt. Wie aber konnte das möglich sein, hatte ich doch nie in meinem Leben auch nur einen Fuß in dieses Tal gesetzt? Gleichzeitig aber fand ich hier etwas vor, das versuchte, eine vage geträumte Vergangenheit mit der Gegenwart zu verknüpfen. Und jenes Puzzleteil, das ich hier zufällig, oder gerade eben nicht zufällig, gefunden hatte, fügte sich so perfekt in die anderen, dass es keinen Platz für den Zweifel an einer Schicksalsfügung ließ. Das erträumte Leben dieses Menschen musste mir fremd sein, und doch war es mir so vertraut wie mein eigenes, in das sich diese Geschichte soeben einzufügen begann. Trotzdem versuchte ich, mit aller Kraft zu verdrängen, was sich in den letzten Sekunden unabänderlich und brachial als Brücke in die Kluft zwischen meiner vermeintlichen Fantasie und der gelebten Realität zwängte. Obwohl ich wusste, dass ich eines Tages genau diese Brücke überschreiten würde, stand ich auf und ging.
Eile fand in meinen Tritt. Ich begann zu laufen; glaubte in meiner inneren Aufruhr nahezu panisch vor mir selbst und meinem vorbestimmten Schicksal flüchten zu können. Aber wollte ich das überhaupt?
Mein Schritt verlangsamte sich erst, als ich an den ersten Bäumen anlangte. Skeptisch richtete ich meinen Blick hinauf zu jener Stelle, an der das Kreuz liegen musste. Ich war erleichtert zu sehen, wie sich der Nebel wieder alles einverleibte. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Es war sinnlos, vor der Antwort auf die bohrenden Fragen davonzulaufen wie vor dem Angesicht des Teufels. Selbstzweifel überkamen mich. Hatte das eben tatsächlich stattgefunden? Niemand außer mir selbst konnte meine Frage beantworten. Ich verwünschte die in mir wachsende Gewissheit tausendfach in jene Zeit zurück, woher sie zu kommen schien. Wohl wissend, dass ich mich ihr früher oder später ergeben musste.
Ich kannte einen Namen, einen Vers und die markante Stelle unter der Wand. Als ich meine Finger betrachtete, auf deren Kuppen noch immer ein wenig der rostroten Farbe des oxidierten Metalls haftete, hatte ich meinen innerlichen Kampf verloren. So sehr ich meine Gedanken auch zu verleugnen versuchte; dort oben, unter den Abstürzen der großen Wand lag der Schlüssel zu der Pforte, die ich an jenem tristen Tage im Sommer 1993 einen winzigen Spalt aufgetan hatte. Und es gab sie tatsächlich, diese Pforte, welche mich noch viele Jahre danach magisch anzog, zu der ich drei Mal voller Ungewissheit und Respekt zurückkehren sollte, durch die ich dann doch eines Tages hindurchschritt und begann, mich selbst zu finden.
Das bittere Dahinter erzählt dieses Buch, das die Wahrheit unserer ach so realen Welt in sich trägt.
1. Der Entschluss
Vinzenz erwachte vom Regen, der ihm mit großen Tropfen kühl ins Gesicht schlug. Als sich seine Sinne wieder langsam zu ihm gesellten, spürte er die Nässe auf seiner Haut. Ihn fror entsetzlich, und mit dem ersten Versuch, sich aufzusetzen, irrten rasende Schmerzen durch seine Nervenbahnen, um sich schließlich in seinem rechten Oberschenkel zu einer kaum auszuhaltenden Marter zu konzentrieren.
Oh Gott, lass es nicht abgeschossen sein!, flehte er stumm in sich hinein. Vorsichtig hob er den Oberkörper an, um seinen ahnungsvollen Blick an sich hinabwandern zu lassen. Dann atmete er erleichtert auf und ließ sich mit verzerrtem Gesicht zurück auf die aufgeweichte Erde fallen.
»Es ist noch da«, hauchte er in die kühle Nacht.
Die Luft, die er einatmete, roch nach schwefeligen Explosionsgasen und hinterließ einen sauren, beißenden Geschmack in seinem Rachen. Als er einen seiner klebrig feuchten Finger an seine Zunge führte, schmeckte er Blut und das faulige Wasser des alten Kratertümpels, in dem er mit der einen Körperhälfte lag. Hoffend, ein Stück des alten vorgeschobenen Grabens oder nur einen kleinen trockenen Platz auszumachen, hob er vorsichtig den Kopf und stierte panisch in die alles umgebende Finsternis. Nie war er so einsam gewesen wie in diesem Moment; von allen verlassen, wahrscheinlich aufgegeben – für tot erklärt. Aber hatte er es nicht so gewollt? War es nicht seine Absicht gewesen, hier seinem Leben ein Ende zu setzen?
Ein Anflug von schlechtem Gewissen stieg in ihm auf, als er sich dabei ertappte, wieder diesen unterschwelligen Überlebenswillen in sich zu fühlen, ihn wahrzunehmen und ihn nicht im Keim ersticken zu wollen. War es nicht erst eine Woche her, dass er sich in einer ganz bestimmten Absicht hierher versetzen ließ? Was machte es dabei für einen Unterschied, in einem Trichter langsam dahinzusiechen und zu verbluten oder stattdessen von einer Kugel tödlich getroffen niederzusinken? Oder hing er am Ende noch mehr an seinem jungen Leben, als er dachte sich aufbürden zu müssen? Weshalb vermochte es diese an und in ihm zerrende Todessehnsucht aus Trauer und Schmerz nicht vollends, seinen fast erloschenen Lebensmut zu brechen?
Vinzenz’ Gedanken wurden wieder rationaler, schweiften vom Tod ab, kreisten vielmehr um das Wie und Wann. Bis zu jener einschneidenden Sekunde, als es ihm wie Schuppen von den Augen fiel:
Niemand weiß es! Keine Menschenseele ahnt auch nur, was ich, der Cronatzer Vinz, getan habe! Was ist mit der Bruggerin, dem Grafen? Haben sie in ihrem Schmerz nicht ein Recht auf die Wahrheit? Ist das, was ich hier tue, am Ende nur ein Akt von unverzeihlicher, egoistischer Feigheit?
Vinzenz geriet in innerliche Aufruhr und verfiel in eine Vorstellung, die für ihn schrecklicher war als seine Tat selbst. Seine Gedanken überschlugen sich und legten zuletzt die finale Frage wie ein Salzkorn in die offene Wunde seiner geschundenen Seele:
Wer sollte meine Schuld jemals vergeben können, wenn ich mich hier allein meinem Schicksal überlasse?
Vinzenz rang mit sich und der Gewissheit, die sich mehr und mehr in seinen Geist drängte.
»Nein«, hauchte er verbissen vor sich hin, »so darf ich nicht von dieser Erde gehen!«
Unter dem brennenden Wissen, den falschen Weg gegangen zu sein, keimte wilde Panik in ihm. Vinzenz hatte erkannt, es sich mit dieser Entscheidung viel zu leicht gemacht zu haben. So konsequent sein Opfergang auch war, konnte er doch ausschließlich für ihn selbst eine reuevolle Bedeutung haben. Das schlichte, anonyme, ihm gewidmete Holzkreuz auf dem Soldatenfriedhof würde für alle Zeiten nur ein einziges unbekanntes Schicksal dokumentieren. Ohne Preisgabe der Umstände, knapp und bescheiden, ausgedrückt in einem Kreuz und dem finalen Datum. Der Gedanke, dass mit seinem erflehten Tod die darin gipfelnde Tragödie für alle Zeiten im Strudel der Geschichte unterging, war für Vinzenz plötzlich schier unerträglich. Die Welt, oder zumindest das Tal und Josefs Eltern, mussten es erfahren; auf welche Art und Weise auch immer.
Mit einem Male erwachte Vinzenz aus seiner Lethargie. Er wollte es hinausschreien; sich offen zu seiner Schuld bekennen. Nicht hier und jetzt, sondern dort, wo ihn jemand hörte. Entschlossen riss er sich ein Stück seiner Ärmelkrempe ab, faltete es zweifach und schob es sich zwischen die Kiefer. Dann fing er an, sich unendlich langsam über das Trichterfeld zu ziehen. Mit jeder Bewegung bohrte sich der Schmerz quälender durch seinen Geist und ließ ihn mehrere Male in eine kurze Ohnmacht sinken. Wieder und wieder raffte er sich auf, krallte die Finger in den sumpfigen Untergrund, ohne zu wissen, ob er am Ende nicht im Kreis umherkroch. Als ihn seine Kräfte schließlich zu verlassen drohten, schälte sich direkt vor ihm schemenhaft eine von Menschenhand angelegte Vertiefung aus dem Dunkel der Nacht. Sollte er es tatsächlich geschafft haben? War dies der aufgegebene, vorgeschobene Graben im Niemandsland, von dem die Kameraden immerzu gesprochen hatten? Oder lag vor ihm etwa schon die vorderste italienische Linie?
Vinzenz wagte nicht zu rufen, um Gewissheit zu erlangen. So wälzte er sich auf den zerschossenen Grabenrand, um sich von dort einfach auf dessen Grund fallen zu lassen. Vinzenz ahnte, wie schmerzhaft das Aufkommen sein würde, und biss so fest er konnte auf das Stück Filz in seinem Mund.
Kaum eine Sekunde später schlug er hart auf dem Boden auf. Sofort raste eine Welle von kaum auszuhaltendem Schmerz durch sein Bein; ein gedämpfter Aufschrei ging durch den Graben. Vinz krümmte sich zusammen, rammte die Finger verkrampft in den Dreck und atmete nur noch stoßweise ein und aus, bis der Schmerz wieder auf ein halbwegs erträgliches Niveau gesunken war. Wie gerne hätte er sein Leiden in die Nacht hinausgebrüllt, laut um Hilfe gerufen. Doch je mehr er seinen Blick durch das Grauschwarz der ihn umgebenden Silhouetten wandern ließ, desto mehr wurde ihm klar, dass ihn seine Kameraden beim besten Willen weder hören, geschweige denn zu Hilfe eilen konnten. Alles war still, nichts bewegte sich. Keine Wache kam vorsichtig um die Ecke des Grabens und fragte nach der obligatorischen Parole. Vinzenz befand sich tatsächlich in diesem besagten aufgegebenen Graben; und er war allein. Allein mit sich und den Toten, welche man seit dem Verlassen dieser Linie nicht hatte bergen und beerdigen können.
Es lag ein entsetzlicher Gestank in der Grabensohle, der Vinzenz fast das Bewusstsein raubte. Unaufhörlich waberte der süßliche Geruch von Verwesung über ihn hinweg, stieg penetrant in seine Nase und löste diesen nicht zu unterdrückenden Brechreiz aus, dem er sich schließlich ergab.
Die Blitze entfernter Detonationen erhellten kurz den dunstigen Himmel. Vinzenz nutzte die Gunst des Augenblickes. Angestrengt suchte er den vor sich verlaufenden Graben nach einem Unterstand ab. Und da, im letzten Abklingen des gespenstischen Scheins, erkannte er kaum zehn Meter vor sich die Umrisse eines mit schweren Holzbalken abgestützten Loches in der abknickenden Grabenwand. Vinzenz schöpfte Hoffnung. Mit etwas Glück würden sich darin eine Pritsche, Decken und etwas Verbandszeug, ja vielleicht sogar Morphium finden lassen.
So zog er sich weiter, Meter um Meter dem schützenden Kavernenloch zu. Er kroch über herabgestürzte Steine, glitschiges, geborstenes Verbauholz und wälzte sich über zwei aufgeblähte tote Körper, die der eingestürzte Graben zur Hälfte verschüttet hatte. Vinzenz nahm sie in seinem Schmerz kaum wahr und dankte der Dunkelheit, dass sie ihn nur die grässlichen Umrisse erkennen ließ.
Schließlich bekam er den Balken des Eingangs zu fassen und zog sich daran mit einem letzten kräftigen Ruck ins Innere der Kaverne.
Es war stockfinster, totenstill, wie in einem Mausoleum. Vinzenz konnte nicht einmal Umrisse erkennen. So tastete er sich vorsichtig an der Felswand weiter bergein. Es ging Stufen hinab, an deren Ende sich ein kleiner Wassertümpel gebildet hatte. Dahinter ertastete Vinz vorsichtig eine zusammengestürzte Wand, aus deren Schuttkegel Holzplanken und Felsen ragten. Sofort rieselte von oben loses Geröll nach und ergoss sich über seine Schulter. Vinzenz erkannte: Es hatte keinen Sinn, sich weiterzuziehen, ohne auch nur einen Funken Vorstellung von der Räumlichkeit zu haben. In der Hoffnung, seine Streichhölzer würden noch einigermaßen trocken sein, entschloss er sich, eines davon zu entzünden. Der schwache Schein, so war er sich sicher, konnte nicht über den hohen Graben hinweg nach draußen dringen. Zitternd legte er das Hölzchen an die Reibefläche und rieb. Für einen Moment tauchte die aufheischende Flamme den Raum in ein fahles, schwaches Licht. Hastig schweiften Vinzenz’ Blicke umher, während er sich auf seinen rechten Arm aufstützte und das Hölzchen mit der linken Hand in die Höhe hielt.
Links ein Tisch, zwei Stühle, zusammengebrochene Pritschen, Regale, allerlei Utensilien auf dem Boden verstreut. Ein Buch, Schreibzeug, Fernsprechdrähte, Munitionskisten, Tornister, Konserven, drei Gewehre, ein Postsack. Vinz’ Kopf flog herum; das Hölzchen glomm nur mehr an den letzten Millimetern, bevor es seine Finger versengte. Rechts Volltreffer, Verbruch, halb verschütteter Wassertornister, zerborstene Bänke und Pritschen; Kerzenstummel – aus –, Dunkelheit.
Kerzenstummel?, schoss es Vinzenz wie ein verheißungsvolles Echo durch den Kopf.
Es dauerte nicht lange, bis der Raum in ein gleichmäßig flackerndes Licht getaucht wurde und Vinzenz das ganze Ausmaß seines unerhörten Glücks vor Augen führte.
Da gab es Konserven für mindestens eine Halbkompanie, zwei nahezu volle Petroleumlampen, Decken, zumindest vier intakte Pritschen, aber leider auch die obligatorischen, unliebsamen Begleiter des Todes. Ratten. Überall huschte und quietschte es. Die ganze Kaverne schien in Bewegung zu sein. Aber dies kümmerte Vinzenz in diesem Moment wenig. Er klammerte sich mit seinen verdreckten Händen an die große, ungeöffnete Verbandstasche, als habe er einen Schatz gefunden. Danach zog er einen Wassertornister zu sich, wusch sich, so gut es ging, die Hände und legte mit verzerrtem Gesicht sein Bein auf die Pritsche. Vorsichtig trennte er mit seinem Messer das Hosenbein auf und schlug es zurück. Für einen Moment musste er sich voller Entsetzen abwenden, konnte seinen zerfetzten Körper nicht ertragen. Vinzenz hatte nicht geahnt, dass es so schlimm sein würde.
»Schöne Bescherung; kein Wunder, schmerzt es so fürchterlich«, presste er geschlagen zwischen den Lippen hervor und führte seine Hand zitternd der Wunde zu. Er wagte es kaum, sie zu berühren, obwohl er wusste, dass der handtellergroße Minensplitter, welcher sich oberhalb seines Knies tief in den Schenkel gebohrt hatte, dort keinesfalls bleiben durfte. Der blutverschmierte welsche Metallfetzen musste heraus, um jeden Preis.
Schon an der unnatürlichen Lage seines Beines erkannte er, dass das Geschoss wohl auch den Knochen durchschlagen hatte. Auf einen Sanitätstrupp oder gar einen Arzt brauchte er nicht zu hoffen. Er war ganz und gar sich selbst überlassen. Und dies wahrscheinlich über Tage oder Wochen hinweg. Allein die Vorstellung, an sich selbst herumzuoperieren, bescherte ihm Schwindel und Übelkeit. Sein Blick fiel auf das zerschnittene Hosenbein und die Wickelgamaschen, welche im schwachen Licht der Petroleumlampen dunkelrot schimmerten.
Wie viel Blut ich wohl schon verloren habe?, fragte er ahnungsvoll in sich hinein. Ernüchtert ließ er seinen Kopf auf eine zusammengerollte Decke zurücksinken und verfolgte die Ratten, wie sie fette Beute witternd an der Pritschenkante entlanghuschten.
So sieht also mein unrühmliches Ende aus. Letztlich werden mich die Ratten fressen. Im Kommando pinseln sie sicher schon meine Vermisstenmeldung. Und sollte dieser Unterstand nicht zusammenbrechen, wird meine Erkennungsmarke irgendwann Aufschluss über meinen Verbleib geben. Niemand wird jemals erfahren, wer ich war, wie ich lebte, was ich getan habe und noch tun wollte.
Für einen Moment verließ Vinzenz der Mut. Erst als seine Gedanken wieder um Josef zu kreisen begannen, fasste er sich ein Herz und richtete sich wieder auf.
»Was habe ich zu verlieren?«, fragte er sich halblaut, bevor er den Splitter fest umgriff und mit einem beherzten Ruck aus seinem Fleisch zog. Sofort ergoss sich ein Schwall Blut aus der tiefen Wunde. Vinzenz war gerade noch fähig, mit der anderen Hand eine Kompresse auf die Wunde zu legen; dann raubte ihm ein rasender, gleichbleibender Schmerz das Bewusstsein.
***
In Altherberg, einem kleinen Bergdorf an der Grenze zu Italien, lag die Dunkelheit schwerfällig im Talgrund. Als beharre sie trotzig auf den letzten Minuten ihrer vergänglichen Gegenwart, ließ die Finsternis nicht erahnen, dass das Morgengrauen unaufhaltsam zwischen die unzähligen Türme und Zinnen der hohen Croda kroch, um sie in ein erstes bläulich kaltes Licht zu tauchen.
Der Wind strich sanft um die Häuser und säuselte sein beruhigendes und gleichermaßen unheimliches Lied. Alles, was zu dieser Stunde im Freien stand, wurde binnen Sekunden feucht und klamm. Als wisse der Nebel um seine kurze Anwesenheit, hinterließ er an allem, was ihm ausgesetzt war, unzählige kleinste Perlen, bevor er dann selbst vom lauen Bergwind aus dem Tal gefegt wurde und sich langsam in Nichts auflöste, als wäre er niemals da gewesen.
Ruhe ist das höchste Gut der Erde, dachte der Cronatzer Vinz vor sich hin, als er behäbig ins Dunkel vor seine Haustür trat. Ein alter Mann war er geworden. Sein ernster, von Trauer und Bitternis geprägter Blick glitt, wie jedes Mal, nachdem er vor die Tür trat, unweigerlich zuerst hinauf zur Croda, dann hinüber zum Kreuzboden. Wie zwei magische Punkte zogen sie seine Blicke an, erinnerten ihn an die schrecklichen Tage seiner Jugend und raubten ihm seinen innersten Wunsch: endlich die Fähigkeit zu erlangen, seine ganz persönliche Apokalypse vergessen zu können; und sei es nur Sekunde um Sekunde, Minute für Minute, so lange, bis nichts mehr davon seinen Geist zermartern konnte. Dies war seine Vorstellung vom Himmel, vom Erlöstwerden, vom Paradies. Er wusste nur zu genau, wie oft die hoffungsvolle Fantasie den Kampf mit der Realität aufgenommen hatte, um aufopfernd in einer Traumwelt um das Seelenheil zu kämpfen; um letztendlich doch zu verlieren. Am Ende stand stets die schmerzliche Einsicht über das Unabänderliche, den Moloch der geistigen Machtlosigkeit, der die Jahre habgierig dahingerissen hatte, bis keine Zeit mehr für Träume und Wünsche verblieben war.
Vinz war an diesem Morgen der Einzige, der sich so früh aufmachte. Der betagte Mann, den alle nur den »alten Vinz« nannten, trug wohl am schwersten an der Last der durchlebten Vergangenheit. Dabei wusste niemand im Tal und keiner im Dorf um das, was ihn seit Jahrzehnten, Jahr für Jahr, ein kleines bisschen schneller dem Tode näher brachte als seine Mitmenschen.
Seelenballast. So nannte er jene trüben Gedanken insgeheim, wenn er wieder einmal mit sich selbst sprach, und er redete oft mit seiner Seele. Manchmal plauderte er auch mit seiner Lena, die ihn schon vor so vielen Jahren verlassen hatte. Hin und wieder sprach er auch mit dem Sepp oder einem jener vielen Kameraden, die vor über fünfzig Jahren ihr Leben gegeben hatten, deren Freund er oft nur wenige Tage hatte sein dürfen. Eben solange es die todbringenden Granaten erlaubten. Vielleicht war es auch nur ein Gebet, ein ganz persönlicher Glaubensmonolog, versehen mit ein klein wenig Hoffnung, dass er von jemandem, der nicht mehr auf dieser Welt weilte, erhört werde.
Vinz, der grobschlächtige alte Mann, hatte seinen Beruf geliebt. Er war Bergführer aus Leidenschaft gewesen und bis vor fünfzehn Jahren hatte er noch etliche Gäste auf die begehrten Gipfel geführt. Vinzenz mochte diese späte Jahreszeit, in welcher wieder Ruhe im Dorf einkehrte. Er liebte die frühe Stunde, die Kühle der Nacht, den verheißungsvoll beginnenden Tag. Heute sollte es noch einmal hinaufgehen, ganz hinauf! Auf einen Berg, der ihn seit fünfundfünfzig Jahren nicht mehr gesehen und gespürt hatte.
Der Croda hatte er seit jenem schrecklichen Tag keinen Blick mehr geschenkt, war nicht einmal an ihren mächtigen Fuß spaziert. Alle Gäste, die mit ihm dort hinaufsteigen wollten, hatte er kategorisch an andere Führer verwiesen. Niemand wusste, weshalb er dies tat, aber jeder akzeptierte seine fast stoisch wirkende Konsequenz.
Als der feuchte Nebel kühl über sein Gesicht strich, atmete er tief ein und glaubte für ein paar Momente, wieder ein junger Bursche zu sein. Nur schwer erkannte er die Umrisse der benachbarten Häuser. Alles war wie in lockere schneeweiße Watte gebettet.
Bald wird er wieder kommen, der Schnee, dachte der alte Vinz halblaut vor sich hin. Es war ihm gleichgültig, als er sich ertappte, wie er vor sich hinsagte, dass es jedes Jahr dasselbe sei. Zuerst kündige sich der Winter mit dem ersten Schnee an, vielleicht gegen Ende Oktober. Dann, wenn er angekündigt ist, käme er selbst.
Vinz saß das Alter zweifellos in den strapazierten Knochen und Sehnen. Er wusste, dass ihn irgendwann die Gicht endgültig in die Schranken weisen würde. Vor diesem Tag fürchtete er sich, mehr noch als vor dem Tode. Vinz wollte den Gedanken nicht zu Ende denken, endgültig versagt zu haben. Er konnte und durfte es nicht zulassen, dass eines Tages der eigene Grabstein alles so unvollendet beschließen würde.
»So darf es nicht enden«, sagte er halblaut immerfort zu sich selbst. In seiner Stimme schwang Entschlossenheit und der eiserne Wille, es endlich anzugehen und zu einem guten Schluss zu bringen.
Hätte ihn jemand danach gefragt, was ihn heute dazu trieb, ein vielleicht letztes Mal die schweren Nagelschuhe anzulegen, er hätte es ihm nicht genau sagen können. Er wusste nicht einmal selbst, ob er jenes ferne Ziel erreichen würde, zu dem es ihn all die Jahre hingetrieben, aber ihn stets der Mut bereits nach wenigen Metern verlassen hatte.
Er hatte nur immerzu jenes Bild vor Augen. Nacht für Nacht war es da wie ein ständiger Begleiter, ein Schatten, den er, wohin er sich auch wandte, nicht abzuschütteln vermochte. Immer und immer wieder strafte dieser Traum seine Seele; und wäre nicht so viel Wahrheit in ihm gewesen, hätte irgendwann die Gewohnheit ihren Schleier über das Geschehene gelegt. Doch sie tat es nicht, ganz im Gegenteil. Vinz wusste nur zu genau, dass diese Träume die Ausgeburt eines Erlebnisses waren, das sich unauslöschlich in sein Hirn eingebrannt hatte; damals im Krieg.
»Heute! Ja heute und sonst nimmermehr!«, murmelte er vor sich hin; so, als wolle er sich selbst Mut machen. Er fühlte sich gut und stark genug für das, was er all die Jahre über nicht im Stande gewesen war zu tun. Es sollte vorbei sein, nach all der Zeit.
So machte sich der alte Vinz auf seinen Weg. Und dieser Weg begann nicht am Berghang, wo all die modernen Wegweiser den Unkundigen in die vorgegebene Richtung lenkten. Sein Weg begann mit dem Glattstreichen der Bettdecke. Freilich war sie schon vorher glatt gewesen. Doch eben nicht glatt genug. Vielleicht stellte das Streichen auch eher ein Streicheln dar. Vinz tat an diesem Tage alles mit sonderbarem Bedacht. Nachdenklich betrachtete er den großen Schlüssel in seiner Hand. Er war, weiß Gott wie oft schon, außer Haus gegangen und nicht selten tagelang unterwegs gewesen. Aber dass er auch nur einmal die Tür verriegelt hätte, daran konnte er sich nicht erinnern. Jener Gang, den er antrat, war in seinem Alter nicht mehr selbstverständlich und genau genommen viel zu beschwerlich. Auf eine ganz besondere Art hatte er etwas Endgültiges an sich. Etwas, das den alten Vinz veranlasste, einmal mehr in die wohlbekannte Stube hineinzublicken, obwohl er wusste, dass dort alles wie seit jeher, ganz akkurat, seinen Platz innehatte.
Ordentlich sollte alles aussehen, so als kehre jeden Moment der Vinz zurück, um eine Kanne Kaffeewasser auf den zischenden Herd zu setzen. Alles stand ruhig und friedlich an seinem Fleckchen; so ruhig, dass man hätte meinen können, es würde niemals mehr verändert werden. Es roch nach Abschied. Es klang nach einer Reise, die nur sehr wehmütig angetreten wurde, als sich der Schlüssel zweimal im Schloss drehte. Wie ein schwerer Buchdeckel, der zugeklappt wurde und ernüchternd das Ende einer Episode verdeutlichte, war sie ins Schloss gefallen, die gute Tür.
In der Einsamkeit hatte sich Vinz eigenartige, leblose Gefährten ausgesucht. Hin und wieder kam es vor, dass er mit ihnen unbewusst ins Gespräch kam. So hatte auch die Tür so manchen Monolog über sich ergehen lassen müssen. Sie war ihm in all der Zeit eine genügsame Begleiterin gewesen. Sie verabschiedete ihn, wenn er ging, und begrüßte ihn, wenn er heimkehrte. Der Vater hatte sie selbst verziert, damals, lange vor dem unsäglichen Krieg. Auch der schwere Zirbenholzriegel mit der Jahreszahl in der Mitte war ein Werk seiner Hände gewesen. Die Rose, welche ein Stück weiter der Straße entlang in eine verwitterte Latte eines Stadels eingeritzt war, stammte allerdings von Vinzenz. Das Jahr 1910. Als wäre es gestern gewesen, tanzten Bilder der Vergangenheit vor seinem geistigen Auge einen Reigen der heilen Welt. Er verlangsamte seinen Schritt nur ein wenig, als er an dem verfallenen Gebäude vorüberschritt. Seine Gedanken aber hielten eine ganze Weile an diesem wettergegerbten Stück Holz inne und ließen ihn ein Stück weit alleine und unbeschwert seines Weges gehen. Ewige Liebe schwor er sich damals zu ihr. Und doch; doch kam alles so unglaublich anders; kam all das, was in dem beschaulichen Tal vorhersehbar schien, so schrecklich verkehrt.
Obwohl er schon das Ende des Dorfes erreicht hatte, träumte er noch lange von seinen glücklichen Tagen. Fast so, als klammere er sich verzweifelt an die längst vergangene Jugend, die sein Leben viel zu kurz versüßte. Er wusste, dass dort in dieser unbeschwerten Zeit das Schicksal seinen unabwendbaren Lauf genommen hatte. Vinzenz gewann darüber Klarheit, dass ihn das Wissen darüber in den Stunden, die an diesem Tag noch vor ihm lagen, begleiten würde wie sein eigener Schatten. Dieses auferlegte Schicksal aber war sein Leben, nicht mehr und nicht weniger.
2. Der Adler
An der ersten Kehre des schmalen Weges beschrieb der dichte Waldbestand ein ovales Fenster und gab den Blick in das Tal frei. Damals wie heute blickte Vinz hinunter auf das Dorf, das langsam von der Sonne erfasst wurde. Vinzenz genoss diesen Augenblick des Alleinseins und der Zufriedenheit. Er spürte die Kraft der Umgebung, fühlte sich geborgen. Auf diesen Fluren, deren Vergangenheit längst vom Sog der Geschichte verschluckt worden war, schien trotz allem die Zeit stehen geblieben zu sein. Es gab keine schlimmen Veränderungen, keine großen Neuigkeiten mehr, die das beschauliche Gefüge verändert hätten, wie es in der Zeit davor der Krieg getan hatte. Plötzlich empfand er einen unstillbaren Durst nach solch beruhigenden Bildern, wie er sie in diesem Moment vor Augen hatte. Ein Anflug von Traurigkeit legte sich über seine Züge, als er sich eingestand, viel zu lange nicht mehr hier heroben gewesen zu sein.
Wie ein überdimensionales Gemälde breitete sich die Landschaft vor ihm aus. Dunkles Grün ging sanft in Lindgrün über und mischte sich mit den lustigen, orangeroten Flecken der Lärchen, die bereits die ersten Nadeln zu Boden gleiten ließen. Weiter oben gipfelte das Grau und Weiß der Berge in das satteste Blau, das es jemals gab. Kleine Wolken tanzten über den Grat und zerfielen in den Sonnenstrahlen in ein unsichtbares Nichts. Dieses Bild war Quell seiner Lebensfreude, Zuversicht und letztlich seines Mutes, der ihn sein ganzes Leben lang gestützt hatte.
Vinzenz blieb stehen, atmete tief ein und schloss für einen Moment die Lider. Die Erinnerung hatte ihn ebenso eingeholt wie der Nebel.
Wie lange all das bereits zurückliegt, dachte er. Und doch schien es ihm, als lägen nur eine paar regenreiche, düstere Tage zwischen dem Einst und dem Jetzt. Der alte Vinz begann vor sich hin zu schmunzeln. Wie deutlich er plötzlich alles vor sich sah …
Hier an dieser Kehre, an welcher sich der Weg mit einem anderen traf, hatten sie sich immer verabredet; er und der Sepp. Er erinnerte sich wieder an die damals schwierige Lage der Bruggers; insbesondere an Josefs Mutter, die Maria. Bruchstückhaft begann Vinzenz gedanklich alles aufzuzählen, was er noch wusste, und war über sein Erinnerungsvermögen erstaunt, als er endgültig in die Vergangenheit eintauchte und anfing, sich selbst seine eigene tragische Geschichte zu erzählen.
»Die Maria; sie hat’s nicht leicht gehabt in diesen schweren Zeiten«, murmelte Vinz abwesend vor sich hin.
Keiner hat ihr geholfen. Freilich nicht, weil sich eben alle schwertaten im Hochtal. Dabei hat’s doch so gut begonnen, wie man sich im Dorf immer erzählte. Aber die Zeit brachte die Not und die Not ging Hand in Hand mit dem Tod.
Vinzenz’ Blick glitt hinüber zum Talausgang.
Das Kurbad. Es war nicht immer eine Ruine. Dort hinter diesen herrschaftlichen Mauern hatte alles angefangen, nahm alles seinen unabwendbaren Lauf.
Das Kurbad lag außerhalb der kleinen Gemeinde. Die vornehme Anlage mit seinen stuckverzierten Sälen und vertäfelten Zimmern war dem Adel und den Reichen vorbehalten. Wie ein verwunschenes Schlösschen schmiegte es sich inmitten des Waldes erhaben an den steilen Berghang. Nicht nur auf Vinz und Josef übte es eine gewisse Faszination aus. Das ganze Tal war sich der fortwährenden Präsenz hochrangiger Gäste bewusst und achtete penibel darauf, dem Ruf, der sich eigentlich nur auf die Kuranlage beschränkte, gerecht zu werden.
Josefs Mutter, Maria, hatte im Kurbad eine Anstellung gefunden. Elf Stunden Küchendienst an sieben langen Tagen in der Woche war das Einzige, was das enge Tal mit seinen dickschädeligen Menschen für eine Frau mit Geschichte zu bieten hatte. Das Kind; Josef war es, der in den Köpfen der Dorfbewohner seine eigene Mutter zur Dirne machte. Eine Schande sei’s, wenn nicht einmal die Mutter selbst den Vater des Burschen kenne. So zerriss sich das ganze Dorf den Mund, um beim sonntäglichen Kirchgang wieder ganz still zu sein, wenn Frau Brugger mit ihrem Sohn ganz hinten Platz nahm. Dabei traf die außerordentlich hübsche junge Mutter kaum Schuld an ihrem traurigen Schicksal.
Ihre Eltern waren früh verstorben und hinterließen ihr als einziges Kind einen jener Höfe, die am weitesten vom Dorf entfernt lagen. Die Felder waren klein und zu steil, um allein von ihr bestellt, gepflegt und abgeerntet werden zu können. Einen Knecht hatte sich die Familie noch nie leisten können. Die Bruggers wendeten ihre ganze Kraft dafür auf, um der einzigen Tochter eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Maria sollte es einmal besser haben und eine anständige Lehre für einen angesehenen Beruf absolvieren dürfen. Schon als kleines Mädchen stand Maria lange vor dem Bild im Hausgang, auf dem die unterschiedlichen Stände der Frau abgebildet waren. Es war ein dunkel gehaltenes Bild mit einem dicken silbernen Rahmen. Die Schneiderin stand ganz oben auf der pyramidenartigen Formation. Erhaben und in strahlend weißem Kleid stand sie über allen. Über der Bäuerin, der barmherzigen Schwester und der Kindsmagd. Die Eltern sahen Maria in Bruneck, Lienz oder Bozen in einer jener vornehmen Schneidereien an einer blitzblanken Nähmaschine sitzen. Und dort sollte sie auch sitzen, ganze zwei Jahre lang.
»Zwei Jahre der Pein«, wie Maria diese Zeit immer nannte, wenn Josef sie manchmal neugierig danach fragte. Zweifellos hatte sie in dieser Zeit viel gelernt. Vieles davon war ihr auch lange danach noch sehr nützlich und entschädigte sie für die anderen Leiden, die sie in der fernen Stadt erfahren hatte.
Als die Bruggers keine vollständige Geldanweisung für Kost und Logis an die Schneiderei anweisen konnten, war es um die Zukunft Marias schließlich geschehen. Keine Schneiderin, vielmehr eine krumm geschuftete Bäuerin würde aus ihr werden. Und selbst dafür müsste sie noch dankbar sein. Welcher Bauer aus dem Tal hatte schon Interesse an einer Bauerstochter, deren abgewirtschafteter Hof keinen Ertrag, stattdessen umso mehr Arbeit brachte.
Als die Bruggerin ihre Eltern zum ersten Male seit über zwei Jahren wiedersehen sollte, legte sich der erste Schatten auf ihre Seele. Sie hatten sich diese sinnlosen Jahre der unwiderruflich versagten Hoffnung vom Munde abgespart. Die Felder, welche ihrer tieferen Lage wegen etwas mehr Erlös brachten, waren nach und nach verkauft worden. Der Vater lag mit rasselnder Lunge auf dem Sterbebett und die Mutter saß gänzlich abgemagert in Lumpen daneben. Die Freude flammte nur kurz auf, war nur vom Wiedersehen genährt, danach verfiel die Mutter in ein unaufhörliches Wimmern. Das Gefühl, versagt zu haben, brach aus ihr heraus und schwängerte die kalte Luft der Stube mit der Ohnmacht, der sie während der vergangenen Zeit gegenübergestanden hatte.
Es sollte nach dem Tode des Vaters Brugger Jahre dauern, bis die beiden Frauen den Hof wieder so hergestellt hatten, dass er für sie gerade genug zum Leben abwarf. Die Mutter hatte längst erkannt, dass der einzige Ausweg für Maria darin bestand, eine Stellung als Magd in einer Landwirtschaft im Tal anzutreten.
Maria vertraute ihrer Mutter, als diese sagte, sie würde schon das Rechte für sie finden. Doch auch im Tale, das für die Bruggers stets den Wohlstand verkörperte, waren die Zeiten schlecht. An welche Tür sie auch klopfte, sie durfte nicht einmal eintreten. Es verging kein Tag, an dem die Mutter Brugger nicht ins Tal hinabwanderte, um für ihre Tochter zu werben. An jenem Tage, als es in Strömen regnete, versuchte Maria ihre Mutter davon abzuhalten, abermals hinunterzusteigen.
»Es ist doch eh ohne Sinn! Wir werden schon zurechtkommen! Bleib heut’ heroben, du fieberst doch!«, soll sie damals gesagt haben. Aber vergebens. Als die Mutter Brugger am Türstock des Platterhofes am Ortsrand kniete, bat sie für Maria weinend um eine Stellung als Hilfsmagd. Der entfernte Verwandte konnte sich der Bitte nicht erwehren und willigte schließlich ein. Kurz darauf verstarb Marias Mutter.
Mit schweren Eichendielen hatte Maria die Eingangstür und die Fenster des Hofes vernagelt, verließ ihren Hof schweren Herzens. Sie wollte nie mehr zurückkehren. Den Schlüssel jedoch behielt sie stets bei sich. Ihr Leben sollte sich nun dort abspielen, wohin sich schon im Kindesalter ihre sehnsüchtigen Blicke reckten. Im Tal. Sie war eine hübsche junge Frau geworden und genoss es, von den jungen Knechten umschwärmt zu werden. Der Verwandte hielt sein Versprechen, und Maria sah in ihrer Anstellung die Chance, ihren eigenen Weg beschreiten zu können. Dieser Weg aber war steinig und steil. Denn auf dem Bruggerhof, hoch über allem Geschehen, wurde Maria kein sicherer Gang beigebracht. Sie verfing sich oft, kam schnell ins Stolpern und stürzte schließlich den ganzen langen Weg wieder hinab, den sie sich so mühevoll hinaufgekämpft hatte.
Als sie nach einer Sonnwendfeier alleine im Stroh einer fremden Scheune erwachte, begannen sich Tränen in ihren Augen zu bilden, um bald danach unaufhörlich über die roten Wangen zu laufen. Sie wusste, dass sie in dieser Nacht zur Frau geworden war. Sie erinnerte sich an den süßen Wein, an die vielen lieben Burschen, aber nicht an den Einen. Auch dieser Eine war entweder seiner Erinnerung beraubt oder er empfand die daraus entstehenden Pflichten als lästig. Maria konnte es nicht lange verbergen, dass in ihr ein Kind heranwuchs. Sie glaubte sich bei ihrer Verwandtschaft wohlbehütet und beichtete das Vorgefallene eines Abends der entrüsteten Platterin, die grotesk zu lachen begann.
»So, a Kind kriagsch’ also?« Ihre Züge waren plötzlich voller Hass.
»A Schand isch des! Aber net auf meinem Hof, junge Frau! Aus den Augen gehst mir. Pack deine Sach’n! Wer a unlediges Kind kriegen kann, der isch a wohl im Stand, auf seim eignen Hof auszukommen!«
Sie schubste Maria aus der Stube und ließ sie nicht mehr zu Wort kommen. Maria schien es, als käme der Bäuerin ihr Unglück gerade recht, um sich der lästigen Verwandten begründet wieder zu entledigen. Die grobschlächtige Bauersfrau schloss mit den Worten:
»A Unmensch will ich am End net sein. Im Kurbad oben suchens Küchenhilfen. Bei Zeit werd ich mit dem Direktor ein Wörtl reden. Aber jetzt gehst mir aus den Augen«. Dann fiel die Tür ins Schloss.
Maria ging kraftlos und geschlagen durch das Dorf, immer weiter aus dem Tal hinaus.
»Hascht heut nix zduan, scheane Marie!«, riefen ihr die Geiferer voller Sarkasmus nach. Maria wandte sich nur wortlos ab, als bewerfe man sie mit Mist. Sie zog die Schultern ein und begann zu laufen. Sie lief und rannte so lange bis sie gänzlich außer Atem geraten war. Stunden später, im letzten Abendlicht, tauchten schließlich die Umrisse eines unbeleuchteten, verwahrlosten Hofes vor ihr auf. Maria war nach Hause gelaufen.
Sie riss die Eichenplanken von der Tür, drückte die Klinke nieder und trat ein. Behutsam und zärtlich strich sie über ihren rundlichen Bauch und flüsterte:
»Hier kommen wir her, und hier werden wir bleiben.«
Josef war ein uneheliches Kind, doch deswegen nicht eine Haaresbreite schlechter als die anderen Kinder. Wie schrecklich wurde es damals empfunden, eine Dirne im Dorf zu haben, aber wie groß war ein paar Jahre später der Schmerz über die Erkenntnis, mit welch unbedeutenden Belanglosigkeiten man sich in diesen friedlichen Jahren die Zeit vertrieb.
Der alte Vinz stand noch immer an der Weggabelung. Als wäre es gestern gewesen, hörte er seine eigene kindliche Stimme und jene Josefs. Was war das für ein Tag gewesen, damals in diesem schönen Sommer! Er drehte sich um und reckte den Blick hinauf zur Croda. Es schien ihm nahezu unglaublich, dass sie es damals tatsächlich geschafft hatten. Noch immer, nach der langen Zeit, lief es ihm beim Anblick der fast lotrechten Wand kalt über den Rücken. Ein Tanz mit dem Tode, ja das ist es gewesen, dachte er und glitt wieder in die Vergangenheit hinüber.
Josef war wohl der beste Kamerad, den man sich wünschen konnte. Vinzenz interessierte es nicht, ob sein Freund nun einen Vater hatte oder nicht. Vielmehr empfand er es als störend, dass Sepp von seinen Schulkameraden damit aufgezogen wurde, durchlöcherte Kleider und Schuhe zu tragen. Vinzenz stand schon immer auf der Seite der Schwächeren. Alles, was bei einer Freundschaft für ihn zählte, war das Vertrauen und der Verlass; was ihm in Sepp wie eine unerschöpfliche Quelle erschien.
Josef wartete bereits und schob mit seinen alten Nagelschuhen ungeduldig kleine Häufchen von braunen Tannennadeln zusammen.
»Ist die Mutter wieder in die Arbeit ins Kurbad runter?« Josef nickte.
»Gegen fünf schon.«
»Dann steigen wir besser schnell an, was? Wer weiß, ob das Wetter hält!«
Vinz und Josef hatten zu ihrem Schritt gefunden. Es ging heute etwas schneller voran als gewohnt. Sie hatten etwas Besonderes ausgeheckt. Ein Husarenstreich, wie sie es nannten.
Vor wenigen Tagen erzählte der Vater Cronatzer am abendlichen Stubentisch, wie er mit einem Gast aus England in der Croda-Ostwand gestanden hatte. »Ein hervorragender Alpinist«, hatte es geheißen, und er, als namhafter Bergführer, wollte sich natürlich nicht lumpen lassen, die bislang unbestiegene Wand fortan als bestiegen gelten zu lassen. Bis unter die markante Nadel hatten sie die Wand erklommen, dann mussten sie umkehren.
»Schön wär’s gewesen«, hatte der Vater Cronatzer gebrummt, als er erschöpft das schwere Hanfseil auf die Holzbank gleiten ließ. Vinzenz kannte die Worte und die Gesten seines Vaters, wenn ihm der Berg etwas schuldig geblieben war, wie er es nannte. Doch als er beim Abendbrot plötzlich aufstand und die ihm sonst heilige Stille durchbrechend gesagt hatte, »diese Wand ist unmöglich zu durchsteigen«, entbrannte in Vinzenz der Wunsch, diese heroische Tat zu vollenden, während im selben Augenblick der Vater schwerlich akzeptierte, dass er den Zenit seines Bergführerlebens überschritten hatte. Der Vater Cronatzer ahnte nicht, was sein enttäuschter Satz bei Vinz bewirken sollte.
»Vinz!« Gewaltig brach sich das Echo vier Mal an der schaurig hohen Wand.
»Kannst nachsteigen!« Vinzenz spürte den leichten Zug am Seil und begann zu steigen. Unzählige Male kam dieses Kommando bereits von Josef, der wie immer die ersten Seillängen stieg. Die Tritte und Griffe wurden kleiner und mit jedem Innehalten, um nach dem nächsten Vorsprung zu suchen, spürte Vinz, wie viel ihnen diese Wand abverlangte.
»Gib mir deine Hand, Vinz!« Vinzenz sah kurz in das angespannte Gesicht Josefs. Er konnte die Beklemmung deutlich in seinen Augen sehen.
»Zieh an!« Sie standen beide auf einem kleinen Vorsprung und der Schweiß rann ihnen ununterbrochen von der Stirn.
»Du gehst weiter?«
»Natürlich, das lass ich mir nicht nehmen!«, sagte er mit überzeugter Stimme, blickte aber gleichzeitig angestrengt, ja wenn nicht sogar besorgt, in die glatte Wand hinaus. Im Grunde hatte er keinen Schimmer, wie er dort hinaufkommen sollte und hieß sich gedanklich einen Idioten, so einen dummen Wetteifer mit einer unvollendeten Tat seines Vaters vom Zaun gebrochen zu haben.
»Halte dich links an der Kante.« Auch in Josefs Blicken war der Ehrgeiz gewichen. Kritisch schaute er Vinzenz nach, wie er sich Meter um Meter in die griffarmen Platten schob.
»Dort oben ist ein kleiner Absatz, wenn ich den erreiche, haben wir die Hälfte geschafft!« Vinz’ Echo wanderte unheimlich durch die Wand.
Plötzlich presste er sich instinktiv an den kühlen Fels. Ihm war, als hätte ihm jemand eine Ohrfeige erteilen wollen und dabei nur knapp den Kopf verfehlt. Woher kam dieses Sausen auf einmal? Vinz wagte kaum, den Kopf zu drehen. Er vermutete einen Steinschlag, der ihn fast gestreift hatte. Wieder zog es über ihn hinweg, als versuche jemand mit aller Kraft, ihn aus der Wand zu blasen.
»Was ist das, Sepp?« Vinzenz Stimme überschlug sich.
»Bleib ganz am Fels! Beweg dich auf keinen Fall!« Josefs Stimme holperte panisch über die Absätze und Spalten. Vinzenz begriff nicht.
»Er kommt wieder, bleib wo du bist!«
»Was, verdammt noch mal, kommt wieder?«, gellte es aus der Wand zurück zu Josef. Vinzenz stockte der Atem, als er das Unheil aus dem rechten Augenwinkel auf sich zuschweben sah.
Ein Adler schlägt in schlechten Zeiten Gämsen. Gämsen wiegen beinahe so viel wie ich selbst, schoss es ihm glühend durch den Kopf. Er duckte sich und verlor den Greifvogel aus den Augen.
»Ich kann mich kaum noch halten, wo ist er?«, keuchte er fast atemlos nach unten zu Josef.
»Er kreist über dir, aber er greift nicht an.«
Vinzenz blickte auf seine Finger. Der Fels begann sich unter seinen zerschundenen Fingerkuppen langsam rot zu färben.
»Ich muss weiter«, stöhne er, »versuche ihn abzulenken!«
Vinzenz schob den rechten Arm um den kleinen Block herum, auf dem er sich einen Standplatz erhoffte. Durchdringend, als könnte er Glas zum Zerspringen bringen, durchschnitt der warnende Schrei des Vogels die Stille. Vinz wagte es nicht weiterzuklettern und rief entsetzt: