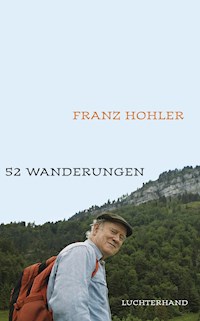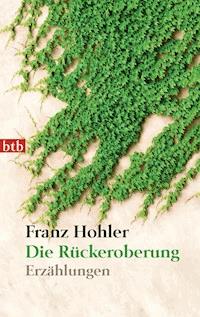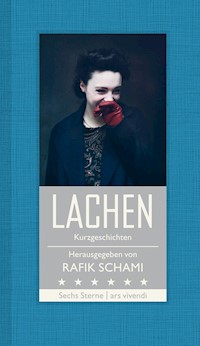17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Lob der Freundschaft: Bestsellerautor Franz Hohler im Spiegel seiner Weggefährt*innen. »Franz Hohler ist ein genauer Beobachter mit einem großen Herzen.« Rafik Schami
Franz Hohler wäre nicht der, der er ist, ohne die Menschen, denen er in seinem Leben begegnet ist. "Franz Hohler & friends" versammelt persönliche Porträts von Weggefährtinnen und Weggefährten, die einen großen Einfluss auf den Menschen und den Künstler Franz Hohler hatten – von Wolf Biermann über Friedrich Dürrenmatt und Dieter Hildebrandt bis Gardi Hutter, Peter Härtling und Mani Matter. Es sind Porträts in Form von kurzen Erzählungen, Liedern, Gedichten, Hymnen oder Abschieden, sie erfassen die Porträtierten gleichsam mit einem Seitenblick, sind Schnappschüsse voller Sympathie und Gespür für die Gemeinsamkeiten. In ihnen scheinen immer wieder die großen Themen Franz Hohlers auf, die Sprache und die Musik, der Sinn des Unsinns und die Abgründe des Alltags, das politische Engagement in bewegten Zeiten. So entwerfen sie wie ganz nebenbei auch das Porträt des Porträtierenden - von Franz Hohler selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Franz Hohler versammelt 62 Porträts seiner Weggefährtinnen und Weggefährten in Form von kurzen Erzählungen, Liedern, Gedichten, Hymnen oder Abschieden. Sie erfassen die Porträtierten gleichsam mit einem Seitenblick, sind Schnappschüsse voller Sympathie und Gespür für die Gemeinsamkeiten. In ihnen scheinen immer wieder die großen Themen von Franz Hohler auf, die Sprache und die Musik, der Sinn des Unsinns und die Abgründe des Alltags, das politische Engagement in bewegten Zeiten. Eine besondere Geschichte der Freundschaft, die in ihrer chronologischen Anordnung mehr als ein halbes Jahrhundert umspannt und so wie nebenbei auch eine Biografie Franz Hohlers erzählt.
Zum Autor
Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über fünfzig Jahren im Luchterhand Literaturverlag.
FRANZ HOHLER
Franz Hohler & friends
Begegnungen
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Luchterhand Literaturverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign München | Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von © Esther Michel
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-32378-3V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Vorwort
In diesem Band sind Texte versammelt, die ich im Verlauf von mehr als 50 Jahren über andere geschrieben habe. Bei der Durchsicht meiner Ordner, der analogen und digitalen, habe ich mich gewundert, wie viele es geworden sind. Der etwas saloppe Titel, den ich aus der Musikszene entlehnt habe, soll nicht lauter enge Freundschaften suggerieren, sondern er steht für Menschen, denen ich begegnet bin und die mir etwas bedeutet haben. Natürlich habe ich nicht über alle, mit denen ich befreundet bin, etwas geschrieben, oft brauchte es ja einen Anlass dazu, im schönsten Fall einen Geburtstag, im traurigsten Fall den Tod. Aber zusammen mit den hier festgehaltenen, den lebenden und den toten, fühle ich mich als Teil einer Großfamilie, und für dieses Gefühl bin ich dankbar.
Franz Hohler
Zürich, Feb. 2024
Emil
Vor einem Jahr noch hat ihn außerhalb von Luzern kaum jemand gekannt. Jetzt hat er schon ungezählte ausverkaufte Vorstellungen in Zürich, Basel und Bern hinter sich, findet an Orten, wo er zum ersten Mal hinkommt wie Aarau, Olten oder Winterthur, bumsvolle Theatersäle vor und schert neuerdings bis nach Berlin aus.
Wer ist dieser Emil, und was macht er?
Heute ist er ein Mann mit drei Berufen: Kinogeschäftsführer, Kleintheaterleiter und Kabarettist. Ursprünglich war er Grafiker (mit einem Atelier samt mehreren Angestellten), noch ursprünglicher war er Postbeamter, aber seine ursprünglichste Gestalt ist der Komödiant. Jetzt sei er wieder so ein Göiggel wie als Kind, sagte seine Mutter, nachdem sie sein Programm gesehen hatte, und wenn Emil selbst über seine Kindheit erzählt, dann fällt ihm immer ein, dass er die andern Kinder zum Lachen gebracht habe, auf dem Schulhausplatz, als Messdiener, oder wenn er in der Pause einen Lastwagenchauffeur nachmachte. Seine Neigung zur Bühne hat er aber nie verleugnet, ihr zuliebe gab er sogar seinen Grafikerberuf auf, als er vor drei Jahren das Luzerner Kleintheater gründete, wo seither praktisch alles aufgetreten ist, was in der Kleinkunst Rang und Namen hat. Daneben hat Emil immer Kabarett gespielt, zuerst in Ensembles mit der üblichen Lokalprägung, dann hat er insgesamt vier Einmannprogramme gemacht, die aber immer zu stark mit luzernischer Politik zu tun hatten, als dass sie über seine Heimatstadt hinaus gewirkt hätten.
»Geschichten, die das Leben schrieb« ist nun sein erstes Programm, in dem er seiner ursprünglichen Gestalt des reinen Komödianten treu bleibt und sich ganz darauf verlässt, dass ihm im richtigen Moment das Richtige in den Sinn kommt. Heute, nachdem er das Programm ein Jahr lang gespielt hat, liegt der Ablauf der Nummern ziemlich fest, aber entstanden sind sie alle als Improvisationen.
Emil ist kein Schauspieler. Wenn er einen Lehrling macht, dann »spielt« er ihn nicht, sondern dann »ist« er ein Lehrling. Er kommt nicht von außen an seine Figuren heran, sondern von innen. Er schaut ihnen nicht gewisse Züge ab, die er dann kopiert, sondern er identifiziert sich auf eine fast unheimliche Weise mit dem Typ, den er darstellen will, und dann kommt alles von selbst.
Wenn Emil den richtigen Typ gefunden hat, ist die Nummer eigentlich schon fertig. Er braucht keine Texte. Ein Programm zusammenzustellen heißt für ihn, die richtigen Typen herausfinden. Emil ist der einzige Kabarettist weit und breit, der es sich leisten kann, sein Programm in Stichworten zu notieren und dann dem Abend freien Lauf zu lassen. Sein Partner ist das Publikum; je besser es reagiert, desto mehr kommt Emil in den Sinn.
Einen Typ gibt es, bei dem ihm am meisten in den Sinn kommt. Es ist der, der alles nur halb begreift, der, der bei den Definitionen ganz zuunterst anfängt. »Ich wett genau das, wo n ich wett« ist ein typischer Emil-Satz, der mit großer Bestimmtheit in einer Situation fällt, wo Emil überhaupt nicht weiß, was er eigentlich will. Was an diesen Figuren frappiert, ist ihre selbstsichere Hilflosigkeit. Die Sicherheit, mit der sie unsicher sind, trifft den Zuschauer, vielleicht weil er darin das Urbild seiner eigenen Situation spürt.
Ob einer ein guter oder ein schlechter Komiker ist, kann man daran messen, ob das Lachen, das er hervorruft, auf Kosten der Menschenwürde geht. Bei Emil lacht man immer mit, man lacht nie aus.
Und noch etwas: Bei ihm können alle lachen. Was er macht, ist so allgemein menschlich, dass sich jeder auf irgendeine Art davon angesprochen fühlt. Das ist etwas, was nur ganz wenige fertiggebracht haben, Charles Chaplin beispielsweise oder Karl Valentin.
Dass jetzt wieder so einer da ist und dass er hier in der Schweiz lebt, ist ein Grund zur Freude und ein Grund für alle, die ihn noch nicht kennen, dies nachzuholen, und sei es nur durch das Anhören einer Platte.
Gardi Hutter
Spaßmacher!
Einmänner!
Komische Vögel!
Macht Platz!
Rückt zusammen!
Ein Neuer ist da!
Und freut euch
es ist eine Frau!
Was soll das Erstaunen
auf euren Gesichtern?
Ja, glaubt ihr im Ernst
es sei euren Visagen allein gegeben
und euren Sprüngen im Kopf
die Leute zum Lachen zu bringen?
Man müsse
aus metaphysischen Gründen
ein Mann sein
dass jemand im Saal
eine Miene verzieht?
Dann schaut sie euch an
die wackere Wäscherin
aus St. Gallen und Nirgendwo
im einsamen Kampf
gegen Berge von schmutziger Wäsche
wie sie beinahe
gehängt wird
vom Seil
anstelle des Sockens
und wie sie der Ekel schüttelt
beim Anblick der Pflicht
und wie sie sich
Mut anliest
mit den Taten Johannas
und wie sie sich rüstet
mit Waschbrett und Zuber
zum heiligen Kriege
gegen das Monstrum Alltag
das bös und beharrlich
sitzen bleibt
in der Ecke der Bühne
und stärker ist
als die tapfere Heldin.
Und wenn ihr gesehen habt
wie diese Ecke der Bühne
zur Mitte des Lebens wird
und wie die Entstellung des Menschen
erst seine wirkliche Stellung zeigt
dann
Spaßmacher
Einmänner
komische Vögel
macht Platz!
Rückt zusammen!
Die Gardi ist da!
Und freut euch
sie ist eine Frau!
Mani Matter
Als man mich einmal in die MRI-Röhre schob und ich eine Musik auswählen durfte, die mir über den Kopfhörer die Zeit verkürzen sollte, entschied ich mich für eine CD des Amerikaners Steve Reich. Nachdem mich der Betreuer des Vorgangs am Ende wieder herausgezogen hatte, sagte er, diese Musik habe noch nie jemand hören wollen. Was denn die Leute sonst gern hätten, fragte ich ihn, worauf er zur Antwort gab: »Mozart oder Mani Matter.«
An einem Sonntag Abend klickte ich am Fernsehen den Schluss des Schweizer »Tatorts« an, »Züri brännt«, und nach ihren offenbar erfolgreichen Ermittlungen sang die Kommissarin für sich, und damit auch für das Publikum, »I hanes Zündhölzli azündt«.
Auf der Kulturseite der »NZZ am Sonntag« wurde jüngst das Zürcher Jazzfestival »Unerhört!« angekündigt, und zwar mit der Überschrift: » ›Kunscht isch gäng es Risiko‹ sang schon Mani Matter.«
Es gibt in der Deutschschweiz praktisch zu allem und jedem ein Mani Matter-Zitat. Seine Lieder sind, fast 50 Jahre nach seinem frühen Tod, von einer selbstverständlichen Präsenz; sie sind den Kindern und den Erwachsenen gleichermaßen vertraut, Mani Matter ist zu einem Klassiker geworden, er ist sozusagen der Mozart des Schweizer Chansons.
Er hat in seinen Liedern das Berndeutsche Anfang der sechziger Jahre aus der Sprache der ländlichen Idylle und der Gotthelf-Hörspiel-Bearbeitungen zurückgeholt in die Natürlichkeit der Umgangssprache.
Dabei war Berndeutsch genau genommen gar nicht seine Muttersprache. Seine Mutter war Holländerin, sein Vater Berner, und um in der Familie ein sprachliches Ungleichgewicht zu vermeiden, beschlossen die beiden Eltern, mit den Kindern Französisch zu sprechen. Berndeutsch hat Mani in der Schule von den andern Kindern gelernt.
»Mani« ist übrigens ein Pseudonym. Sein richtiger Vorname war Hans Peter. Seine Mutter nannte ihn gerne Jan, seine jüngere Schwester machte daraus Nan, danach Nani, das später zu Mani wurde. Das war dann auch sein Pfadfindername, und bei dem blieb er, als er mit Chansons aufzutreten begann. Im frankophilen Hause Matter gab es Platten von Maurice Chevalier aus der Erbschaft eines Onkels, und – von Mani selbst gekauft – von Georges Brassens. Als sich Mani überlegte, was er zu einem Pfadiabend beitragen könnte, machte er ein Mundartlied zu einer Melodie von Georges Brassens, »dr rägewurm«. Er war verblüfft über den Erfolg, alle fragten ihn nach weiteren Liedern, und so fing er an, zu eigenen Melodien eigene Chansons zu schreiben.
Nach der Matur belegte er zunächst ein Semester Germanistik an der Uni Bern, ließ sich aber »durch Vorlesungen über Goethe etwas abschrecken«, und entschloss sich für das Studium der Jurisprudenz. Sein Vater war Rechtsanwalt, spezialisiert auf Marken- und Patentrecht. Manis Interesse galt jedoch dem Staatsrecht. 1963 wurde er Assistent des Staatsrechtsprofessors Richard Bäumlin. 1965 schloss er sein Studium mit der Dissertation »Die Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde« ab. Sie zeigte auf, welche Möglichkeiten einer Gemeinde beim Bundesgericht offenstehen, um gegen kantonale Beschlüsse zu rekurrieren, und kritisierte die damalige Haltung des Bundesgerichts als zu wenig liberal. Es ging letztlich um das Recht des Kleineren gegen den Größeren – der Gedanke an sein Chanson »dr hansjakobli und ds babettli« liegt auf der Hand. Seine Dissertation erschien im Verlag Stämpfli in Bern und dürfte mit ihren 79 Seiten eine der kürzesten Dissertationen überhaupt sein.
1967 begab sich Mani Matter für ein Jahr nach Cambridge, um an seiner Habilitationsschrift zu arbeiten. Sie trug den Titel »Die pluralistische Staatstheorie« und stellte den Staat als ein Gebilde dar, das nicht in erster Linie durch Übereinstimmung geprägt ist, sondern nur durch Widerspruch verschiedener Meinungen lebendig bleibt. Zur Fertigstellung fehlten ihm, als er zurückkam, bloß noch die Fußnoten, die er nie geschrieben hat. Trotzdem bekam er 1970, jetzt als Oberassistent, einen Lehrauftrag für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Bern. Wege zu einer Professur wären ihm durchaus offen gestanden.
Im Januar 1969 hatte er einen befristeten Auftrag bei der Stadt Bern angenommen, wo man jemanden suchte, der in den städtischen Reglementenwirrwarr Ordnung brachte. Nachdem er diese Arbeit abgeschlossen hatte, wurde er zum festangestellten Rechtskonsulenten der Stadt ernannt.
Die Aussicht, ein ganz normales Leben als städtischer Beamter zu führen, erleichterte ihn, wie er in einem Brief an seinen Liedermacherfreund Fritz Widmer aus Cambridge schrieb. 1963 hatte er Joy Doebeli geheiratet, es waren drei Kinder zur Welt gekommen, und obwohl seine Frau ihre berufliche Tätigkeit als Englischlehrerin nie aufgegeben hatte, stellte sich ein Gefühl der Verantwortung für die Familie ein.
In einem Interview, das ich 1971 mit ihm führte, antwortete er auf meine Frage, ob er nicht Lust habe, hauptberuflich zu singen:
»Nein. Ich möchte nicht gerne das Gefühl haben, ich müsste mich morgens um acht Uhr in mein Studierzimmer begeben, um meine Familie zu ernähren und zu diesem Zweck wieder Lieder zu schreiben. Ich bilde mir ein, dass die Lieder, die ich schreibe und die zu schreiben ich mir die Zeit irgendwie nehmen muss, dass das dann wirklich nur die sind, die, von mir aus gesehen, einem Bedürfnis entsprechen.«
Wir können heute froh sein, dass dieses Bedürfnis stärker war als dasjenige, die Fußnoten zu seiner Habilitation zu schreiben.
Es überrascht nicht, dass Mani auch politisch aktiv war. Kaum hatte er das stimmfähige Alter erreicht, trat er dem »Jungen Bern« bei, einer Gruppe, die versprach, politische Probleme allein nach sachlichen Gesichtspunkten anzugehen und Entscheide von Fall zu Fall zu treffen, während bei den großen Parteien meist zum Vornherein klar war, wie sie sich auf Grund ihrer Ideologie zu einer Sache stellten. 1959 gelang dem »Jungen Bern« mit der glanzvollen Wahl des Pfarrers und Schriftstellers Klaus Schädelin der Einzug in die 7-köpfige Exekutive. Der Propagandachef für Schädelins Wahl war Mani Matter. Er selbst wurde bei den Wahlen ins Kantonsparlament 1960 zweiter Ersatzmann und hatte somit reelle Chancen, ein nächstes Mal gewählt zu werden, und von da an ließ er sich nicht mehr aufstellen. Er war aber von 1964 bis 1967 Präsident des »Jungen Bern«.
»mir hei e verein i ghöre derzue« hat Mani Matter gesungen und in diesem Lied von den Schwierigkeiten erzählt dazuzugehören. Als sich nach dem Austritt einiger prominenter Autoren und Autorinnen aus dem Schweizerischen Schriftstellerverein 1970 die »Gruppe Olten« zu bilden begann, war Mani bei einigen der ersten Treffen dabei. Bald debattierte man darüber, ob man einfach eine Gruppe bleiben wolle, wie etwa in Deutschland die Gruppe 47, oder ob man eine Form suchen sollte, in der man auch juristisch handlungsfähig würde, und man fragte den Juristen Mani, ob er so etwas wie Vereinsstatuten entwerfen könne. Das tat er dann, seine klaren und einfachen Statuten überzeugten auch die Hitzköpfe, und so wurde aus der Gruppe ein Verein, der bis zu seiner Wiedervereinigung mit dem Schriftstellerverein 2002 existierte. Später wussten die wenigsten, dass die juristische Fußspur dazu von Mani Matter gelegt worden war.
Ich glaube, vielen Menschen hat Manis Lied vom Verein geholfen, »würklech derzue« zu gehören, auch wenn sie gefragt werden »du lue ghörsch du da derzue?« Letztlich ist die Beschreibung des Vereins nichts anderes als die pluralistische Staatstheorie im Kleinen.
Und neben all diesen Tätigkeiten widmete er sich immer wieder der Nebenbeschäftigung, derentwegen er heute ein Begriff ist, dem Schreiben von Chansons.
Klaus Schädelin hatte einige davon auf Tonband aufgenommen, und wer immer bei ihm vorbeikam, musste sie hören. Einer davon war Guido Schmezer, damals Chef der Abteilung Unterhaltung bei Radio Bern, der Mani daraufhin zu Aufnahmen ins Studio Bern einlud. Am 28. Februar 1960 war Mani Matters Stimme zum ersten Mal am Radio zu hören.
Chansons aus jener Zeit sind etwa »dr ferdinand ischgstorbe«, »i han en uhr erfunde«, »d psyche vo der frou«, »dr herr zehnder«, »dr kolumbus«, »ds rote hemmli«, »ds eisi«, »dr heini«, »ds lotti schilet«. Damit hatte er »es zündhölzli azündt«, dessen Flamme sich rasch weiterverbreitete.
Seine Lieder wurden zunächst in Programmen des Lehrercabarets »Schifertafele« gesungen, und erst 1967 trat Mani Matter regelmäßig selbst auf, zusammen mit Ruedi Krebs, Jacob Stickelberger, Bernhard Stirnemann, Markus Traber und Fritz Widmer, für die Heinrich von Grünigen in einer enthusiastischen Besprechung im »Bund« den Sammelbegriff »Berner Troubadours« geprägt hatte.
Auch bei den Schriftstellern brachte der Gebrauch der gesprochenen Sprache frischen Gegenwartswind. Kurt Marti, der über Mani Matter einen Artikel in der »Weltwoche« schrieb, hatte den Dialekt bereits als Ausdrucksmittel entdeckt, andere wie Ernst Eggimann oder später Ernst Burren kamen dazu, Walter Vogt kreierte dafür das Stichwort »modern mundart«.
1966 veröffentlichte der eben gegründete Zytglogge Verlag Manis erste Schallplatte, die zugleich die erste des Verlags war, Berner Chansons von und mit Mani Matter (später umgeändert in »I han en Uhr erfunde«). 1967 folgte seine zweite Platte, »Alls wo mir i d Finger chunnt«. 1969 publizierte Egon Ammann in seinem »Kandelaber Verlag« das erste Chansonbändchen »Us emene lääre Gygechaschte«, für das Mani im selben Jahr den Buchpreis der Stadt Bern erhielt. 1970 kam seine dritte Platte heraus, »Hemmige«.
Inzwischen war Mani Matter längst zum Begriff geworden. Die Auftritte der »Berner Troubadours« waren überall in der Schweiz ein großer Erfolg. Mani fand es bald fragwürdig, dass sie zu sechst im ganzen Land herumfuhren, wo doch jeder von ihnen ein Repertoire hatte, das weit über den 10- bis 15-Minuten-Auftritt hinausreichte.
So trat er dann vom Herbst 1970 an immer mehr zusammen mit Fritz Widmer und Jacob Stickelberger auf, mit denen er auch ausführlich alle Chansons besprach, und schließlich sang er am 9. Oktober 1971 zum ersten Mal einen ganzen Abend solo seine »Gesammelten Werke«, und zwar im Luzerner Kleintheater von Emil, der ihn durch beharrliche Anfragen so weit gebracht hatte.
Seine Auftritte, in denen er seine »liedli« mit lakonischen Zwischentexten verband, waren überaus erfolgreich, und Mani wurde zum gefragten Einmannkünstler.
Auf der Fahrt nach Rapperswil zu einem seiner Solo-Abende kam er am 24. November 1972 bei einem Überholmanöver auf der Autobahn bei Kilchberg ums Leben. Die Bestürzung über seinen Tod war groß, sie kam einer Landestrauer gleich.
Mani Matter ist in erstaunlichem Maß ein Stück schweizerischer Kultur geworden, ein gemeinsamer Nenner für die unterschiedlichsten Menschen. Kinder sind immer noch und immer wieder für ihn zu begeistern. Mani selbst hat mir einmal gesagt, wie sehr es ihn irritiere, wenn er als Kompliment für seine Lieder zu hören bekomme, das sei noch etwas Unverdorbenes, das man den Kindern mit gutem Gewissen vorsetzen könne. Er habe dann jeweils große Lust, etwas Obszönes und Geschmackloses zu schreiben, nur um die Leute zu verunsichern.
Der Konsens, dass es sich hier um gute Lieder handelt, ist groß, verdächtig groß fast. Heißt das vielleicht, dass sie unverbindlich sind? Kann das überhaupt sein, dass dasselbe Lied den Sänger einer Band, die sich einst als Sprachrohr der Berner Jugendbewegung verstand, Kuno Lauener, ebenso anspricht wie die freisinnige Ex-Bundesrätin Elisabeth Kopp, die in ihrem Buch »Briefe« erwähnte, wie wertvoll ihr Manis Lieder seien? Heißt das nicht, dass sie unverbindlich sind? Kann das sein, dass wir ihn alle lieben, den Poeten und hintersinnigen Kritiker? Oder sagen wir Klavier und meinen Bratwurst, wie in Manis Lied vom Missverständnis? Ob Missverständnis oder nicht, wir müssen es zumindest für möglich halten, und es könnte auch heißen, dass wir alle etwas miteinander zu tun haben, dass die Lieder nicht unverbindlich sind, sondern verbindend. Für Mani selbst hieß ja Zusammenkommen nicht Versöhnung, sondern Gespräch, Kontroverse, Diskussion.
Was er mit ausgelöst hat, nämlich eine Rückeroberung des Dialekts für das Dichten, Denken und Singen, war eine Identifikationshilfe für die Schweizerdeutsch sprechenden Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, eine Möglichkeit, sich als zugehörig zu empfinden, ohne eine Nationalhymne singen zu müssen.
Seine Verse sind eine Einladung zur Einfachheit, kommen leicht und selbstverständlich daher, erwischen uns beim Vertraut-Alltäglichen, bei einer Eisenbahnfahrt (»ir ysebahn«), beim Gang auf eine Amtsstelle (»är isch vom amt ufbotte gsy«), bei der Münzsuche vor einem Parkingmeter (»dr Parkingmeter«), und schicken uns dann in philosophische Labyrinthe. »ir ysebahn« etwa ist nicht nur ein komisches Lied, sondern auch ein Lied über die Möglichkeiten unserer Erkenntnis, über die schon Kant nachgedacht hat, und über das Konfliktpotential, das darin enthalten ist. »dene wos guet geit« ist verkappte und verknappte Soziologie.
Er ist den Fremdwörtern nicht ausgewichen, hat etwa dem Anglizismus »Sändwich« ein ganzes Lied gewidmet, dessen Schlussvers vom Wort »Dialäktik« gekrönt wird, im Coiffeursalon hat ihn »es metaphysischs Grusle« gepackt, als er sich in den Spiegeln zu einem Männerchor vervielfältigt sah. Diese vorbehaltlose Offenheit gegenüber der Sprache, diese Nähe zum Leben ließ seine Lieder bis heute nicht altern.
Er sagte einmal in einem Vortrag, die einzige Tradition, an die er habe anknüpfen können, sei das »Lumpeliedli«, und »Versueche, es poetischs Chanson z mache, sy völlig fählgschlage«. Er war stets auf der Suche nach dem poetischen Chanson, so sehr, dass er gar nicht bemerkte, wie viele davon er schon zustande gebracht hatte, von »us emene lääre gygechaschte« über »ds lied vo de bahnhöf« oder »di strass, won i drann wone« bis zum »noah«.
Aber er suchte mehr als das, einen neuen Ton, der das Gelände des Witzes und der Ironie gänzlich hinter sich lassen würde. Zwei seiner letzten Lieder sind Zeugnis dafür. Vom einen, »nei säget sölle mir«, gibt es eine Piratenaufnahme eines Auftritts im Berner »Bierhübeli«, auf der deutlich zu hören ist, wie das Publikum zuerst lacht und dann auf einmal verstummt, weil es seinen alten Mani nicht wiederfindet. Und mit »warum syt dir so truurig?«, ein Lied, zu dem es acht verschiedene Entwurfsseiten mit immer wieder neuen Wendungen und Textanordnungen gibt, ist er in diesem neuen Ton angekommen – es ist für mich das Ergreifendste, was er geschrieben hat.
Und dann die Musik. Auch hier macht man die Feststellung, dass sie zwar einfach, aber nicht simpel ist. Sie orientiert sich häufig an der Melodie, welche den Wörtern selbst bereits innewohnt. Anfänge wie »das isch ds lied vo de bahnhöf«, »wär würd gloube, dass dr heini« oder »nei säget sölle mir« schieben die Wortmelodie nur ein kleines bisschen ins Musikalische hinüber, und schon wird sie zu einem Lied. Seinen Begleitfiguren auf der Gitarre wird man mit dem abschätzigen Hinweis auf die drei berühmten Griffe, die es für ein Lied braucht, nicht gerecht, man höre sich nur etwa den »bärnhard matter« oder »i han en uhr erfunde« an. Aber Mani beschränkt sich immer auf ein Minimum. So genügt ihm in »farbfoto« der Dreivierteltakt, das Wälzerchen, um die Sentimentalität des Werbefotos, das er beschreibt, auch hörbar zu machen.
In den späten achtziger Jahren fingen »Züri West« an, auf jeder ihrer Platten ein Lied von Mani in einer Rock-Fassung einzuspielen. »dynamit« klang, als sei es für sie geschrieben. Mühelos passen sich viele von Manis Liedern dem Rock-Rhythmus an, oder der Rock-Rhythmus passt sich ihnen an und lässt ihre anarchistische Seite stärker aufleuchten, oder auch ihre poetische, wie im »heiwäg« oder in Stephan Eichers Version von »hemmige«.
Bei Stephan Eichers Konzerten in Frankreich sang das Publikum jeweils den Refrain von »hemmige« mit. Als ich das im »Olympia« in Paris erlebte, sah ich in Gedanken Mani lächeln, mit der Maurice Chevalier-Platte seines Onkels unter dem Arm.
Als die CD »Matter-Rock« entstand, wurde Manis »warum syt dir so truurig?«, das es nicht mehr von ihm selbst gesungen gibt, durch Polo Hofer interpretiert. Er sagte mir nachher, sie hätten lange gewerweißt, ob er »warum« auf der ersten Silbe betonen solle (so hatte es Mani noch auf seinem Manuskript notiert, als Lied im 3/4 -Takt) oder auf der zweiten, als Auftakt zu einem 4/4-Takt, was er schließlich vorzog, da es ihm besser lag. Das ist typisch für Manis Melodien, dass eben beides geht. Wichtig war ihm die natürliche Sprechweise.
Worauf ich nicht mehr eingehen kann, sind Mani Matters literarische Arbeiten, die nichts mit den Chansons zu tun hatten. Seine hochdeutschen Kurzgeschichten, Aphorismen, Einakter, Gedichte, philosophischen Betrachtungen und Tagebuchnotizen kamen erst nach seinem Tod heraus, in den Büchern »Sudelhefte« (Benziger, 1974) und »Rumpelbuch« (Benziger, 1976), deren Titel noch von ihm selbst stammten, später kamen zwei weitere dazu, »Das Cambridge Notizheft« (Zytglogge, 2011) und »Was kann einer allein gegen Zen Buddhisten« (Zytglogge, 2016). Es sind Fundgruben voller Überraschungen, die von Manis intellektueller Brillanz, aber auch von der Neugier auf andere Formen zeugen.
Sein Libretto »Der Unfall«, ein Madrigalspiel für 10 Mitwirkende, erzählt in der Ich-Form von einem, der überfahren wurde.
»ich bin überfahren worden, weil ich unachtsam war.
unachtsam war ich, weil ich an etwas anderes dachte.
ich dachte daran, es sei schade, dass ich
kein musiker bin.«
Er schrieb den Text für seinen Freund, den Komponisten Jürg Wyttenbach, der mit der Vertonung schon ziemlich weit war, als Mani tödlich verunfallte. Danach war Wyttenbach nicht mehr in der Lage, mit der Komposition weiterzufahren. Er brauchte über 40 Jahre, um die Arbeit daran wieder aufzunehmen, und das Stück wurde 2015 an den Luzerner Musikfestwochen uraufgeführt.
Durch die Heiterkeit und den verspielten musikalischen und textlichen Witz des Werks leuchtet immer wieder die große Trauer über Mani Matters Tod, der vermutlich auf der Autobahn an etwas anderes gedacht hatte.
Wolf Biermann
Wolf Biermann ist wahrscheinlich einer der meistbesuchten Menschen in Ostberlin gewesen. Er galt dort als »staatlich anerkannter Staatsfeind«, wie er sich selbst bezeichnete, und für westliche DDR-Beschreiber war eine Biermann-Visite als Bestandteil einer Informationsreise fast obligatorisch. Er sagte einmal, er hänge jetzt dann, wenn er ungestört sein wolle, eine Tafel vor die Tür mit der Aufschrift »Heute keine Besichtigung«.
Eine solche Tafel hätte er aber kaum für ostdeutsche Besucher aufgehängt, und diese waren bedeutend zahlreicher als die aus dem Westen. Für sie war die Chausseestraße 131, in der Biermann eine Zwei-Zimmer-Wohnung behauste, eine Adresse, an die man sich wenden konnte, wenn man eine Ermutigung brauchte. Ein Sänger von seiner Qualität und Bedeutung wäre in einem Land, in dem man sich freier bewegen kann, fast dauernd irgendwo unterwegs. Biermann aber, infolge der ihm auferlegten Zwangsruhe, war fast immer zu Hause, und so stellten sich Leute bei ihm ein, die ihn um Rat fragten, die etwas zu erzählen hatten, die ein Buch oder ein Tonband haben wollten, Leute auch, die ihm etwas vorlesen oder vorsingen wollten oder sich von ihm etwas vorlesen oder vorsingen lassen wollten. Ich habe keinen Besuch bei Biermann erlebt, bei dem nicht auch jemand anderes hereinschaute, und meistens griff er nach einiger Zeit zur Gitarre, trug ein paar seiner neuen Lieder vor und wollte von den Anwesenden wissen, was sie davon hielten.
Was sich um Biermann gruppierte, war ein Freundeskreis von Studenten, Literaten, Malern und Musikern. Solche Freundeskreise um lebendige und starke Menschen gibt es bei uns auch, das ist nichts Ungewöhnliches, aber ich hatte immer das Gefühl, die Leute, die bei Biermann verkehrten, seien stärker aufeinander angewiesen, als man das bei uns ist, und sie bräuchten ihren Biermann dringend, als Bestätigung, dass man auch leben kann, wenn man behindert wird, dass man auch denken kann, wenn Anpassung verlangt wird, als Bestätigung, dass Leben überhaupt möglich ist.
»Wie sollen die Leute bloß leben? Ist man da bei Ihnen schon ein bisschen weiter?« fragte mich Biermann einmal. Seine Existenz war für viele eine Antwort auf die Frage, wie man leben soll. Manche seiner ostdeutschen Kollegen fanden Biermanns Antwort allerdings nicht richtig, fanden, er bekäme zu viel Applaus von der falschen Seite und gefalle sich in einer Starrolle.
Ich hatte diesen Eindruck nie, mir kam es immer so vor, als ob die Leute zu Biermann hereinkämen, um sich ein bisschen zu wärmen. Erstaunt bemerke ich, dass ich ständig in einem nekrologischen Imperfekt schreibe, und tatsächlich: auch wenn sie ihn noch ab und zu übers westdeutsche Fernsehen oder Radio hören können – für die Menschen in Ostberlin muss es sein, als ob Biermann tot wäre.
Ernst Kunz
Da kommt er!
Da schiebt er sich vorwärts.
Da schleppt er sich dahin.
Das eine Bein ist kürzer als das andere, mehr als das, missgebildet, es endet mit einem Klumpfuß in einem Spezialschuh, der mit seiner kothurnartigen Sohle die Länge des Beines dem andern angleicht. Diesen schweren Unfuß muss er jedoch ständig etwas hinter sich herziehen. Die Mutmaßungen über dessen Ursprung gehen weit auseinander, von einer Kinderlähmung bis zu einem Hundebiss beim Fensterln.
Ein Stock mit silbernem Knauf hilft ihm beim schwankenden Gang.
In der andern Hand immer die Mappe.
Und immer in einem dunklen Anzug.
Die strähnigen, glatten Haare kühn nach hinten gekämmt, etwas länger als der übliche Durchschnitt.
Da kommt er, von der Schöngrundstrasse her, ins Hübeli-Schulhaus, zum Gesangsunterricht für die fünfte Gymnasialklasse, in welcher nur noch zehn Schüler übrig geblieben sind, die den strengen Anforderungen der strengen Lehrer dieser strengen Schule genügen konnten, die andern haben sich auf Internate, Seminarklassen und Handelsschulen verteilt.
Da kommt er durch das Hauptportal, arbeitet sich die Treppe hoch in den ersten Stock, zum Singsaal.
Dort setzt er sich an den Flügel und singt mit den zehn Burschen und Mädchen Lieder von Schubert, »Ich hört ein Bächlein rauschen«, »Am Brunnen vor dem Tore«, »Schad um das schöne grüne Band«, und er macht uns aufmerksam auf die Strukturen und Harmonien dieser Lieder, zeigt uns, warum aus dem Bächlein mit der perlenden Begleitung kein Volkslied werden konnte, wohl aber aus dem Brunnen vor dem Tore, macht uns mit dem Dichter Wilhelm Müller bekannt, von dem wir im Deutschunterricht weder vorher noch nachher etwas hören werden und den er als Schuberts Textlieferant in Ehren hält, er singt mit uns, oder wir singen mit ihm Schumanns »unglückliche Grenadiere«, und seither kennen wir die Marseillaise, denn sie ist in die Begleitung eingewoben, und die Mädchen in der Klasse schütteln den Kopf über die Zeile »Was schert mich Weib, was schert mich Kind«, doch die Burschen schaudert es beim Gedanken von der Schildwach’ im Grabe, über die auf einmal der Kaiser reitet, den es zu schützen gilt, warum ihn, warum nicht Weib und Kind, fragen die Mädchen voller Verachtung für den irregeleiteten Idealisten, dann singen wir auch das Lied von den zwei Gesellen, die strebten nach hohen Dingen, und wem sie vorübergingen, dem lachten Sinne und Herz. Der erste fand ein Liebchen und wiegte gar bald ein Bübchen, dem zweiten sangen und logen verlockend Sirenen und zogen ihn in die buhlenden Wogen, und sein Schifflein, das lag im Grund, und am Ende des Liedes lässt der Gesangslehrer seine Hände einen Moment auf den Knien ruhen und erzählt etwas aus seinem Leben, nämlich wie er kürzlich einen alten Bekannten getroffen habe und ihn unter anderem nach seinem Sohn gefragt habe, und da habe ihm der andere bedauernd geantwortet: »Ach wissen Sie, der ist jetzt Barpianist.«
So schlimm fanden wir das zwar nicht, doch damit hat er klare Werte gesetzt, unser Gesangslehrer, der mehr war als Gesangslehrer, nämlich Musikdirektor, Musikdirektor der Stadt Olten, das war sein Titel, ein Titel, den es schon lang nicht mehr gibt, und unter diesem Titel war ihm sozusagen die musikalische Pflege der Kleinstadt anvertraut, er war Dirigent des Gesangvereins, er war Dirigent des Stadtorchesters und hatte das Ansehen der Stadt als Hort der Musik hochzuhalten, durch Konzerte zum Beispiel, in denen die musikalischen Kräfte der Provinz gebündelt auftraten.
Mit vierzehn Jahren durfte ich, der ich Cello lernte, zum ersten Mal im Stadtorchester mitwirken, der Anlass war die 75-Jahr-Feier des Schweizerischen Vereinssortiments, so hieß das Buchzentrum damals. Wir spielten auf der Bühne des Stadttheaters das dritte »Brandenburgische Konzert« von Bach, in dem der Bass-Linie eine emine