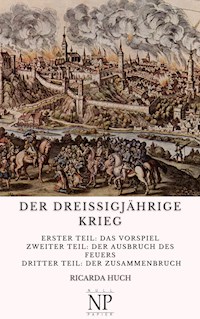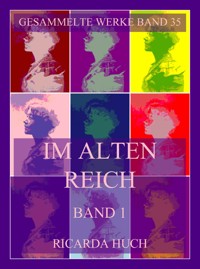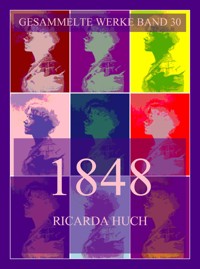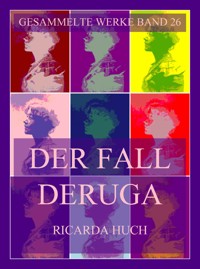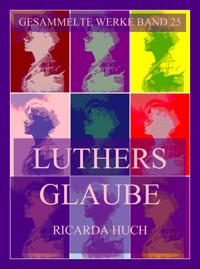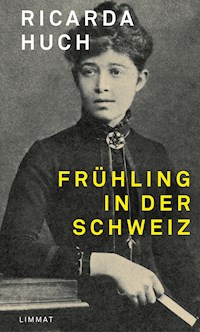
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limmat Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1887 kam Ricarda Huch mit 22 Jahren nach Zürich, wo den Frauen die Universität offenstand. Sie legte die Maturaprüfung ab, studierte Geschichte, wurde 1891 promoviert und unterrichtete danach an der Höheren Töchterschule, arbeitete in der Stadtbibliothek. «Frühling in der Schweiz» ist ein hinreissendes Zeugnis des «Frauenstudiums» in Zürich. Huch bezog ein Zimmer bei der so freundlichen wie skurrilen und unglücklich verheirateten Frau Wanner in der Gemeindestrasse. Zu den endlos debattierenden Russinnen an der Universität ging sie auf Distanz, befreundete sich aber mit anderen akademischen Pionierinnen: Marianne Plehn wurde später zu einer der ersten Professorinnen der Naturwissenschaften in Deutschland, Agnes Bluhm wurde zu einer der ersten praktizierenden Ärztinnen in Berlin, Marie Baum spielte als Soziologin und Sozialpolitikerin in der Frauenbewegung der Weimarer Republik eine wichtige Rolle. Daneben vermittelt «Frühling in der Schweiz» ein anschauliches Bild der Zürcher Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist eine grosse Liebeserklärung an Zürich und die Schweiz, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Konflikts Ricarda Huchs mit der Gestapo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
1887 kam Ricarda Huch mit 22 Jahren nach Zürich, wo den Frauen die Universität offenstand. Sie legte die Maturaprüfung ab, studierte Geschichte, wurde 1891 promoviert und unterrichtete danach an der Höheren Töchterschule, arbeitete in der Stadtbibliothek.
«Frühling in der Schweiz» ist ein hinreißendes Zeugnis des «Frauenstudiums» in Zürich. Huch bezog ein Zimmer bei der so freundlichen wie skurrilen und unglücklich verheirateten Frau Wanner in der Gemeindestraße. Zu den endlos debattierenden Russinnen an der Universität ging sie auf Distanz, befreundete sich aber mit anderen akademischen Pionierinnen: Marianne Plehn wurde später zu einer der ersten Professorinnen der Naturwissenschaften in Deutschland, Agnes Bluhm wurde zu einer der ersten praktizierenden Ärztinnen in Berlin, Marie Baum spielte als Soziologin und Sozialpolitikerin in der Frauenbewegung der Weimarer Republik eine wichtige Rolle.
Daneben vermittelt «Frühling in der Schweiz» ein anschauliches Bild der Zürcher Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und ist eine große Liebeserklärung an Zürich und die Schweiz, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Konflikts Ricarda Huchs mit der Gestapo.
Ricarda Huch, geboren 1864 in Braunschweig, studierte und arbeitete von 1887 bis 1896 in Zürich, wo sie auch zu publizieren begann. 1926 wurde sie als erste Frau in die Preußische Akademie der Künste gewählt, aus der sie 1933 unter Protest austrat. 1937 wurde sie denunziert, vor dem Hintergrund der Ermittlungen gegen sie erschien «Frühling in der Schweiz» 1938 im Zürcher Atlantis Verlag.
Foto Ayṣe Yavaṣ
Ute Kröger lebt als freie Publizistin in Kilchberg ZH. Im Limmat Verlag sind Werke über Else Lasker-Schüler, Erika Mann sowie Gottfried Semper lieferbar, die literaturgeschichtlichen Standardwerke «Zürich, du mein blaues Wunder» und «Nirgends Sünde, nirgends Laster» sowie «Vreneli’s Gärtli» von Oskar Panizza (herausgegeben und mit einem Nachwort von Ute Kröger).
RICARDAHUCH
FRÜHLINGIN DERSCHWEIZ
JUGENDERINNERUNGEN
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Ute Kröger
Inhalt
Frühling in der Schweiz
« … WEIL ES EBEN FRÜHLING UND HELL SEIN SOLLTE. »
I.
II.
III.
IV.
V.
LITERATUR (THEMATISCHE AUSWAHL)
ARCHIVALIEN
BILDNACHWEIS
Am Abend des 1. Januar 1887 kamen wir, mein Bruder und ich, in Zürich an und stiegen im Hotel Bellevue am See ab; es war noch das alte Haus, kleiner und stilvoller als das jetzige. Beim Abendessen saß eine Gesellschaft von Herren und Damen uns gegenüber – denn man speiste an der table d’hôte –, die sich sehr lebhaft und lustig unterhielten in einer Sprache, von der ich kein einziges Wort verstand. So viel konnte ich unterscheiden, dass es keine von den bekannten westeuropäischen Sprachen war, auch eine slawische schien es mir nicht zu sein. Während ich darüber nachdachte, kam es mir vor, als ob einer der Herren einen mongolischen Typus habe. Sollten sie kalmückisch oder tatarisch sprechen? Wahrscheinlich war das bei ihrem durchaus europäischen Aussehen und Verhalten nicht. Später erfuhr ich, dass kurz vorher in den sogenannten Escherhäusern am Zeltweg ein Brand ausgebrochen war und dass die davon Betroffenen bis zur Ausbesserung der in ihren Wohnungen entstandenen Schäden ins Hotel gezogen waren. Sie sprachen ihr angestammtes Zürichdeutsch, das mir bald so vertraut klingen sollte. Dem Herrn mit dem mongolischen Typus bin ich noch oft am Zeltweg auf dem Wege zur Universität begegnet.
Am folgenden Morgen suchten wir ein Zimmer für mich, und gleich das erste, das wir ansahen, gefiel mir; im Grunde mehr als das Zimmer die Wirtin. Sie hieß Frau Wanner, und das Haus, das sie bewohnte, war ihr Eigentum. Es lag an der Gemeindestraße, war von einem damals verschneiten Gärtchen umgeben und hatte die Nummer 25. Frau Wanner hatte ein rasches Wesen und ein lustiges Zwinkern in den Augen; ich war sofort überzeugt, dass wir uns verstehen würden. Nachdem mein Bruder abgereist war, der mich nur begleitet hatte, weil es nicht passend schien, dass ein Mädchen von zweiundzwanzig Jahren die weite Reise von Braunschweig nach Zürich allein machte, bezog ich die beiden Zimmer, die ich gemietet hatte. In der ersten Nacht erwachte ich durch ein Geräusch von Schritten, Rascheln, Klappern und Trampeln im Nebenraum. Ich lauschte eine Weile, ohne dass es aufhörte, und es wurde mir unbehaglich. Noch gar nicht orientiert in dem fremden Hause, konnte ich nicht wissen, wer nebenan hauste und was da getrieben wurde. Zwar sagte ich mir, dass Einbrecher oder sonst Leute mit bösen Absichten sich hüten würden, so viel Lärm zu machen; aber ein Angstgefühl und die dunkle Erinnerung an das Wirtshaus im Spessart ließen sich doch nicht verscheuchen. So nahm ich denn mein Kopfkissen und mein Deckbett und richtete mich auf einem Diwan in meinem Wohnzimmer ein, das, wie ich bemerkt hatte, an das Schlafzimmer der Frau Wanner stieß. Dass sie nicht mit in dem etwaigen Komplott war, nahm ich bestimmt an. Als ich ihr am anderen Morgen mein Erlebnis erzählte, lachte sie und klärte es folgendermaßen auf: Sie finde es unpraktisch, sagte sie, täglich das gebrauchte Essgeschirr aufzuwaschen, warte vielmehr damit, bis kein sauberes Stück mehr vorhanden sei; dann lohne es sich. Inzwischen schichte sie die gebrauchten Teller und Schüsseln in der Speisekammer auf, die an mein Schlafzimmer grenzte, und die Essenreste, die etwa daran wären, lockten natürlich die Mäuse herbei. Das Tanzen und Springen derselben zwischen den Tellern hatte das mir so unheimliche Geräusch verursacht. Ich war über diese Art des Haushaltbetriebes maßlos erstaunt, aber Frau Wanner, die mir das so unbefangen auseinandersetzte, gefiel mir im Grunde umso mehr. Nach zwei oder drei Tagen erzählte sie mir, meine Vorgängerin in der Wohnung sei eine Sängerin am Pfauentheater gewesen. Es handelte sich um den alten «Pfauen», ein unansehnliches Haus am Heimplatz, in dem, wenn ich mich recht erinnere, auch von recht unansehnlichen Kräften Operetten gespielt wurden. Diese Sängerin, ein sehr nettes Mädchen, sei die Geliebte eines rumänischen Studenten, der sich nach ihrer Abreise verlassen und unglücklich fühle; ob ich nicht ihre Nachfolgerin bei ihm werden wolle? Als ich mein Erstaunen über diesen Vorschlag äußerte, sagte sie, ich sei doch auch mit einem Geliebten gekommen; als ob das, wenn es sich so verhalten hätte, sie zu ihrer Zumutung berechtigt hätte. Ich sagte, das sei mein Bruder gewesen, ich hätte ihn ihr doch vorgestellt! Jawohl, sagte sie lachend, aber so etwas glaube man doch nicht. Weder nahm ich Frau Wanner ihre Einstellung, noch nahm sie mir meine schroffe Ablehnung des rumänischen Studenten übel, den abzulehnen es übrigens keines Aufwandes von Tugend bedurft hätte; im Gegenteil, als sie sich überzeugt hatte, dass ich nichts wollte als arbeiten und wirklich vom Morgen bis zum Abend arbeitete, ging ihre Zuneigung zu mir in eine fast leidenschaftliche Liebe über. Sie tat, was sie konnte, um es mir behaglich zu machen. Ich verstand nicht, die Petroleumlampe zu behandeln, da wir zu Hause Gas brannten, und ich überhaupt nicht gewöhnt war, irgendetwas im Hause zu tun, sie zeigte es mir, und als sie sah, wie mich das Petroleum ekelte, besorgte sie die Lampe regelmäßig für mich. Sogar dazu ließ sie sich herbei, für mich zu Mittag zu kochen.
Auf irgendeine Empfehlung hin war ich die ersten Tage zum Essen in das Zunfthaus zu den Zimmerleuten gegangen. Noch sehe ich den großen schwarzbärtigen Wirt vor mir, der grüßend von Tisch zu Tisch ging; ein biederer alter Herr und ein junger Engländer namens King, mit dem ich einige Male Schlittschuh gelaufen bin, wurden neben mich gesetzt. Obwohl mir alle mit Freundlichkeit, Rücksicht und Respekt begegneten, hatte ich doch den Eindruck, dass ich auffiel, weil es nicht Sitte war, dass einzelne Damen dort zu Mittag aßen. Ich war deshalb Frau Wanner sehr dankbar, dass sie sich zwar nicht verpflichtete, mir täglich etwas zu kochen, aber durchblicken ließ, dass sie es meistens tun werde. Sie durchbrach damit ihre Grundsätze; sie war nämlich der Meinung, es sei etwas Jämmerliches, dass die Menschen jeden Mittag zur bestimmten Stunde ihr Essen vorgesetzt haben wollten, gewissermaßen eine Verkommenheit des Spießbürgers, man solle dann essen, wenn man gerade Hunger hätte, und auch nicht viel Zeit mit den Vorbereitungen dazu verlieren. Obwohl ich nicht ohne Verständnis für diese Lebensauffassung war und selbst nicht dazu neigte, die Äußerlichkeiten des Lebens allzu wichtig zu nehmen, wusste ich ihr doch auch etwas zu entgegnen. Gerade weil wir, meine Geschwister und ich, sehr frei aufgewachsen waren, fast ohne andere Erziehung, als die Atmosphäre des Hauses und das Beispiel der Angehörigen bewirkte, hatte ich mir die wenigen Lebensregeln, die mir, meist von meiner geliebten Großmutter ausgehend, gegeben wurden, fest eingeprägt, und dazu gehörte die, dass eine bestimmte Einteilung der Beschäftigungen des Tages dem Leben ein Gerüst verleihe, das für die Menschen gut und eigentlich notwendig sei; wer sich einen Stundenplan setze und daran halte, könne mehr leisten als ein anderer. Diese Regel hatte sich mir so eingefleischt, dass es mich heute noch beunruhigt, wenn meine Mittagsruhe sich über drei Uhr erstreckt, weil sie zu Hause von zwei bis drei angesetzt war. Da ich außerdem um die Mittagszeit hungrig und nach angestrengter Arbeit einer Pause bedürftig war, konnte ich Frau Wanners Lebensanschauung, abgesehen von der Theorie auch mit augenscheinlich einleuchtenden Gründen, zu erschüttern suchen. Zu alledem konnte ich mir sagen, dass tägliches Kochen zu einer bestimmten Stunde auch Frau Wanner selbst und ihrer Familie zugutekommen würde.
Frau Wanner hatte vier Söhne, zwei von etwa fünfzehn und vierzehn, zwei kleine von etwa vier und drei Jahren. Von dem ersten Paar war der ältere blond und etwas derb, dem Vater nachschlagend, der zweite dunkel und feiner, der Mutter ähnlich; und dieselbe Verteilung wiederholte sich bei dem zweiten.
Mit dem Vater dieser Kinder, dem Gymnasiallehrer Wanner, hatte es eine besondere Bewandtnis, von der seine Frau mich bald in Kenntnis setzte. Sie konnte ihn durchaus nicht leiden und wünschte, von ihm geschieden zu werden, was aber doch nicht so leicht zu bewerkstelligen war; inzwischen hatte sie ihn in das obere Stockwerk ihres Hauses gesteckt, wo er allein und begreiflicherweise sehr übler Laune hauste. Für ihn zu kochen, weigerte sie sich entschieden. Er ernährte sich infolgedessen hauptsächlich mit kaltem Aufschnitt, Schinken, Wurst und dergleichen, weswegen sie ihn, Spott zum Schaden fügend, den Wurstlackel nannte. Sie gab ihm nie eine andere Bezeichnung, wenn sie von ihm sprach. Von dem ersten Söhnepaar hielt der ältere zum Vater, der jüngere zur Mutter, die Kleinen waren noch zu jung, um etwas davon zu begreifen. Anfänglich versuchte ich schon um der Kinder willen, im versöhnenden Sinne zu wirken. Ich ermunterte zum Beispiel zu Familienspaziergängen am Sonntagnachmittag, wozu Frau Wanner sich bereit erklärte unter der Bedingung, dass ich mitginge. Die Kleinen waren hocherfreut über diese gemeinsamen Unternehmungen, aber für mich war es ein heikles Vergnügen, denn ich musste beständig auf einen Ausbruch der Feindseligkeit gefasst sein und versuchen, geistesgegenwärtig vorzubeugen oder abzulenken. Indessen mussten diese gefährlichen Ausflüge bald wieder aufgegeben werden. Der Bruch war infolge von Frau Wanners Abneigung, ja Hass, unheilbar. «Möchten Sie ihn haben?», fragte sie mich streng, als ich ihr wieder einmal gut zugeredet hatte. Da ich ehrlicherweise nicht behaupten konnte, ich möchte ihn haben, hielt sie sich für gerechtfertigt.
Liebe Frau Wanner! Dass sie Frau eines Gymnasiallehrers und Tochter eines Herrn Schoch war, der im Appenzellerland, ich glaube in Trogen, eine viel besuchte Erziehungsanstalt geleitet hatte, überraschte mich sehr, als ich es erfuhr; ich hatte sie für eine Frau aus dem Volke gehalten. Ihr Gesicht war schmal und feingeschnitten, aber es tat ihrem guten Aussehen Abbruch, dass ihre Haut infolge von häufigem Biergenuss fleckig gerötet war. Sie hatte sich, wie ich glaube, das Biertrinken dadurch angewöhnt, dass sie es für die bequemste Art der Ernährung hielt. Für ihre Kinder sorgte sie gut, soweit ich es beurteilen konnte, wenn auch vielleicht etwas summarisch. Sie hatte einen guten Verstand und war nach Appenzeller Art immer mit witziger Rede bei der Hand; gegen die, welche sie nicht leiden mochte, konnte sie scharf, sogar grausam sein.
Zu diesen gehörte ein Landsmann von ihr, der schon längere Zeit bei ihr wohnte, Oskar Kellenberg. Er studierte die Rechte und ließ sich dabei mehr Zeit als üblich, da er vermutlich dachte, er werde lange genug in Walzenhausen oder sonst wo im Appenzellerland Fürsprech sein und wolle einstweilen die Studienjahre in Zürich gründlich auskosten. Frau Wanner, die Raschheit und Tätigkeit liebte, rechnete ihm das als Trägheit an, umso mehr, als er spät aufzustehen pflegte. Immerhin hatte sie ihn mit leidlich guter Miene geduldet, bis er sich in mich verliebte. Die glücklichen Zwanzigjährigen! Ein magisches Rosenlicht umspielt sie und berückt die davon angehaucht werden. An diesem Frühlingszauber hatte ich damals teil und nahm als etwas Selbstverständliches, ja fast ohne es zu merken, hin, dass man mir Liebe entgegenbrachte; war ja auch mein Herz empfänglich für alles, was ich sah und erlebte. Frau Wanner hatte es im Allgemeinen gern, wenn ein junger Mann mich verehrte, und sagte dann mit Heranziehung eines Ausdrucks, der in Zürich von dem jungen, in Gärung befindlichen Wein, dem Sauser, gebräuchlich ist: Er ist im Stadium oder er ist im Ricarda-Stadium. Es erfüllte sie mit Befriedigung wie eine ihr selbst dargebrachte Huldigung, solange ich mir aus dem Betreffenden gar nichts machte. Nun erwiderte ich zwar Kellenbergs Neigung nicht, hatte ihm auch gesagt, dass ich gebunden sei und ihn keinesfalls heiraten werde; aber ich konnte ihn gut leiden, unterhielt mich mit ihm über manche Dinge, die Frau Wanner nicht interessierten, und nahm es gern an, wenn er mich sonntags auf größeren Ausflügen begleitete, die ich allein nicht hätte unternehmen können. Dadurch wurde ihre Eifersucht gereizt, sie fasste einen immer lebhafteren Widerwillen gegen ihn und verfolgte ihn mit spitzigen Bemerkungen, die ihn zum Ausziehen veranlassen sollten. Dass er sich mit stoischer Gleichgültigkeit gegen ihre Pfeile panzerte und tat, als fühle er sie gar nicht, brachte sie umso mehr gegen ihn auf.
Wenn Frau Wanner anderen meinen Fleiß als Vorbild anpries, so durfte ich das Lob als wohlerworben betrachten. Ich pflegte spätestens um sieben Uhr aufzustehen; oft spielte mir Frau Wanner dann einen Walzer – stramm aufrecht in der Haltung einer eifrigen Schülerin saß sie am Klavier –, und ich tanzte dazu. Dann arbeitete ich mit kurzen Pausen bis Mitternacht. Ich hatte mir ein Jahr gesetzt, um mich auf die Maturitätsprüfung vorzubereiten, und musste mich anstrengen, wenn ich das Ziel erreichen wollte. Nicht nur, dass ich von Latein und Mathematik noch gar nichts wusste, ich musste auch in allen übrigen Fächern meine Kenntnisse von Grund aus aufbauen. Zum Beispiel hatte ich viel gelesen, kannte Don Carlos, Wallenstein, Faust zum Teil auswendig; aber ich wäre nicht imstande gewesen, von diesen Dramen oder irgendeinem anderen eine ausreichende Inhaltsangabe zu machen. Für das Tatsächliche hatte ich überhaupt nicht viel Sinn. Bei dem mir angeborenen Hang für die Historie hatte ich ziemlich viel Geschichtswerke gelesen; aber ich liebte die Geschichte als den farbigen Strom des Geschehens, aus dem große Persönlichkeiten auftauchten, die ich kämpfen und siegen oder unterliegen sah, als den Stoff, in den meine Fantasie hineingriff, um ihn dramatisch zu gestalten, und merkte mir nur, was mich in Bezug darauf interessierte; viel zuverlässige Kenntnisse hatte ich nicht. Alles, was ich etwa wusste, langte nicht, um Examensfragen zu beantworten. Sogar in Hinsicht auf moderne Sprachen, in denen ich guten Unterricht gehabt hatte, musste mindestens das Gedächtnis wieder aufgefrischt werden.
Im Lateinischen unterrichtete mich ein Professor am Gymnasium, ich glaube, er hieß Walder, ein etwas humorloser, griesgrämlicher Mann, der mit Misstrauen an die Sache heranging, weil er nicht glaubte, das erforderliche Pensum werde sich in so unverhältnismäßig kurzer Zeit bewältigen lassen; als er sah, dass ich schnell Fortschritte machte, wurde er freundlicher und hatte schließlich wohl annähernd so viel Freude an den Stunden wie ich. Vor der Mathematik hatte ich mich gefürchtet: Ich bildete mir ein, das sei etwas, was nur Männer könnten. Leider habe ich den Namen des jungen Mannes, eines Seminaristen, vergessen, der mich in Algebra, Geometrie, Physik, kurz, in allen mit der Mathematik zusammenhängenden Fächern unterrichtete. Er besaß die Gabe, sich in die Geistesverfassung eines völlig Unkundigen hineinzuversetzen und beantwortete mit Geduld und Klugheit die vielen Fragen, die ich stellte, bis ich die Art des mathematischen Denkens erfasst hatte. Dann ging es auf einmal spielend, und ich arbeitete auf diesem Gebiet, von dem ich alles ganz und gar bis auf den letzten Zipfel vergessen habe, mit besonderer Vorliebe. Naturwissenschaftlichen Unterricht hatte ich bei Herrn von Beust. Der Vater der Brüder Beust war ein 48er-Flüchtling gewesen und hatte in Zürich eine Schule nach damals neuen Grundsätzen eingerichtet, die gut besucht wurde. Nach seinem Tode führte der eine Sohn sie weiter, eben der, bei welchem ich Stunden nahm. Er war ein stattlicher blonder, unverheirateter junger Mann; wenn ich kam, öffnete mir jedes Mal seine Mutter die Tür, rücksichtsvoll ihre Gegenwart andeutend.