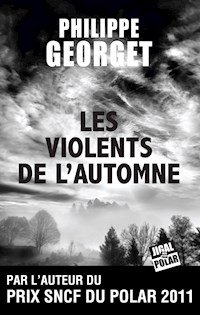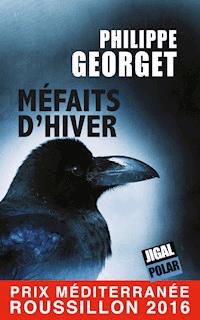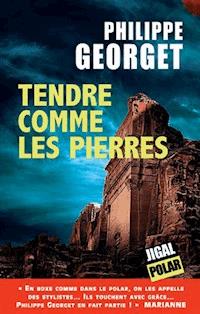9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Karfreitag in Perpignan. Siebenhundert »Büßer« defilieren wie jedes Jahr seit dem 15. Jahrhundert in ihren traditionellen Gewändern durch die Gassen. Plötzlich bricht Panik aus. Als wieder Ruhe einkehrt, liegt einer der Gläubigen blutüberströmt am Boden. Er wurde offenbar erdolcht. Gleichzeitig wurde ein Juweliergeschäft ausgeraubt. Hängen die beiden Fälle zusammen? Lieutenant Sebag, der eigentlich mit seinem pubertierenden Sohn kämpft, ermittelt in den mediterranen Gassen der Stadt und stößt dabei auf die verschwiegene Seite einer französischen Legende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frühling lässt sein schwarzes Band
Der Autor
PHILIPPE GEORGET wurde 1963 geboren. Nach mehreren Jahren als Journalist für Rundfunk und Fernsehen hat er 2001 seine Familie in einen Campingbus gepackt, um einmal mit ihr das Mittelmeer zu umrunden. Seit seiner Rückkehr lebt er als Autor mit Frau und Kindern in der Nähe von Perpignan und läuft leidenschaftlich gern Marathon. Für seine Krimis hat er in Frankreich mehrere Preise gewonnen.
Philippe Georget
Frühling lässt sein schwarzes Band
Ein Südfrankreich-Krimi
Aus dem Französischen von Barbara Ostrop
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage April 2023© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023© Editions JIGAL, 2019All rights reservedDie französische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Une ritournelle ne fait pas le printemps Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, MünchenAutorenfoto: © JC BadinierE-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten. ISBN 978-3-8437-2935-2
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Epilog
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
1
Der Mann an der Spitze trug eine lange rote Kutte. Auf seinem Kopf saß eine caparutxa, eine hohe, spitz zulaufende Kapuzenmaske, die sein Gesicht verdeckte. Zwei in den Stoff geschnittene Löcher ließen dunkle Augen mit einem aufmerksamen Blick erkennen.
Der regidor läutete die Eisenglocke, die er mit ausgestrecktem Arm hielt. Vier beunruhigende Glockenschläge. Mit schwarzem Chiffon verschleierte Trommler gaben die Antwort. Vier düstere Trommelwirbel.
Die Prozession der Sanch stellte sich auf, siebenhundert Personen nahmen ihre Plätze ein. Hinter der Gruppe der Trommler näherte sich ein barfuß gehender Büßer. Auf einen Gurt, den er um die Hüfte trug, hatte er ein drei Meter hohes Kreuz gestützt. Schwer. Eindrucksvoll. Das Creu dels Improperis symbolisierte die von Christus während der Passion erduldeten Kränkungen. Am Holz des Kreuzes waren Nägel, eine Lanze, ein Hammer und weiteres Gerät befestigt, insgesamt dreizehn Leidenswerkzeuge. Hinter dem Kreuz folgte das erste misteri. Deren würde es um die dreißig geben. Sie wurden auf den Schultern der Büßer getragen und stellten die Szenen des Kreuzwegs nach. Das älteste misteri stammte noch aus dem 17. Jahrhundert. Das schwerste wog zweihundertfünfzig Kilo und musste von zwölf Männern getragen werden.
Alle Männer waren maskiert, sie steckten unter der traditionellen caparutxa, die im Gegensatz zur Kutte des regidor bei ihnen tiefschwarz glänzte. Ursprünglich hatte das Wort caparutxa nur die Kapuze selbst bezeichnet, doch inzwischen umfasste der Begriff das gesamte Gewand der Büßer: eine lange Kutte aus Sackleinen, die bis zu den Füßen reichte. Die einzige Verzierung dieser strengen Kleidung war eine Kordel, deren Farbe die Kirchengemeinde kennzeichnete, zu der der Träger gehörte. In der Prozession waren nur die Gesichter der Frauen unverhüllt. Mit ihrem geraden und strengen Rock, der schwarzen Weste und einer Mantille, die das Haar bedeckte, trugen sie Trauer um Jesus.
La Sanch, das kostbare Blut des Herrn. Die Lautsprecher knackten, und in der Menschenmenge, die sich um die Église Saint-Jacques drängte, trat Stille ein. In einer kurzen Predigt ehrte der Bischof von Perpignan die jüngst gestorbenen Attentatsopfer und versicherte, jedes Mal, wenn er den »gequälten und leidenden Christus am Kreuz« sehe, träten ihm ihre Märtyrergesichter vor Augen. Anschließend dankte er mit einigen Worten den Ordnungskräften, die die Zeremonie absicherten. Das Publikum applaudierte.
»Na, da können wir aber stolz sein«, murmelte Jacques Molina, Lieutenant der Polizei, seinem Kollegen ins Ohr. Als wenn sie nichts anderes zu tun hätten.
Angesichts der Gefahr durch Terroristen verschlang der Schutz der Osterprozession jedes Jahr mehr Mittel. Abgestellt waren etwa fünfzig städtische Polizisten, verstärkt durch rund dreißig Mitarbeiter des Commissariats von Perpignan, eine Einheit von Soldaten der Opération Sentinelle sowie einige Agenten des Inlandsgeheimdienstes, die sich in Zivil unter die Menge gemischt hatten.
»Mecker nicht. Immerhin ist das Wetter schön.«
Lieutenant Gilles Sebag zog die Armbinde mit der Aufschrift Polizei zurecht, die an seiner Jacke befestigt war. Er freute sich eher, dass er dabei sein konnte. Geboren war er vor zweiundvierzig Jahren in einer Vorstadt von Paris und erst vor gut zehn Jahren in die katalanische Region gezogen. Mit stets wieder neuem Staunen verfolgte er jeden Karfreitag die Prozession der Sanch. Selbst wenn sie heute mehr Touristen und Neugierige anzog als Gläubige, verbreitete diese mehr als sechshundert Jahre alte Tradition in den Straßen Perpignans einen Hauch von Spiritualität, den er exotisch fand. Diese in Frankreich einzigartige Prozession war nur mit der im spanischen Sevilla vergleichbar.
Kreischendes Kinderlachen störte die letzten Worte des Bischofs. Ohne die finsteren Blicke zu beachten, die die Gläubigen ihnen zuwarfen, spielten die kleinen Gitans Fangen.
»Geht, amüsiert euch woanders«, forderte Molina sie auf.
»Peng«, erwiderte ein Kleiner von höchstens sechs Jahren und legte einen Finger auf das Schnellfeuergewehr des Polizisten.
Glücklicherweise zogen ein paar ältere Kinder den Frechdachs mit sich, weg von dem schon leicht erzürnten Molina. Sie vergnügten sich in der Menge wie ein Schwarm Spatzen.
Nach seiner Predigt stimmte der Bischof ein Gebet an. Notre-Dame des douleurs. In der Menge bekreuzigten sich einige. Anschließend ertönten im Glockenturm der Kirche drei Glockenschläge. Erneut klingelte die Eisenglocke des regidor, gefolgt von den Trommelwirbeln. Als dann ein düsterer Gesang aus den Lautsprechern ertönte, schritt der regidor gemessen voran. Hinter ihm setzte sich der Zug in Bewegung.
»Zurücktreten, bitte, zurücktreten.«
Zwei Polizisten der Antikriminalitätsbrigade hielten die Horde der Fotografen auf Abstand. Die Menge war dicht gedrängt, die Straße eng und die Vorschriften waren streng. Drei Meter mindestens.
Nach dem ersten Abbiegen ergoss sich der Zug auf die Place du Puig im Herzen des ärmlichsten von Perpignans Stadtvierteln. Im Umkreis dieses Platzes lebten beinahe fünftausend Gitans in einem Gewirr abbruchreifer oder sogar gesundheitsgefährdender Gebäude. Die vor Jahrhunderten in der katalanischen Region sesshaft gewordene Gemeinschaft hatte dieses Viertel im alten Stadtzentrum ab den Fünfzigerjahren besiedelt, da die ursprünglichen Bewohner sich anderswo modernere und geräumigere Wohnungen gesucht hatten.
Die Gitans, die zum größten Teil evangelikal waren, verfolgten die Prozession mit geradezu genüsslichem Interesse. Einige Alte hatten ihre Klappstühle auf die Straße gestellt und sich wie zu einem Schauspiel hingesetzt. Es war noch gar nicht so lange her, da wurden auch schon mal Eier auf den Zug geworfen. Eine Art Rache der Unterprivilegierten, da die bessere Gesellschaft Nordkataloniens reumütig unter ihren Fenstern vorbeidefilierte.
Im Quartier Saint-Jacques ging es noch einige Male um die Ecke, bevor sich die Prozession in die Rue Rabelais schob und die sanfte Steigung zum Stadtzentrum hinaufmarschierte.
Durch seine caparutxa vor den neugierigen Blicken der Menge geschützt, schritt er mit nackten Füßen über den Asphalt. Trotz seiner Erschöpfung hatte er dieses Jahr im Büßen noch einmal Trost gefunden. Gott verwehrte ihm diese flüchtige Ruhepause nicht.
In seiner Kindheit hatte Christian jeden Karfreitag an der Sanch teilgenommen, sich ihr aber dann als Jugendlicher entzogen. Erst spät war er zurückgekehrt. Und nach den vorgeschriebenen fünf Probejahren war er in den Schoß der Erzbruderschaft aufgenommen worden.
Doch Gott las in seiner Seele. Und trotz seiner Güte hatte er beschlossen, ihn zu bestrafen.
Ganz kurz schloss Christian die Augen. Die goigs schallten durch die Straße. Welcher Segen waren doch die katalanischen Gesänge!
Bei einer holprigen Stelle des rauen Asphalts zog er eine Grimasse, doch das konnte zum Glück keiner sehen. Die Buße war für ihn kein leeres Wort.
Gestern hatte er sich die Fußsohlen verbrannt, damit seine Haut empfindlicher wurde. Der Schmerz verband ihn direkt mit Gott. Ein Rausch, eine Ekstase. Früher hatte er sich gern mit kleinen Schnitten einer Rasierklinge verletzt, doch die zu leicht sichtbaren Wunden waren aufgefallen. Die Führung der Erzbruderschaft hatte damit gedroht, ihn auszuschließen. Heutzutage sprang man mit einem zu innigen Glaubenseifer streng um … Der war schlecht fürs Image. Sowohl in den Augen der Touristen als auch der Kirche.
Durch die Löcher in seiner caparutxa glitten seine Augen über die Menschenmenge. Erstaunte oder sogar spöttische Blicke, gezückte Fotoapparate und Handys. Die Fotos der Prozession erschienen sehr bald in den sozialen Netzwerken. Er stellte sich die Kommentare vor. Manche würden es niemals begreifen und erkannten in dieser katalanischen Tradition keinen Ausdruck des Glaubens, sondern nur Folklore. Andere stießen sich am Gewand, das sie an den Ku-Klux-Klan erinnerte.
Doch damit hatte die Sanch nicht das Geringste zu tun.
Eine der ursprünglichen Aufgaben der 1416 gegründeten Erzbruderschaft hatte darin bestanden, die zum Tode Verurteilten zum Galgen zu begleiten. Die von allen getragene Kapuzenmaske sollte verhindern, dass die Menge die Gefangenen lynchte. Nach der Hinrichtung sorgte die Bruderschaft für ein christliches Begräbnis der Bestraften.
Nein, die Sanch hatte wirklich nichts mit den grässlichen Übergriffen der amerikanischen Rassisten zu tun.
Er wendete den Kopf. Nach rechts. Nach links. Seine büßenden Mitbrüder gingen heiteren und vertrauensvollen Schrittes, ohne zu begreifen, dass sie seit dem Tag ihrer Geburt zum Tod verurteilt waren. Leben hieß schließlich nichts anderes, als sich zu bemühen, Tag für Tag und Minute für Minute den unentrinnbaren Verfall zu vergessen. Ein Herzanfall oder ein Krebsleiden, ein Autounfall, ein Mord … Früher oder später würde der Tod bei ihnen allen anklopfen. Welche Sünden sie auch begangen und welche guten Taten sie auch vollbracht haben mochten.
In den Teilnehmern der Prozession und in den Reihen derer, die sie lächelnd an sich vorbeiziehen sahen, erkannte er nur noch zum Tode Verurteilte, die einen Aufschub genossen. Und er selbst war als einer der Ersten dran.
Die hohe Silhouette des regidor bewegte sich langsam durch die Fußgängerzone des Zentrums. Gemessenen Schrittes gab er den Rhythmus des Zugs vor. Gleichzeitig legte er die Pausen fest. Kurze, jedoch häufige Halte. Dann nahmen die Träger der misteri die Last von ihren Schultern und legten die Stangen ihrer heiligen Tragen auf einer forqueta ab, einem von einem Halbmond aus Stahl gekrönten Stab. Für jedes misteri dirigierte ein Büßer das Manöver. Ein Stoß mit der forqueta auf den Asphalt signalisierte die Pause, zwei Stöße das erneute Losschreiten.
Sebag und Molina gingen gut dreißig Meter vor der Prozession. Sie beobachteten die Zuschauer, auf der Lauer nach dem geringsten Hinweis auf ein verdächtiges Verhalten.
»Der da wirkt undurchsichtig, oder?«, sagte Jacques und deutete mit dem Kinn auf einen jungen Mann, der abseits der Menge stand.
Der Mann hatte einen Fuß auf eine Metallbegrenzung gestellt und kratzte sich durch den Stoff seiner Hose hindurch ausgiebig die Wade.
»Was wirfst du ihm vor?«, fragte Sebag.
»Man hat das Gefühl, er tut nur so, als ob er sich kratzt, um unauffällig die Umgebung zu beobachten.«
Sebag schenkte dem Mann ein paar zusätzliche Sekunden. »Ich würde eher sagen, er tut so, als interessierte er sich für seine Umgebung, um zu kaschieren, wie dringend er sich kratzen muss.«
»Meinst du? Vielleicht hast du recht. Am Ende sehe ich noch in jedem einen Terroristen.«
Sebag legte die Hand auf das HK-G39, das Molina vor der Brust hielt. »Paranoia ist gar nicht gut, wenn man ein Schnellfeuergewehr mit sich herumschleppt.«
»Keine Sorge … Man hat es mir direkt vor dem Aufbruch in die Hände gedrückt, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich es bedienen kann.«
»Und das soll mich beruhigen?«
Der ergreifende Gesang des miserere der Gehängten schwebte über ihren Köpfen. Christian rezitierte fast lautlos ein Gebet. Bei gewissen Silben liebkosten seine Lippen den rauen, beruhigenden Stoff der caparutxa. Und sie tranken auch den Schweiß, der ihm übers Gesicht rann. Ohne Mitleid richtete die Sonne ihre heißen Strahlen auf die schwarze Kapuze.
Als sie eben ihre Gewänder angelegt hatten, hatte Douce France ihn eigenartig angesehen. Ein neugieriges Lächeln auf den zarten Lippen.
Der religiöse Gesang brach ab. Nach einigem Knacken im Lautsprecher wurde der Bericht über das Leben des sant Vicenç Ferrer vorgetragen, des Dominikanermönchs, der die Sanch begründet hatte. Der Vortragende hatte die schöne, ernste und schleppende Stimme, mit der früher die Schauspieler sprachen. Die Tonaufzeichnung musste noch aus den Fünfzigerjahren stammen, als man die Prozession nicht mehr auf die Kathedrale beschränkt und den Büßern endlich wieder erlaubt hatte, durch die Straßen der Stadt zu schreiten. Christian kannte die Aufnahme auswendig, er achtete nicht mehr auf den Sinn, sondern nur noch auf die Melodie der Worte.
Für einige Sekunden schloss er die Augen. Er konnte gehen, ohne zu schauen, die Prozession trug ihn. Mit Sicherheit war es das letzte Mal, dass er teilnahm.
»Schaut mal den da an! Der ist ja barfuß!«
Er öffnete die Augen wieder. Kinder zeigten mit dem Finger auf ihn. Eine kleine Gruppe von vielleicht zwanzig Knirpsen, Jungen und Mädchen, höchstens zehn Jahre alt. Die Sanch war ein Symbol der Hinwendung der Katalanen zu ihrer Tradition, und einige Schulen lehrten ihre Geschichte. Pech für die Laizisten, die sollten sich zum Teufel scheren! Die Karfreitagsprozession gehörte ebenso zu dieser Region wie die Johannisfeuer, die castellers (Menschentürme), der Rugby-Verein USAP und der Tanz sardane.
Christian drehte den Kopf und betrachtete freudig die Kinder. Wieso redete man immer von Blondschöpfen? Die hier waren braunhaarig und trotzdem hinreißend. Was hätten diese Kinder wohl gesagt, schritten noch Flagellanten in den Reihen der Sanch mit, diese Büßer, die sich beim Gehen heftig den Rücken geißelten? Das waren extreme Praktiken, die die Kirche und die Stadtverwaltung Ende des 18. Jahrhunderts veranlasst hatten, die Prozession zu beschränken und schließlich ganz zu verbieten.
Waren sie wirklich extrem? Waren sie nicht eher dem barocken und allzu spanischen Charakter der Sanch zu verdanken, der damals die Feindseligkeit der französischen Behörden geweckt hatte?
Ah … Den Biss der Lederriemen auf seinem blutüberströmten Rücken zu spüren … Bei dieser Vorstellung überlief ihn ein Schauer. Das hätte er gebraucht, damit die Buße seine Gelüste für eine längere Zeit zähmte …
Er dachte an das neugierige Lächeln von Douce France. Ein hartes und distanziertes Lächeln, das er nicht an ihm kannte. Zweifellos ein Zeichen. Vielleicht ein Abschied. Es gab sehr wohl einen Verurteilten in dieser Prozession. Im ersten Moment empfand Christian Angst. Und dann Hoffnung.
Sebag und Molina trafen in der Rue Fontaine Froide ein. Vor dem Schaufenster eines Bistros standen Tische bis auf die Fahrbahn. Wenn der Zug hier vorbeikäme, gäbe es keinerlei Abstand zwischen den Gästen, den Touristen oder einem eventuellen Terroristen.
»Wie soll man einen solchen Saustall sichern?«, knurrte Molina. Auf den Abschnitten der Route, wo das größte Gedränge herrschte, trennten Metallsperren die Schaulustigen vom Zug. Doch überall sonst war der Zugang zur Prozession problemlos möglich. Sebag zuckte mit den Schultern.
»Jedenfalls sind die Büßer nicht die einzigen möglichen Zielscheiben. Hier haben wir alles in allem mindestens zehntausend Menschen. Da kann man eigentlich nur einen Volltreffer landen.«
Sie gelangten auf die Place de la Cathédrale, wo die Menge erneut von Absperrgittern auf Abstand gehalten wurde. Es erinnerte an ein Etappenziel der Tour de France. Oder, besser gesagt, an einen Zwischensprint. Denn die Sanch würde an diesem Ort nur kurz haltmachen.
Fünf Soldaten waren am Eingang zum Platz aufgestellt. Ihr Sergent trat zu den beiden Polizisten.
»Bleiben Sie während der Rede hier. Wir stellen uns vor der Kathedrale auf, da, wo die Plätze für den Präfekten, den Bürgermeister und die Stadträte sind …
»Seit wann kommandierst denn du hier?«, fauchte Molina. »Und was willst du damit eigentlich sagen? Dass sie durch euch besser geschützt sind?«
Der Soldat schielte auf die Maschinenpistole. Sebag spürte, dass er gleich eine Bemerkung darüber machen würde, wie Jacques seine Waffe hielt, und kam ihm zuvor. Jetzt war weder der Ort noch die Zeit für einen Kleinkrieg der Ordnungskräfte.
»Die Opération Sentinelle dient vor allem der Beruhigung. Die gewählten Vertreter werden sich freuen, Soldaten zu sehen.«
Der Sergent dankte ihm mit einem Nicken und führte seine Leute zur Kathedrale. Sebag legte seinem Kollegen die Hand auf den Arm.
»Beruhig dich. Schon in zwei Stunden fängt das Wochenende an.«
Die ersten Büßer hielten vor dem mittelalterlichen Brunnen auf dem Platz vor der Kathedrale. Sebag beobachtete die Füße, die vor ihm vorbeischritten, nur sie schauten unter den langen Kutten hervor. Manche Büßer trugen vigatanes – katalanische Espadrilles –, doch die meisten begnügten sich mit schlichtem schwarzen Schuhwerk. Manche gingen auch barfuß, ein Überbleibsel der Vergangenheit, das die Neugierigen faszinierte.
Die Prozession kam nun langsamer voran. Er wusste, dass die ersten Büßer an der Spitze sich bereits vor der Kathedrale aufstellten. Es würde heiß werden, schwer auszuhalten.
Darauf freute er sich bereits. Niemand konnte büßen, ohne zu leiden.
Er spürte die Anwesenheit von Douce France einige Meter hinter sich. Wie eine beruhigende Drohung. Unter seiner Kapuze lächelte er über diesen Ausdruck. Wie nannte man diese Stilfigur noch? Ah ja, ein Oxymoron. Die französische Sprache war nie seine besondere Stärke gewesen. Sein Gebiet war vielmehr die Musik. Man konnte nicht für alles begabt sein. Allerdings … Der Poet hatte zu seiner Zeit alle Talente besessen. Mit den Fingern begann er, auf seiner Kutte wie auf der Tastatur eines Klaviers zu spielen. Nur mühsam hinderte er sich daran zu summen.
Der Engel würde handeln. Davon war er inzwischen überzeugt. Der Engel des Todes würde sich nicht behindern lassen. Er würde mitten im Prozessionszug zuschlagen. Eines jedoch machte ihn traurig. Er hatte das Lächeln von Douce France entziffert, und er hatte darin auch Hass erkannt.
War das nach allem, was vorgefallen war, verwunderlich?
Per les obres de la Sanch, si us plau. Für die Werke der Sanch, bitte.
Sebag und Molina traten auseinander, um zwei Mitglieder der Erzbruderschaft vorbeizulassen, die die Kapuzen abgesetzt hatten und sie den Zuschauern umgedreht hinhielten, während sie am Absperrgitter vorbeigingen.
»Wenn sie ihre Kapuzen voll kriegen, so groß wie die sind, können sie sich für nächstes Jahr die Motorisierung ihrer misteri leisten«, witzelte Molina. »Wär doch drollig, diese ganzen Tragen mit einem kleinen Elektromotor …«
Jacques, der aus Perpignan stammte, hatte ein zwiespältiges Verhältnis zu diesem Winkel Frankreichs, in dem er geboren war. Obgleich Katalane durch und durch, spöttelte er dennoch nur zu gern über diejenigen, die ständig die Flagge ihrer Identität hissten.
»Aber die Touristen können ruhig mal großzügig sein. Schließlich kriegen sie ein fantastisches Schauspiel geboten.«
Vor ihnen wurde ein misteri auf den Schultern einiger Frauen vorbeigetragen. Es stellte eine schwarz gewandete Madonna dar, die ein makellos weißes Tuch vor sich hielt. Schwerter durchbohrten ihr silbernes Herz. Zu Füßen der Jungfrau verbreiteten Sträuße von Levkojen ihren zarten Blütenduft. Zwei Sanitäter der Sécurité Civile verfolgten das Geschehen genau. Sie hatten erspäht, dass eine der Trägerinnen mit ihrer Last Mühe hatte.
Ein Paar Turnschuhe fiel Sebag ins Auge. Modische Sneaker, zweifellos unerschwinglich. Dunkel und nüchtern respektierten sie den Kleidungskodex, jedoch zweifellos nicht den Geist der Prozession. Sie wären Gilles gar nicht aufgefallen, hätte er nicht in den letzten Tagen die unglaublichsten Boutiquen besuchen müssen, wo man für Schuhe, die für ihn einfach nur Turnschuhe waren und bleiben würden, so viel bezahlen musste, als würden sie mit Gold aufgewogen. Sein Sohn Léo wurde bald achtzehn, und für seinen Geburtstag hatte er keinen anderen Wunsch geäußert. Wahnsinn pur!
Sebag spürte die Vibration seines Handys in der Hosentasche, hielt eine Reaktion aber nicht für angemessen. Immer mehr Büßer drängten auf den Platz. An der Spitze des Zugs wartete seinerseits der Bischof, umgeben von seinen Messdienern, vor dem Tor der Kathedrale.
Ein erneutes Rütteln in Sebags Hosentasche. Nach dem Anruf traf nun eine SMS ein. Es musste etwas Ernstes sein. Das Handy vibrierte schon wieder. Ein weiterer Anruf. Sebag las »Big Boss« auf seinem Display und nahm das Gespräch an.
»Ich brauche Sie, Gilles«, sagte Commissaire Castello. »Ein Überfall in einem Juweliergeschäft am Boulevard Clemenceau. Ich habe kaum mehr jemanden hier, beeilen Sie sich. Ménard und Llach werden Ihren Platz im Zug einnehmen.«
2
So, es war so weit, etwas passierte … an der Spitze des Zugs waren zwei Bullen in Zivil von Kollegen abgelöst worden und schlängelten sich in Richtung des Castillets durch die Menge, was der kürzeste Weg zum Boulevard Clemenceau war. Er konnte nicht auf seine Armbanduhr schauen, doch geplant war, dass alles losging, sobald die Prozession auf der Place Gambetta einträfe. Und derzeit lief alles wie vorgesehen.
Perfekt.
Der regidor schob sich zum Eingang der Kathedrale vor. Seine hohe Silhouette verbeugte sich vor dem misteri des Dévot-Christ, ein ausgemergelter Christus, der am Kreuz hing, vom Tod noch nicht bezwungen. Nach weiteren weitschweifigen Gesten trat der regidor in die Reihen zurück, und der Bischof hielt seine zweite Predigt.
Was für ein Theater! Welches Blabla!
Aus der Deckung eines Kebabs in der Avenue de la Gare hatte er auf den Aufbruch des Schufts zur Sanch gelauert. Anschließend hatte er sich ins Haus geschlichen, alles sauber gemacht, einige Schubladen durchwühlt und das Handy eingesteckt. Es hatte an seinem üblichen Platz gelegen. Auf einem Tischchen neben dem Klavier. Der Schuft nahm es niemals mit, wenn er wegging, er nutzte es letztlich nicht anders als ein Festnetztelefon. Der alte Idiot!
Er hatte die Batterie und die SIM-Karte herausgenommen und dann alles getrennt in verschiedene Mülleimer geworfen. Schließlich war auch er zur Église Saint-Jacques aufgebrochen. Ein bisschen verspätet, aber gerade noch rechtzeitig, um Treize über seine Pläne zu informieren. Scheiße noch mal, was hatte der Kerl für ein Gesicht gemacht! Doch es war zu spät für einen Rückzieher.
Neben ihm vergoss ein Kind heiße Tränen. Pobret! (Der Arme!) Mit einem schwarzen Brustlatz über der Tunika, die er zur Erstkommunion tragen würde, einem Kreuz um den Hals und mit streng geschnittenem Haar, das die Ohren freiließ, marschierte der wohl gerade einmal Siebenjährige in den dichten Reihen seiner unglückseligen Schicksalsgenossen mit … Auch er selbst hatte das einmal wie einen Kreuzweg erlebt. Haha! Kreuzweg! Ein besseres Wort gab es nicht …
Keine Angst, Kleiner. Nach dem, was gleich passiert, verlangen deine Eltern nächstes Jahr vielleicht nicht mehr von dir, dass du mitmarschierst …
Die gebeugte Silhouette des Schufts, der einige Meter vor ihm ging, wirkte resigniert … Er war total a. A. … Am Arsch. Es wurde Zeit, Schluss zu machen. Dieses beschissene Kapitel abzuschließen!
Er atmete tief ein. Er hatte die Latte sehr hoch gelegt, das war der Preis seiner Rache.
Aber er durfte es nicht vermasseln.
Noch einmal ließ er sich die Handbewegung durch den Kopf gehen, die er gleich durchführen würde. Er hatte sie tausendmal pantomimisch geübt. Und dann an einigen Streunerhunden. Gleich würde der große Moment kommen. Er würde seinen Plan perfekt durchziehen. Zu seiner großen Überraschung rief das heiß durch seine Adern strömende Blut keine Anspannung hervor, sondern eine extreme Ruhe, die bis in seinen Kopf aufstieg.
Wie ein Meister vor einer Aufführung.
Er war ein Meister … Er würde seine Heldentat vollbringen.
Endlich.
3
Auf den Fliesen des Geschäfts kniend, maß ein Notarzt den Blutdruck des Juweliers. Gleichzeitig stellte er ihm Fragen. Name, Alter, Beruf, das aktuelle Datum. Der übliche Test, mit dem überprüft wurde, wie weit ein Mensch, der einen Schock erlitten hatte, wieder bei sich war. Der Patient saß mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden, den Rücken gegen einen Schaukasten mit Uhren gelehnt. Philippe Borell, zweiundsechzig, Juwelier, antwortete langsam, jedoch fantasievoll.
»Welches Jahr wir haben? Äh … 1977.«
Der Arzt zuckte zusammen.
»Das Jahr, in dem ich … in dem ich zwanzig war, Herr Doktor … Wären wir doch … nach 1977 … zurückgekehrt.«
Ein wenig Blut rann ihm vom Wangenknochen. Der Arzt öffnete den Klettverschluss um seinen Arm.
»Hundertvierzig zu siebzig. Ihr Blutdruck ist leicht erhöht.«
Er steckte das Gerät in seine Arzttasche zurück und holte eine Kompresse und Alkohol hervor, um die Wunde zu säubern. Dabei wandte er sich den beiden Polizisten zu und beantwortete die Frage, die sie noch gar nicht gestellt hatten:
»Monsieur Borell hat einen Hieb erhalten. Ich würde sagen … mit einem Zweifinger-Schlagring.«
Molina beugte sich über den Verletzten. Er verzog das Gesicht.
»Glauben Sie wirklich? Für einen Schlagring ist die Wunde nicht gerade tief …« Er wandte sich an den Juwelier.
»Haben Sie die Waffe gesehen?«
»An den Fingern von dem Kerl hat etwas geschimmert. Ich habe es für einen Ehering gehalten. Wohl eine Berufskrankheit …«
Molina legte ihm die Hand auf die Schulter, ein Lob für seinen Humor. Dann trat er einen Schritt zurück und überließ seinem Kollegen das Feld. Sebag holte sein Notizbuch hervor.
»Erzählen Sie uns bitte, was passiert ist.«
Der Juwelier hob den Kopf und sah sie an. Sein Gesicht war dicklich, seine Züge wirkten teigig. Um die fleischigen Lippen ließen tiefe Falten sein Alter erkennen. Doch seine gepflegte Frisur, noch immer voll und lockig, verlieh dem Ganzen ein wenig jugendlichen Schwung.
»Sie sind von hinten eingedrungen … dort geht eine Tür auf den Hof … Die Mieter parken da ihr Auto … Ich auch.«
Geistig wirkte er klar, doch mit dem Sprechen hatte er noch Schwierigkeiten.
»Es waren zwei … Sie trugen Schirmmützen und Masken … Sie haben mich mit Waffen bedroht …«
»Mit was für Waffen? Und was waren das für Masken?«
»Mit Pistolen, mehr kann ich nicht sagen, ich kenn mich da nicht aus. Die Masken waren aus Pappe … und stellten Carles Puigdemont dar.«
Nach dem Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens, das von Madrid für gesetzeswidrig erklärt worden war, war der Präsident der Generalitat von Barcelona zur Flucht gezwungen gewesen, um nicht wegen Aufrufs zu Rebellion und Sezession verhaftet zu werden. Während die spanische Polizei ihn überall suchte, hatten immer wieder Unabhängigkeitsbefürworter auf den Straßen Barcelonas demonstriert, das Gesicht mit der Maske ihres Anführers bedeckt.
»Von denen gibt es jedenfalls genug«, merkte Molina an.
»Was haben die beiden nach dem Eindringen gesagt?«, fragte Sebag weiter.
»Nur ganz banale Sachen … So was wie: ›Keine Bewegung, sonst bist du tot.‹ Und dann: ›Nicht den Helden spielen, gib uns die Steine!‹«
»Die Steine?«
»Ich hatte gerade eine Lieferung mit Rohmaterial erhalten, Edelsteine und Halbedelsteine … Diamanten, Topase, Smaragde … auch Zitrin … und natürlich außerdem Edelmetalle, Gold, Silber … Platin. Ich hatte noch keine Zeit gehabt, das Material in den Tresorraum zu legen. Alles war noch draußen.«
Mit zitternder Hand deutete er auf den Ladentisch. Dort beschwerte ein Füller ein Blatt Papier.
»Das ist die komplette Liste … Der Lieferschein … Es war eine Sendung im Wert von genau 88 253 Euro.«
Molina stieß einen lauten Pfiff aus. Sebag notierte die Details. Etwas sprang sofort ins Auge. Doch es war noch zu früh, um es anzusprechen.
»Sonst haben die beiden nichts gefordert?«
»Nein. Sie haben weder von mir verlangt, den Safe zu öffnen, noch einen Schaukasten. Ich denke, das, was sie bekommen haben, hat ihnen gereicht …«
»Aber hallo … Mehr als achtundachtzigtausend Euro in was? Nicht einmal dreißig Sekunden?«, kommentierte Molina.
»Höchstens vierzig«, bestätigte der Juwelier. »Die Zeit ist immer schwer zu schätzen …«
»›Immer‹? Das war nicht Ihr erster Raubüberfall?«
»Nein. Der dritte.«
Für Sebag war das eine gute Nachricht: Er hoffte, dass die Zeugenaussage des Juweliers dadurch präziser ausfallen würde.
»Sie haben von zwei Tätern gesprochen. Die beiden waren zwar maskiert, aber trotzdem können Sie mir bestimmt mehr über sie erzählen. Ihr allgemeines Aussehen und ihre Körpermaße.«
Der Juwelier beschrieb zwei Männer, nach ihren geschmeidigen Bewegungen zu urteilen vermutlich jung. Der erste war größer als ein Meter achtzig und ziemlich muskulös. Seine braunen Haare fielen ihm in den Nacken. Der zweite war kleiner, höchstens ein Meter fünfundsiebzig, und fülliger. Sein kastanienbraunes Haar war kurz. Beide Täter trugen schwarze Sweatshirts und eine schwarze Hose. Ihre Hände steckten in schwarzen Lederhandschuhen. Sebag notierte diese Beschreibungen und gab dem einen im Geist den Vornamen Carles, dem anderen den Namen Puigdemont.
»Geredet hat der Größere, der Kleinere hielt sich ziemlich zurück«, fuhr der Juwelier fort. »Der Kleinere trug außerdem einen Schal um den Hals.«
Sebag notierte dieses Detail in Großbuchstaben. Es mochte sich noch als wichtig erweisen.
»Welcher von den beiden hat Sie geschlagen?«
»Der Kleinere.«
»Und hat er dabei irgendwas gesagt?«
»Äh, ja … Direkt vor dem Aufbruch … So was wie: ›Folge uns ja nicht, auf keinen Fall!‹ Und dann hat er, zack, zugeschlagen. Wie schon gesagt, es ging so schnell, dass ich den Schlag nicht habe kommen sehen.«
Sebag wartete ab, doch der Juwelier fügte nichts mehr hinzu. Daher kehrte er zu der Auffälligkeit zurück, die ihm kurz zuvor ins Auge gesprungen war.
»Die beiden waren gut informiert …«
Borell schnitt eine Grimasse, doch Sebag konnte nicht erkennen, ob die sich auf seine Bemerkung bezog oder vielmehr auf das Hantieren des Arztes, der gerade die beiden Wundränder zusammendrückte, um Steristrips aufzukleben. Der Juwelier streckte die zitternde Hand vor sich aus.
»Gut geht es mir nicht.«
Der Arzt wandte sich kurz von dem Wangenknochen ab, um die Pupillen zu untersuchen:
»Was genau empfinden Sie?«
»Ich habe Bauchschmerzen, und mir ist schlecht.«
»Das ist der Stress, die Nachwirkung. Ich verschreibe Ihnen ein Beruhigungsmittel.«
Während der Arzt ein letztes Wundpflaster aufbrachte, bemühte Sebag sich erneut um die Aufmerksamkeit des Juweliers.
»Wenn die beiden ohne weiteres Vorspiel ›die Steine‹ gefordert haben, müssen sie gewusst haben, dass Sie gerade diese Lieferung erhalten hatten, denken Sie nicht auch? War sonst noch jemand informiert? Vielleicht ein Mitarbeiter?«
»Ich arbeite allein.«
»Freunde? Familienmitglieder?«
»Ich habe mit niemandem darüber gesprochen.«
Seine Stimme wurde immer leiser.
»Sind Sie sicher, dass Sie gleich allein zurechtkommen?«, unterbrach der Arzt sie noch einmal. »Sie sind ganz bleich …«
»Ja, ja, es geht schon«, erklärte der Juwelier mit stockender Stimme und wandte sich dann erneut an die Polizisten. »Dauert es noch lange? Ich würde gern den Laden schließen und nach Hause gehen.«
Auf der Straße raste ein Einsatzfahrzeug vorbei, mit heulender Sirene. Feuerwehr. Sebag wartete ab, bis der Lärm vorbei war, ließ dann aber nicht locker:
»Nur noch zwei oder drei Fragen, wenn es Ihnen recht ist …«
Ein weiteres Fahrzeug bretterte mit heulenden Sirenen über die Straße. Diesmal ein Krankenwagen.
Dann plärrte erneut Sebags Handy. Wieder der Commissaire:
»Während der Prozession ist eine Massenpanik ausgebrochen. Place de la Loge. Ein Toter …«
Sebag wollte gerade einwenden, er sei hier noch nicht fertig und es seien genug Polizisten vor Ort, um sich des Vorfalls anzunehmen, doch Castello fasste sich genauer:
»Es handelt sich um einen Mord. Ein Büßer ist getötet worden. Molina soll beim Juwelier bleiben. Sie stoßen am Tatort zu Ménard.«
Jacques nahm die Maschinenpistole ab, die noch von seiner Schulter hing, und lehnte sie gegen den Sockel eines Schaukastens.
»Kannst du mir vielleicht ein paar Blatt Papier geben? Ich habe nichts bei mir, um mir Notizen zu machen.«
Sebag riss ein paar Seiten aus seinem Notizbuch. Der Arzt war ihrem Gespräch gefolgt und hatte seinerseits bei der Notrufzentrale angerufen, um durchzugeben, dass er für einen neuen Einsatz bereitstand. Sie verließen den Laden zur gleichen Zeit.
Sebag ging rasch den Boulevard Clemenceau entlang. Zwei weitere Feuerwehrfahrzeuge überholten ihn. Neben einem Müllcontainer lag ein Abfallsack mit aufklaffendem Innenleben. Ein Windstoß der Tramontane wehte ein Stück Plastikfolie hoch und ließ es in einem Wirbel durch die Luft flattern. Sebag blieb stehen und verfolgte das Schauspiel. Er hatte das Gefühl, wie dieser Streifen Kunststoff zu sein: hin und her geworfen von den Umständen …
4
Das schmiedeeiserne Schiff, das als Wahrzeichen über der Loge de Mer aufragte, schien eigens dort angebracht worden zu sein, um den Schauplatz der Tragödie zu kennzeichnen. Ein Stück darunter mokierte sich ein moosfreier Wasserspeier. Zu jener Zeit, als Perpignan seine Tuchwaren in den ganzen Mittelmeerraum und darüber hinaus exportierte, bot die Loge de Mer Raum für ein Konsulat und ein Seehandelsgericht. Heute beherbergte das gotische Gebäude hinter seinen Spitzbögen nur noch die städtische Touristeninformation, doch das war immer noch besser als das Fastfood-Lokal, das hier kurz nach der Jahrtausendwende florierte. Damals hatte Sebag noch nicht hier gewohnt, doch die Bürger Perpignans sprachen davon immer noch wie von einem Sakrileg.
Auf dem Platz herrschte Chaos. Die Absperrgitter und die Tische vor einem Café waren umgefallen. Zwischen zerbrochenen Tellern und Glasscherben bemühten Ärzte und Sanitäter sich um die Verletzten. Sebag kam auf ein knappes Dutzend. Trotz der Tränen, die noch flossen, und der erschreckten Gesichter war ihm klar, dass es sich hier nur um oberflächliche Verletzungen handelte. Kleinere Schnitte und ein paar Blutergüsse, nichts wirklich Schlimmes.
»Ich dachte, du wärst bei einem Raubüberfall?«
Sebag drehte sich um und begrüßte seinen Kollegen. François Ménard verbarg seine Verärgerung nicht: Gilles’ Auftauchen bedeutete, dass der Chef diesem die Leitung der Ermittlungen übergeben hatte, das war ihm klar. Ménard deutete auf eine ausgestreckte Gestalt auf dem Straßenpflaster.
»Darum geht es.«
Die Leiche war mit einem Tischtuch des Bistros abgedeckt worden. Neben ihr stand die Kapuze des Büßers auf dem Boden wie ein Kerzenleuchter bei einer Totenwache. Polizisten in Uniform bewachten den Bereich. Sebag gab die Anweisung, die Zone mit Zutrittsverbot noch ein Stück auszuweiten.
Dann kniete er sich bei der Leiche nieder und zog das Tischtuch weg.
Das Opfer musste um die sechzig sein. Die weißen Haare fielen ihm in Wellen bis zum Nacken herab. Die blassblauen Augen standen noch offen. Ein langer Schnitt durchzog die Kutte des Büßers. Das Blut hatte den Stoff verschmutzt, doch es war kaum etwas aufs Pflaster geflossen. Der Tod war schnell eingetreten.
»Ein Messerstich und dann eine kleine Bewegung nach oben, die das Herz durchbohrt hat.«
Joan Llach, ein weiterer Kollege vom Commissariat Perpignan, trat vor, um Gilles die Lage zu erklären. Und um zu verhindern, dass Ménard sich diese Kränkung antun musste.
»Ein Arzt, der für den Notfalldienst der Prozession eingeteilt war, hat den Tod festgestellt. Er ist rasch wieder aufgebrochen, hat uns aber seine Karte dagelassen.«
»Hast du eine Vorstellung, was vorgefallen ist?«
»Noch keine genaue. Wir hatten euren Platz vor der Spitze des Zugs übernommen, waren also etwa dreißig Meter vom Geschehen entfernt. Nach ersten Zeugenaussagen sind beim Durchzug der Sanch im Gedränge Knallkörper explodiert. Menschen haben geschrien, vor allem die nines sind in Panik geraten – die Mädchen.«
Er deutete auf eine Gruppe von fünf Jugendlichen, die unter einer Nackten aus Stein saßen, einer Plastik von Maillol.
»Sofort hat sich Panik ausgebreitet. Angesichts der Umstände ist das nicht verwunderlich.«
Solche Szenen waren auch schon andernorts vorgefallen. In Nizza zum Beispiel. Ein paarmal Knallen mit einer Schreckschusspistole hatte genügt, und die Menge war in Panik geraten. Fast ein Dutzend Menschen waren dabei leicht verletzt worden.
»Absperrgitter sind umgekippt, und das Chaos hat auf die Prozession übergegriffen«, fuhr Llach fort. »Ein misteri ist hingefallen …«
Erneut deutete er auf die Statue von Maillol. Von etwa zwanzig Büßern umgeben, wartete dort geduldig ein rot gewandeter Jesus, die rechte Hand über einen Kelch erhoben, den er in seiner Linken hielt.
»Als es gelungen war, die Ordnung wiederherzustellen, bemerkte man, dass einer der caparutxes nicht wieder aufstand.«
Sebag erinnerte sich, dass das Wort nicht nur die Kapuze und die Kutte bezeichnete, sondern dass man es auch für die Männer verwendete, die dieses Gewand trugen.
»Wir haben die Mädchen hierbehalten, und außerdem die caparutxes, die in der Nähe des Opfers gingen. Je zehn vor und hinter ihm. Doch wir hatten Anweisung, den Rest der Sanch weiterziehen zu lassen.«
Gilles war nicht begeistert. Zweifellos hatten wertvolle Zeugen den Tatort verlassen, doch wie sollte man mehrere Hundert Personen in der Nähe einer Leiche zurückhalten?
»Die anderen Büßer sind in Richtung der Église Saint-Jacques weitergezogen. Schweigend natürlich. Dort wird man ihre Personalien aufnehmen. Julie ist vor Ort und erstellt einen Plan: Wir werden genau wissen, wer auf dem Weg hierher wo im Zug war.«
Sebag unterließ einen Kommentar. Er wollte bei niemandem den Eindruck erwecken, dass er die Arbeit seiner Kollegen bewertete, nicht einmal lobend. Ihm war bewusst, dass er der Liebling des Commissaire war. Das war ihm oft peinlich, aber was sollte er machen? Er hatte keine Intrige gesponnen, um diese Stellung zu erlangen, und er hatte sogar die Beförderungen, die sein Chef ihm angetragen hatte, systematisch ausgeschlagen. Im Grunde wusste er, dass er diesen Status nur den Erfolgen seiner Ermittlungen verdankte. François Ménard wusste es ebenfalls. Und vermutlich brachte genau das ihn am meisten auf …
Sebag hob das Tischtuch ein bisschen höher, um die Leiche genauer zu betrachten. Der Büßer war barfuß.
»Was weiß man bisher über ihn?«
»Er hieß Christian Aguilar. Vor dreiundsechzig Jahren ist er in Perpignan geboren. Falls die Adresse des Personalausweises, den er bei sich trug, noch stimmt, wohnte er in der Rue Galceran de Villaseca. Ich glaube, sie liegt im Bahnhofsviertel.«
Joan Llach hatte den Straßennamen »Villasec« ausgesprochen, katalanisch, und das »a« am Ende verschluckt.
Gilles erhob sich langsam. Der Rücken tat ihm weh. In den letzten Wochen hatte er sein Lauftraining einstellen müssen. Ein erneuter Start in einem Marathon würde für lange Zeit ausgeschlossen sein.
»Wurde die Tatwaffe gefunden?«
»Noch nicht.«
Llach deutete auf einen Regenwasserablauf in zehn Metern Entfernung von der Leiche.
»Das Erste wird sein, den Gully unter die Lupe zu nehmen.«
»Zweifellos müsste man die anwesenden Büßer durchsuchen …«
»Das ist ein bisschen heikel, oder?«
»Ich habe einen Polizisten beauftragt, sie unauffällig zu beobachten«, mischte Ménard sich ein. »Und dieselbe Anweisung habe ich auch den Polizisten gegeben, die die verbliebene Prozession begleiten.«
Sebag legte so viel Wärme und Hochachtung wie möglich in den Blick, mit dem er seinen Kollegen ansah. François war ein guter und gewissenhafter Polizist. Ihm fehlten nur ein wenig Gespür und Glück.
Sebag entdeckte eine öffentliche Überwachungskamera, die zwanzig Meter entfernt an der Fassade des Rathauses angebracht war. Ménard war seinem Blick gefolgt.
»Der Tatort ist außerhalb des Bildwinkels, aber während du die Zeugen befragst, könnte ich die städtische Polizei anrufen. Vielleicht konnten sie den Vorgang direkt verfolgen.«
»Das wäre super …«
In Perpignan filmten mehr als zweihundert Kameras die Straßen rund um die Uhr. Sie wurden von der kommunalen Polizei betreut, doch die Polizisten des Commissariats nahmen sie oft für ihre Ermittlungen zu Hilfe. Während Ménard sich zum Telefonieren entfernte, ging Sebag zu den Mädchen. Sie waren vielleicht fünfzehn Jahre alt. So wie seine Tochter Séverine.
Von dem Vorfall erschüttert, drängten die Mädchen sich darum, Bericht zu erstatten. Gilles bat sie mit einer Handbewegung um Ruhe und deutete dann auf eine kleine Rothaarige, die ruhiger wirkte. Chloé erzählte, dass ihre Freundinnen und sie vorgehabt hätten, diesen Freitag in der Stadt shoppen zu gehen, und nur zufällig auf die Prozession gestoßen seien. Fasziniert seien sie stehen geblieben. Bis sie diese verdammten Kracher gehört hätten … sie hätten die Explosionen mit Schüssen verwechselt.
»Ein Junge ganz in der Nähe hat einen Scheiß geschrien. So was wie: ›Achtung, er ist bewaffnet!‹ Ein blöder Scherz, aber alle sind darauf hereingefallen!«
Nach den Schreien hatte ein Familienvater seinen Sohn auf den Arm genommen, sich zwischen allen hindurchgedrängt und die Flucht ergriffen. Von ein wenig weiter weg hatte man es wieder knallen gehört. Hinter der Menge.
»Wir sind in die entgegengesetzte Richtung losgerannt, das heißt zum Absperrgitter hin. Und dort herrschte totale Panik.«
Wieder versuchten alle Freundinnen gleichzeitig, von dem Ereignis zu erzählen. Sebag ließ zu, dass sie ihren Emotionen Luft verschafften, und begnügte sich damit, in aller Eile ein paar Worte mitzuschreiben. Unter dem Ansturm der Menge waren die Absperrgitter umgekippt. Die Mädchen waren gefallen, und zwar auf einige englische Touristen. Andere Zuschauer waren über sie hinweggesprungen. Die Panik hatte auf die Prozession übergegriffen. Eines der Mädchen – eine Brünette mit von Akne entstellten Wangen namens Lisa – hatte gesehen, wie ein junger Träger eines misteri seine Last überstürzt losließ und davonrannte.
»In welche Richtung?«, fragte Sebag interessiert.
»Richtung Castillet.«
Sebags Interesse erlosch; das Drama hatte in der entgegengesetzten Richtung stattgefunden. Doch ein anderer Punkt gab ihm zu denken.
»Er hat doch eine Kapuze getragen, oder?«
»Ja, warum?«
»Woher weißt du dann, dass er jung war?«
Sie sah ihn mit offenem Mund an. Ihre Freundinnen musterten sie ein wenig spöttisch.
»Ich … ich weiß nicht … Diesen Eindruck hatte ich eben …«