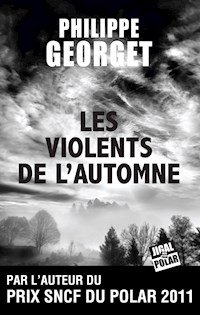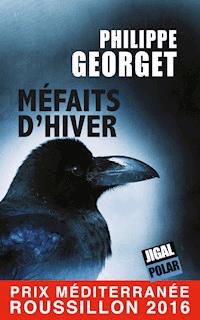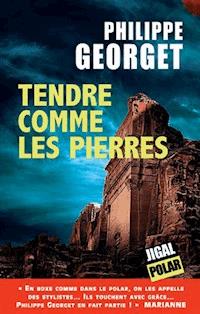8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Inspecteur Gilles Sebag ist gerade aus den Sommerferien zurück, als die Leiche eines Rentners gefunden wird. Offenbar wurde er vom Mitglied einer aus dem Algerienkrieg bekannten Geheimarmee ermordet. Es stellt sich schnell heraus, dass eine 50 Jahre alte Rechnung beglichen wurde. Dann gibt es einen weiteren Toten, der auch in den Algerienkrieg involviert war, und die Sache wird so politisch, dass Gilles aufpassen muss, mit wem er spricht. Als schließlich seine Tochter in den Fall verwickelt wird, muss Gilles sich entscheiden: Karriere oder der heißgeliebte Familienfrieden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Frisch aus den Sommerferien zurückgekehrt, erwartet Inspecteur Gilles Sebag die Leiche eines Rentners – ermordet von einem Mitglied einer Geheimarmee, die aus dem Algerienkrieg bekannt ist. Schnell schürt sich der Verdacht, dass es eine fünfzig Jahre alte Rechnung zu begleichen gab. Als ein weiterer Toter gefunden wird, der in den Algerienkrieg involviert war, wird die Sache endgültig brisant, und Gilles muss tatsächlich aufpassen, mit wem er spricht. Gleichzeitig hat er seiner Tochter versprochen, sich um den Unfalltod eines Klassenkameraden zu kümmern. Und es sieht ganz so aus, als bestünde ein Zusammenhang zwischen dem Unfall und den Morden. Gilles gerät in eine gefährliche Zwickmühle, und es scheint, als müsste er sich entscheiden zwischen seiner Familie und seiner Karriere. Denn noch herrscht keine Ruhe im Roussillon – ein böser Sturm naht …
Der Autor
Philippe Georget wurde 1963 geboren. Nach mehreren Jahren als Journalist für Rundfunk und Fernsehen hat er 2001 seine Familie in einen Campingbus gepackt, um einmal mit ihr das Mittelmeer zu umrunden. Seit seiner Rückkehr lebt er als Autor mit Frau und Kindern in der Nähe von Perpignan und läuft leidenschaftlich gern Marathon. Für seine Krimis hat er in Frankreich mehrere Preise gewonnen.
Von Philippe Georget ist in unserem Hause bereits erschienen:
Dreimal schwarzer Kater
Philippe Georget
Wetterleuchten im Roussillon
Ein neuer Fall für Inspecteur Sebag
Aus dem Französischen von Corinna Rodewald
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
ISBN 978-3-8437-1097-8
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015© 2012 Editions SIGAL Titel der französischen Originalausgabe: Les violents de l’automneUmschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: FinePic®, München
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
1 Wie ein heftiger elektrischer Schlag durchfuhr ihn der Schmerz, als er mit seinem von Arthritis verformten Daumen den Hahn seiner Waffe zurückzog. Mit seiner freien Hand rückte er sich die Brille auf der Nase zurecht. Der Mann, auf den er zielte, riss verängstigt die Augen auf.
Seine geschwollenen Finger umschlossen die Waffe wieder fest.
Es war richtig gewesen, sich als Erstes das schwächste Glied der Gruppe vorzunehmen. Angst machte redselig. Jetzt wusste er alles. Die Dreckskerle würden bezahlen. Einer nach dem anderen.
Unter Schmerzen legte er seinen gekrümmten Zeigefinger auf den Abzug.
Sein Gegenüber bewegte sich verzweifelt auf seinem Stuhl hin und her, trotz der Fesseln, die ihm die Arme hinter der Rückenlehne zusammenhielten. Er hätte wohl geschrien, gebrüllt oder geheult, wäre da nicht der Knebel in seinem Mund gewesen, der ihn nur unter Anstrengung einige gurgelnde unnütze Laute von sich geben ließ.
Wozu diese vergebliche Aufregung? Wenn die Stunde gekommen war, musste man sich damit abfinden können. Es gab nur sie beide hier in dieser verschlossenen Wohnung. Einer von ihnen gefesselt, der andere mit einer Beretta 34 in der Hand. Da gab es keinen Ausweg, kein Happy End, keine überraschende Wendung in letzter Sekunde. Das hier war kein Kinofilm, das war das Leben. Das echte, harte, unbarmherzige Leben.
El mektoub … Das Schicksal würde zuschlagen.
Er fand den Alten vor sich erbärmlich und hässlich. Seine Gesichtszüge wurden von der Angst noch mehr verzerrt als von den vergangenen Jahren. Er erkannte ihn kaum noch.
Die Erinnerungen brachen wie Wellen über ihn ein. Damals, als wäre es gestern gewesen. Die Jahre konnten Brücken schlagen, Mauern errichten oder nur ein kleines Intermezzo sein. Nichts hatte er vergessen. Absolut nichts. Die grelle Sonne und wie sie auf der Haut brannte, wenn er aus einer noch kühlen Gasse trat. Blau, überall Blau, das blaue Meer, der blaue Himmel. Das Rauschen der Wellen, das Schaukeln der Boote, der Duft von Anis, Jod und Gewürzen. Stimmengewirr, unbekümmertes Lachen, diese unvergleichliche Lebensfreude.
Er durfte sich nicht von der Nostalgie überwältigen lassen. Das wusste er. Sie war stärker als er. Mehrere Jahrzehnte lang hatte er alles verdrängt, bis es wieder von seinem Herz und seinem Verstand Besitz ergriffen hatte. Er zwang sich, an die letzten Monate seiner Jugend zu denken, daran, wie das Paradies sich in die Hölle verwandelt hatte, an das Klappern von Töpfen, die Schreie, die Tränen und das Blut. Und an den Geruch von Schießpulver, der über allem hing, dieser schwere, berauschende Geruch, so wuchtig und wild.
Er verzog das Gesicht. Es bereitete ihm Schmerzen, wie er mit seiner kranken Hand die Waffe umklammert hielt.
Der Mann vor ihm war sein Spiegelbild. Er war selbst alt und hässlich. Auch wenn Gabriella ihm glücklicherweise das Gegenteil gelobte.
Er war alt, und er hatte Schmerzen.
Durch starke rheumatoide Arthritis hatten sich seine Gelenke schmerzhaft entzündet. Zunächst hatten sich seine Finger verformt und die letzten Fingerglieder in unmögliche Winkel gebracht. Dann waren seine Hände wund geworden. Im Laufe der Jahre und der schlaflosen Nächte waren hier und dort Beulen aufgetaucht. Beim Gedanken an Gabriella, die gern mit ihren Feenhänden über seine Buckel strich, musste er lächeln.
Buckel … Der Begriff kam ihm überholt vor. Vielleicht, weil sein Französisch Anfang der sechziger Jahre stehengeblieben war. Seitdem redete er nicht mehr in seiner Muttersprache.
Sein Gefangener auf dem Stuhl schien sich beruhigt zu haben. Hatte er sich nun damit abgefunden? Vielleicht … Oder aber er hatte sein flüchtiges Lächeln eben für mögliche Gnade gehalten. Die Hoffnung ist ein nicht zu bändigender Phönix, sie braucht nur ein Zeichen, einen Lufthauch, und schon ist sie wieder auferstanden. Doch genauso kann sie durch einen einzigen Blick jäh ersterben.
Ihre Blicke trafen sich, und sie sahen einander wenige Sekunden an, bevor sie gleichzeitig auf die drei mit schwarzer Farbe an die Wohnzimmertür gemalten Buchstaben schauten.
Drei verfluchte Buchstaben.
Drei magische Buchstaben.
Es würde keine Vergebung geben. Auf keinen Fall. Er hatte nicht umsonst seinen Kummer wieder erweckt, war nicht umsonst so weit gereist und hatte das Meer überquert, nur um jetzt einen Rückzieher zu machen. Er würde seinen sich selbst auferlegten Auftrag bis zum Ende durchführen.
Seine letzte Mission.
Seine Zunge klebte ihm am Gaumen. Er hatte Durst. Langsam stand er auf. Seine Knochen ächzten, und er unterdrückte ein Stöhnen. Die Krankheit hatte sich von seinen Händen über seinen gesamten Körper ausgebreitet. An manchen Tagen war es ein einziges Leid, einfach nur zu existieren. Er musste an seine Großmutter denken. Auch sie hatte Höllenqualen erlitten. »Wenn ich keine Schmerzen mehr habe«, hatte sie oft zu ihm gesagt, »dann weil ich gestorben bin.«
Er nahm ein sauberes Glas von der Arbeitsplatte neben der Spüle und füllte es mit Wasser aus dem Hahn. Er trank ein paar Schlucke und stellte es dann wieder ab. Als er zu dem alten, an den Stuhl gefesselten Mann zurückging, nahm er das Kissen, das er vorhin aus dem Schlafzimmer geholt und auf den Tisch gelegt hatte.
Nicht mehr lange und aus dem Mann würde sein Opfer.
Ihn überkam ein seltsames, längst vergessenes Gefühl. Diese unerwartete Ruhe, die seine Bewegungen begleitete, der merkwürdige Eindruck, seinen eigenen Körper verlassen zu haben und sich selbst zuzusehen.
Die Geräusche vom Fernseher der Nachbarn drangen durch die Wand. Man erahnte die eingeblendeten Lacheinlagen einer amerikanischen Sitcom. Er hätte gern auch hier im Wohnzimmer den Fernseher eingeschaltet, um den Schuss zu übertönen, der gleich erschallen würde, überlegte es sich aber angesichts der komplizierten Fernbedienung schnell anders.
Sein Gegenüber riss die verklebten Augen auf. Wie in einem Buch konnte man die Verzweiflung und Angst darin lesen. Doch der alte Mörder sah und hörte nichts mehr; er war woanders. Dort. Fünfzig Jahre zuvor.
»Es ist so weit«, sagte er.
Dann ging er um den Stuhl herum und drückte seinem Gefangenen das Kissen in den Nacken. Er zielte mit der Beretta 34 auf den verblichenen Stoff. Mit seinem verformten Zeigefinger strich er über den Abzug. Er zählte bis drei, und dann drückte er ab. Die Druckwelle fuhr durch seine geschundenen Knochen, und er schrie vor Schmerzen auf.
2 Ein paar Tage lang hatte die Tramontana gewütet, doch jetzt hatte sie sich wieder beruhigt. Sie hatte die letzten Wolken vom Himmel gefegt, und die noch intensive Herbstsonne trocknete die Pfützen auf dem Asphalt ebenso wie die Tränen auf den Wangen.
Es war ein schöner Tag für die Beerdigung eines Kindes.
Die ganz in Schwarz gekleidete Menschenmenge hatte sich um die kleine Kirche von Passa versammelt. An die hundert Gäste hatten keinen Platz mehr gefunden und verfolgten die Trauerfeier stehend vom Dorfplatz aus. Obwohl Gilles Sebag als einer der Ersten angekommen war, war er doch lieber draußen geblieben. In der Kirche selbst war die Verzweiflung zu groß, der Schmerz zu privat.
Er stand an eine Hauswand gelehnt, seine Tochter an sich gezogen. Er spürte, wie sie von Schluchzern geschüttelt wurde. Wie gern wäre er ihr eine größere Stütze gewesen, hätte ihre Qualen auf sich genommen und so ihre Unbekümmertheit bewahrt. Ihre Unschuld. Aber Séverine war dreizehn und hatte gerade auf brutale Art und Weise gelernt, dass der Tod endgültig war. Das Leben war kein Computerspiel. Es gab keinen Neustart, wenn es »game over« hieß. Mathieu würde nicht noch einmal von vorn anfangen können.
Claire strich Séverine sanft über die Haare. Gilles drehte sich zu seiner Frau um und lächelte sie an. Es tat gut, sie neben sich zu wissen, nachdem er solche Angst gehabt hatte, sie letzten Sommer zu verlieren. Doch das hier war nicht der richtige Zeitpunkt, um an all das zurückzudenken, und er vertrieb diese schlechten Erinnerungen schnell wieder. Claire erwiderte sein Lächeln. Ihre sonst leuchtenden grünen Augen blickten ihn traurig an.
Aus der dichtgedrängten Menge ertönten hier und dort herzzerreißende Laute der Trauer. Wie im Kanon stimmten die Jugendlichen eine Totenklage aus Schluchzern, Rufen und Wimmern an. Einige von ihnen waren mit Sicherheit schon mit dem Tod in Berührung gekommen, vermutlich dem ihrer Großeltern. Sie hatten getrauert, aufrichtig Tränen vergossen, waren aber durch diesen Abschied nicht in den Grundfesten ihres Seins erschüttert worden. Der Tod eines Klassenkameraden aber führte ihnen ihre eigene Sterblichkeit vor Augen. Zur Trauer gesellte sich jetzt eine dumpfe Angst.
Um sich nicht von der Trauer der Jugendlichen überwältigen zu lassen, betrachtete Gilles Sebag die Gebäude um ihn herum. Die Kirche von Passa hatte leider keinen besonderen Charme. Die Fassade war betonfarben verputzt und hatte zur einzigen Verzierung einen marmornen Torbogen, zu dem eine halbkreisförmige Treppe hinaufführte. Die Kirche selbst war eingepfercht zwischen einer Reihe reizloser Dorfhäuser. Immerhin war das Postgebäude auf der linken Seite mit seinem Mauerwerk aus Kieseln, die typisch für das Roussillon waren, ganz ansehnlich, ohne dass sie den Betrachter aber in Begeisterung versetzten.
Die Fensterläden waren geschlossen, denn die Post hatte an diesem Samstagvormittag wegen der Beerdigung nicht geöffnet.
Mathieu war drei Tage zuvor bei einem Unfall auf einer Straße in Perpignan mit seinem Motorroller gestorben. Ein Lieferwagen war plötzlich ausgeschert, und Mathieu, der ihm gerade entgegenkam, hatte nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Der Zusammenprall war heftig gewesen, aber der Junge schien sich zuerst ohne offensichtliche Verletzung wieder aufzurappeln. Er sprach sogar mit dem Fahrer, und sie beschlossen gemeinsam, trotzdem den Krankenwagen zu rufen. Nur um sicherzugehen. Bevor der Notarzt jedoch eintraf, brach Mathieu urplötzlich zusammen. Innere Blutung. Alles ging ganz schnell. Die Ärzte hatten nichts mehr unternehmen können.
Mathieu … Ein Freund von Séverine. Schüler der achten Klasse, der Quatrième, am Collège von Saint-Estève. Rugbyspieler, sportlich. Ein Junge, der eigentlich noch das ganze Leben vor sich hatte.
Verdammter Roller!
Der schwarze Leichenwagen bahnte sich im Rückwärtsgang einen Weg durch die Menge. Der Gottesdienst war vorbei. Die Angestellten des Bestattungsinstituts öffneten die Wagentüren und begannen, die Blumenkränze darin zu verstauen. Die Trauergäste bildeten eine lange Reihe auf dem Vorplatz, um Mathieus Familie in der Kirche ihr Beileid auszusprechen. Séverine löste sich von ihren Eltern und stellte sich zu ein paar ihrer Freundinnen. Gilles machte Anstalten, ihr zu folgen, doch Claire hielt ihn zurück. Im gleichen Moment warf Séverine ihm einen Blick über die Schulter zu, der besagte, dass sie lieber allein hineingehen wollte. Oder besser gesagt, mit ihren Freundinnen. Jedenfalls ohne ihn.
Das versetzte ihm einen Stich, und darüber ärgerte er sich. Es fiel ihm schwer zuzusehen, wie seine Tochter viel zu schnell älter wurde, aber auch das war ein Thema, für das dies hier der falsche Ort und der falsche Zeitpunkt waren. Séverine lebte. Nichts anderes zählte. Mathieus Eltern dagegen würden nie das Glück erleben, ihren Sohn erwachsen werden zu sehen.
Die Glocke fing an zu läuten. Ein trauriger Schlag gefolgt von einem langgezogenen klagenden Echo. Die Leute hoben den Kopf. Oben auf der Kirche befand sich ein viereckiger Turm mit zwei Glocken darauf. Die kleinere schwang sacht hin und her, und ihr Läuten erhob sich über das Dorf und trug ihre Klage weit über die mit Weinstöcken bedeckten Hügel.
Langsam leerte sich die Kirche. Ein Schauer lief durch die Menge, als die Eltern heraustraten. Der Vater folgte kerzengerade dem Sarg seines Sohnes, wiegte aber den Kopf hin und her, als hätte ihn ein Fausthieb erwischt und benebelt. Neben ihm, unterstützt von einer jungen Frau, ging beschwerlich seine Ehefrau. In der jungen Frau erkannte Gilles Mathieus große Schwester. Er hatte sie zwei oder drei Mal in den letzten Jahren gesehen, als er seine Tochter zu Mathieus Geburtstagsfeiern gebracht hatte. Jetzt kam auch Séverine zusammen mit ein paar anderen Jugendlichen wieder aus der Kirche. Sie hatten einander untergehakt, und Séverines Wimperntusche war zerlaufen und zeichnete eine Tränenspur auf ihre runden Wangen.
Der Sarg wurde in den Leichenwagen geschoben, und der Trauerzug setzte sich in Richtung Friedhof in Bewegung. Das Schluchzen der Schüler klang beinahe wie ein Trauergesang im Chor. Claire nahm Gilles bei der Hand, und sie folgten der Prozession drei Reihen hinter ihrer Tochter. Gilles konnte seine Gefühle kaum unterdrücken, und er biss sich auf die Lippe, dass es fast blutete. Er musste stark bleiben, sich stark geben. Für Séverine, für ihre Freunde, und auch für die anderen.
Sicher, er hatte so etwas schon häufig erlebt, bei seinem Beruf. Wie oft schon hatte er jemandem vom Tod eines ihm Nahestehenden berichten müssen? Den Eltern, dem Ehepartner … einem Kind. Er hatte sich lange vorgeworfen, dass er nie die richtigen Worte fand, um den Schmerz zu lindern. Bis er begriffen hatte, dass er sie nie finden würde. Weil es dafür keine richtigen Worte gab. Ganz einfach.
Der Wagen hielt vor den Toren zum Friedhof. Die Mitarbeiter luden den Sarg aus und trugen ihn vor der Menge her an einer Reihe von Familiengräbern vorbei. Gilles lehnte sich an die Friedhofsmauer und zündete sich eine Zigarette an. Er rauchte nur selten. Auf dem Weg hierher hatte er sich eine Schachtel gekauft. Claire nahm ihm die Zigarette aus der Hand, zog daran und reichte sie ihm dann wieder.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
Sie zuckte die Schultern. »Bei dir?«
»Auch.«
Er reichte ihr wieder seine Zigarette. Gegenüber vom Friedhof standen ein paar Bauarbeiter und rauchten ebenfalls. Sie hatten ihre Arbeit niedergelegt, als der Trauerzug vorbeigekommen war, und warteten jetzt ab, bis die Zeremonie beendet war, bevor sie ihre Erdarbeiten mit den ratternden Maschinen wieder aufnahmen. Ihrem bisherigen Voranschreiten nach zu urteilen, waren das die Anfänge eines neuen Wohngrundstücks. Noch eines. Jedes Jahr zogen fünftausend neue Anwohner in das Département Pyrénées-Orientales; die mussten schließlich irgendwo untergebracht werden.
Gilles sah, dass Séverine wieder auf sie zukam, begleitet von zwei Freundinnen. Die Mädchen hatten einander die Arme um die Taille gelegt, was ihnen einen wiegenden Gang verlieh. Die Trauerkleidung ließ sie reifer wirken, erwachsener. Richtige Damen, dachte Gilles. Aber das stimmte gar nicht. Wenn er darüber nachdachte, war es nicht ihre Kleidung. Es war die Trauer an sich, die sie reifer werden ließ.
Es zerriss ihm das Herz, wie die Mädchen so mit ihren geröteten Augen vor ihm standen. Sie sahen aus, als hätten sie einen ganzen Strauch Cannabis geraucht. Was für ein bescheuerter Vergleich, schimpfte er innerlich mit sich selbst; man musste wirklich Bulle sein, wenn man in so einem Augenblick an so etwas dachte.
»Papa, ich muss dich was Wichtiges fragen«, sagte Séverine. Sie sah ihn flehentlich an. »Mathieus Schwester hat gesagt, dass der Unfall nicht komplett aufgeklärt wurde, und dass der Fahrer vom Lieferwagen vielleicht nicht allein verantwortlich ist … Anscheinend hält die Polizei die Angelegenheit aber für erledigt und will nicht weiter ermitteln.«
Gilles wartete, dass sie weiterredete, aber er konnte sich schon denken, was nun kam.
»Ich habe ihr gesagt, dass du vielleicht …«
Seine erste Reaktion war ein Blinzeln. Es war Samstag, übermorgen würde er nach einer Woche Urlaub wieder aufs Revier gehen, und nach dem, was er von seinem Kollegen Jacques Molina gehört hatte, war alles ruhig. Er hätte also vermutlich Zeit, einen Blick in die Akte zu werfen.
»Ich sehe, was ich tun kann«, versprach er.
Séverine lächelte ihn durch ihre Traurigkeit an und fügte mit ihrer flötenden Stimme hinzu: »Ich habe ihr gesagt, falls es etwas zu finden gibt, dann findest du es.«
Trotz seines Kummers überkam ihn ein Glücksgefühl. Die Trauer hatte seine Tochter also doch nicht vollkommen verwandelt: Sie war immer noch ein dreizehnjähriges Mädchen, ein Kind, das daran glaubte, dass sein Vater Wunder vollbringen konnte …
»Ich habe ihr auch gesagt, dass du der beste Polizist von ganz Perpignan bist. Stimmt doch, oder?«
Er versuchte, zuversichtlich zu nicken, und gab ihr einen Kuss auf die feuchte, kühle Wange.
3 »Guten Morgen, Lieutenant! Hatten Sie einen schönen Urlaub?«
Gilles Sebag drehte sich um und merkte erst dann, dass die Frage an ihn gerichtet war. Lieutenant … Schon vor über fünfzehn Jahren hatte die damalige Regierung die Polizei modernisieren wollen, indem sie einfach nur die Dienstgrade amerikanisierte, aber Gilles hatte sich immer noch nicht daran gewöhnt. Dazu würden ihm die Begriffe »Lieutenant« und »Capitaine« auch immer zu fremd und albern wie aus einer amerikanischen Fernsehserie vorkommen. »Lieutenant Columbo«, wie er in der englischen Fassung und auch der französischen Synchronisation hieß, oder »Lieutenant Horatio Caine«, klar, das klang großartig, aber »Lieutenant Sebag«, das war doch ein Witz! Er fand das ebenso lächerlich, wie wenn man einen angelsächsischen Vornamen vor einen eindeutig französischen Nachnamen setzte. Politiker entpuppten sich eben manchmal als genauso dumm wie der durchschnittliche Franzose. Manch einer mochte das ja beruhigend finden. Er nicht.
Ihm wurde schließlich bewusst, dass Martine, die junge Polizistin am Empfang des Kommissariats von Perpignan, auf eine Antwort wartete.
»Urlaub ist immer schön. Es wird erst wieder schlimm, wenn er vorbei ist.«
Martine war so freundlich und lächelte. »Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, und nur Mut!«
»Den werde ich brauchen …«
»Man könnte meinen, man würde Sie zur Schlachtbank führen!«
Gilles begnügte sich mit einem höflichen Lächeln. Er hielt seine Dienstmarke an den Scanner. Die Sicherheitstür ging auf, und er trat in den für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Bereich des Kommissariats. Der vertraute Geruch nach Chlorreiniger, Schweiß, kaltem Kaffee und schmutzigem Lachen bereitete ihm keine Freude. Er lief die Treppen zu seinem Büro hoch, nicht weil er es eilig hatte, sondern weil er als anständiger Marathonläufer keine Gelegenheit verstreichen ließ, um sich fit zu halten.
Im zweiten Stock angekommen, zögerte Gilles seinen fälligen Dienstantritt noch etwas hinaus und blieb am Wasserspender auf dem Flur stehen. Er goss sich einen Plastikbecher voll ein und trank ihn langsam aus. Seit ein paar Jahren fand er seine Arbeit immer mühsamer. Der Alltagstrott, die Gewalt, die fehlende Anerkennung auf dem Revier und die Geringschätzung seiner Mitbürger. All das musste man einstecken, und wofür? Er war Polizist geworden, weil er sich als eine Art Arzt für eine kranke Gesellschaft gesehen hatte. Es hatte gedauert, bis er verstanden hatte, dass er nur ein kleiner Krankenpfleger war, dazu verurteilt, eitrige Wunden mit abgelaufener Heilsalbe zu verbinden. Die Kriminalität würde niemals ein Ende finden, das konnte sie gar nicht, sie lag in der Natur des Menschen. Man konnte gerade mal darauf hoffen, das Fieber ein wenig zu senken. Nur war noch nicht einmal ein verlässliches Thermometer erfunden worden.
Er trank noch einen Becher und richtete seine Gedanken auf Séverine und Mathieus Eltern. Er würde weder die Polizei noch die Gesellschaft eigenhändig verändern können, aber ein paar Menschen konnte er trotzdem etwas Trost bringen. Es genügte, wenn er sich auf bescheidene Ziele konzentrierte und ein bisschen in die Gänge kam. Er zerdrückte seinen Becher und warf ihn in den Mülleimer. Dann ging er energischen Schrittes auf sein Büro zu.
Er stieß die Tür auf, und zu seiner großen Überraschung war sein Kollege Jacques Molina schon da.
»Na, bist du heute aus dem Bett gefallen?«, fragte Gilles und hängte seine Jacke über die Rückenlehne seines Stuhls.
»Man sagt guten Morgen, wenn man höflich sein will«, entgegnete Jacques.
»Guten Morgen, wenn man höflich sein will.«
»Du bist aber nicht besonders in Form. Wenn dein Urlaub vorbei ist, hast du ja immer so was wie einen Kater.«
»Irgendwie schon. Ich wusste ja, dass es nicht leicht sein würde, aber ich glaube fast, es ist noch schlimmer.«
»Zum Glück bist du nur eine Woche weg gewesen … Kann ich dir einen Kaffee anbieten?«
Gilles konnte einen angewiderten Schauer nicht unterdrücken. Er war leidenschaftlicher Kaffeetrinker, aber das betraf nur echten Kaffee, nicht diese dunkle Brühe, die der Automat in der Cafeteria unten für vierzig Cent ausspuckte.
»Nein, danke. Es ist so schon die reinste Qual, wieder hier zu sein, da will ich mich nicht auch noch vergiften.«
»Wie du willst.« Jacques stand auf. »Ich gehe runter, ich brauche welchen.«
»Haben wir heute Morgen unsere Besprechung mit dem Chef?«
Jeden Montag hielt Commissaire Castello eine allgemeine Besprechung ab, um laufende Fälle zu erörtern.
»Nein, hat er abgesagt. Ich glaube, die Montagmorgen-Besprechungen gehen ihm genauso auf die Nerven wie uns, wenn nichts los ist.«
Jacques verließ das Büro, und Gilles schaltete seinen Rechner an. Der PC fuhr sich nur langsam hoch und gab dabei Geräusche von sich, die eher an eine Dampflok aus den dreißiger Jahren erinnerten als an Technik aus dem dritten Jahrtausend. Aus der dritten Schublade seines Schreibtischs holte Gilles drei Fotos hervor, die sein berufliches Universum freundlicher gestalteten. Er stellte eines nach dem anderen hin: Claires sonnenbeschienenes Gesicht vor einem schwimmbadblauen Hintergrund, Séverine, die freudestrahlend die dreizehn Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte ausbläst, und schließlich Léo, sein Sohn, wie er stolz auf seinem glänzenden Motorroller sitzt. Gilles wurde ganz anders, als er wieder an Mathieus Unfall dachte. Nicht Léo, nein, niemals … Er ärgerte sich, dass er der Überredungskunst seiner Frau und seines Sohnes nicht gewachsen gewesen war. Er hatte schließlich ja zum Roller gesagt, und seit einem Jahr fuhr Léo auf dieser Todesmaschine durch die Gegend.
Der Computer war endlich hochgefahren. Gilles sah davon ab, seine Mails abzurufen. Eine Woche Urlaub … Es gäbe zu viele Hausmitteilungen, Protokollkopien, Gewerkschaftsinfos, Werbung, vielleicht auch ein paar persönliche Nachrichten. Er wusste, wenn er sich daranmachte, selbst »nur für fünf Minuten«, dann würde er erst nach einer guten halben Stunde wieder den Blick vom Bildschirm lösen können. Er klickte also direkt auf die Datenbank des Reviers. Ein Passwort, ein Klick auf den Reiter »Verkehrsunfälle«, und da fand er auch schon Mathieus Akte. Er suchte nach der Unterschrift unten auf dem Dokument. Lieutenant Cardona. Der Abteilungsleiter höchstpersönlich. Ein mürrischer und nicht immer besonders gewissenhafter Bulle. Das war sowohl eine schlechte als auch eine gute Nachricht. Denn auch wenn es durchaus möglich war, dass diesem Kollegen Details entgangen waren, die Gilles selbst aufdecken konnte, wusste er doch, dass er sich damit eine Menge Ärger einhandelte. Sei’s drum. Für Séverine würde er alles auf sich nehmen.
Er begann gerade, das Protokoll durchzulesen, als Jacques unvermittelt die Tür aufstieß.
»Lass die Computerspiele sein und zieh deine Jacke an«, rief er außer Atem. »Wir haben zu tun.«
Gilles sah auf. Jacques ging an seinen Schreibtisch.
»Eine Leiche in einer Wohnung in Moulin-à-Vent, Place de Montbolo. Heute Morgen von einer Nachbarin gefunden.«
Er griff ein Parfumfläschchen und sprühte sich damit ausgiebig unter das Hemd.
»Der Kerl ist seit mindestens drei Tagen tot. Der Gestank hat auf ihn aufmerksam gemacht.«
Gilles nahm eine Schachtel Taschentücher, zog zwei daraus hervor und gab ein paar Tropfen Lavendelöl darauf.
»Ich bin gewappnet«, kündigte er an, während er noch auf »ausdrucken« für Mathieus Akte klickte. »Natürlicher Tod, Selbstmord, Mord, gibt es schon Hinweise?«
»Laut Rettungsdienst klebt überall an den Wänden Hirnmasse, und das Opfer hat hinten am Kopf eine schöne glatte Schusswunde.«
Gilles stand auf.
»Verstehe. Da gibt es wirklich natürlichere Todesursachen. Und für einen Selbstmord müsste er schon ein Schlangenmensch gewesen sein …«
»Wäre unser Opfer, ein gewisser Bernard Martinez, nicht an einen Stuhl gefesselt gewesen.«
»Okay, das schränkt die möglichen Hypothesen noch mehr ein.«
Der Drucker spuckte die ersten Seiten aus. Gilles zog seine Jacke über. Wahrscheinlich würde er Mathieus Unfall heute keine Zeit widmen können und müsste die Akte mit nach Hause nehmen, um sie nach dem Abendessen noch durchzuackern. Was für ein hübsches Programm für seinen ersten Arbeitstag.
»Der Gestank ist wirklich unerträglich.«
Thierry Lambert, ihr junger Kollege, sah in etwa so bleich aus wie eine Kloschüssel in einem Luxushotel.
»Und trotzdem musst du da durch«, entgegnete Jacques. »Übung macht den Meister.«
Gilles Sebag und Jacques Molina hatten Lambert in der Wohnung an der Place Montbolo getroffen. Die drei Polizisten warteten im Flur und sahen von weitem den Kriminaltechnikern in ihren Overalls zu, wie sie sich im Wohnzimmer rund um die Leiche zu schaffen machten. Gilles wedelte mit seinen parfümierten Taschentüchern vor sich umher, und ein paar Augenblicke lang verscheuchte er so den herb-süßlichen Geruch des Todes. Lambert war als Erster am Tatort eingetroffen und hatte sich bereits einen schnellen Überblick verschaffen können.
»Der Mann war schon ziemlich alt, würde ich sagen, mindestens siebzig. Aber ihm fehlt ein Teil vom Gesicht. Die Kugel hat beim Austreten ganz schönen Schaden angerichtet.«
»Wahrscheinlich ein Raubmord«, vermutete Jacques. »Einbrecher, die wollten, dass der Alte ihnen verrät, wo er seine Ersparnisse versteckt.«
»Aber warum sollten sie ihn dann umbringen?«, wollte Lambert wissen.
»Weil er sich geweigert hat zu reden oder weil er sie wiedererkannt hätte.«
»Glaubst du?« Der junge Kollege war entrüstet. »Die Schweine! Ich hoffe, die bringen wir schnell hinter Gitter.«
Gilles hörte nur mit halbem Ohr zu und sah sich im dunklen Flur um. Verblasste Tapete, Schwarzweißfotografien, ein abgenutzter blasslila Teppich und ein rundes goldenes Tischchen mit einem Telefon darauf. Außer der Tür zum Wohnzimmer gab es noch drei weitere.
»Was sagst du dazu?«, fragte Lambert ihn.
»Ich? Momentan noch gar nichts. Ich habe noch nichts gesehen, also kann ich auch nichts dazu sagen.«
Er sah sich die Fotos genauer an. Auf allen war die gleiche Stadt zu sehen, weiße Häuser am Meer.
»Immer ganz der Bedächtige«, warf Jacques ihm vor. »Du machst dich nicht nass.«
Gilles zuckte die Schultern. »Ich will nur keine vorgefertigte Meinung haben, wenn ich an einem Tatort ankomme. Davon bekommt man nur Scheuklappen. Ein Bulle sollte seine Phantasie im Zaum halten.«
»Hast du mitgeschrieben, Thierry?«, scherzte Jacques. »Lektion Nummer eins von Inspecteur Sebag.«
Gilles wedelte wieder mit seinem Lavendelstrauß aus Papier. »Lektion Nummer zwei: Ein guter Bulle ist wie ein Schwamm. Er muss alles aus seiner Umgebung in sich aufnehmen.«
Er faltete die Hände vor seinem Bauch, hob sie auf Höhe seines Brustkorbs und breitete dann die Arme in einem großen Halbkreis aus.
»Man hält den Mund, man beobachtet, man hört genau hin, man guckt, man atmet. In aller Ruhe. Und man schreibt alles auf. Das hilft einem später.«
Mit einer Handbewegung hielt er Lambert zurück, der sich schon bereitmachte, seinen Ratschlägen Wort für Wort zu folgen. »Wenn ich sage, man atmet, ist das eher rhetorisch gemeint. Geh das heute erst mal langsam an. Ich lege keinen besonderen Wert darauf, dass dein Frühstück auf meinem Hemd landet.«
Während Jacques schallend lachte, öffnete Gilles die anderen Türen: ein Schlafzimmer, eine Toilette und ein Badezimmer. Auf der Ablage über dem Waschbecken entdeckte er zwei Zahnbürsten. Er drehte sich zu Lambert um.
»Ich dachte, Monsieur Martinez würde allein leben.«
»Das hat mir die Nachbarin gesagt, als ich ankam.«
»Willst du sie nicht noch einmal sprechen und ihre Aussage aufnehmen, damit wir ein bisschen mehr über das Opfer erfahren? Und dann kannst du auch gleich die anderen Nachbarn befragen. Als wir ankamen, standen mindestens ein Dutzend Schaulustige auf der Treppe, das können wir doch ausnutzen.«
»In Ordnung, kein Problem.«
Hocherfreut darüber, der olfaktorischen Tortur zu entkommen, hatte Lambert schon eine Hand auf den Türknauf gelegt, als er noch einmal innehielt. »Ach so, da ist noch etwas: An der Tür stand etwas geschrieben.«
»An welcher Tür?«, wollte Gilles wissen.
»An der Wohnzimmertür.«
»Dieser hier?« Gilles deutete auf die geöffnete Tür.
»Ja. Also, auf der anderen Seite. Sonst würdest du es ja sehen.«
»Und was stand da?«
»Weiß ich nicht.«
»Hast du es nicht gelesen?«
»Doch, schon … Es sind drei Buchstaben. Aber ich weiß nicht, was die heißen sollen, das kann kein Französisch gewesen sein.«
Gilles war nicht sicher, ob er das richtig verstand. »Ein Wort mit drei Buchstaben … auf einem Zettel an der Tür?«
»Nein, direkt auf die Tür geschrieben, ganz groß und mit schwarzer Farbe.«
»Mit Farbe? Was war das für ein Wort?«
»Ich sag doch, das weiß ich nicht, es war nichts Französisches.«
»Aber drei Buchstaben, an die kannst du dich doch wohl erinnern!«
»Puh, da hab ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, es fing mit einem O an.«
Gilles hörte Jacques hinter sich prusten.
»Ist das schlimm?« Lambert klang besorgt.
»Für die Ermittlungen, nein, wir können uns das gleich noch ansehen, aber für dich ja, wenn du dir nicht einmal drei Buchstaben merken kannst …«
»Mir fällt da ein Wort ein, das du dir ganz leicht merken kannst«, schaltete Jacques sich ein. »Das ist zwar länger, aber da ist auch ein O drin, vorletzter Buchstabe.«
»Ja, ja, schon verstanden. Ich bin doch nicht …«
Lambert brach ab, starrte seine amüsierten Kollegen an und schlug die Tür hinter sich zu.
»Ich glaube, du hast ihn vergrault«, stellte Gilles fest.
»Dafür gilt das Gleiche: Übung macht den Meister. Das Problem bei Lambert ist bloß, dass er ganz schön viel Übung braucht.«
Jacques sah auf die Uhr und brummte. »Die sind jetzt schon seit über einer Stunde da drin. Mir kommt es vor, als würde der ganze Quatsch jedes Mal länger dauern. Und all das nur, um ein paar Arschhaare in ein Reagenzglas zu stopfen.«
»Was für eine herrliche Auffassung unserer Arbeit! Ein bisschen Wertschätzung ist doch immer schön.«
Jean Pagès, Leiter der Kriminaltechnik von Perpignan, war mit seinem typischen weißen Overall bekleidet in den Flur getreten. Er sah Jacques Molina mit unverhohlener Geringschätzung an. Gilles versuchte, den sich anbahnenden Konflikt abzuwenden.
»Du kennst doch Jacques, der ist noch von der alten Schule.«
»Ja, ich weiß«, murrte Pagès, »und zwar von der, wo Verhöre noch mit Körpereinsatz geführt werden und es vor Justizirrtümern nur so wimmelt.«
»Ein ordentlicher Hieb mit dem Telefonbuch auf den Schädel fördert oft mehr Beweise zutage als eure DNS-Proben«, hielt Jacques sofort dagegen. Er gefiel sich in der Rolle des stumpfen Bullen.
Gilles ging dazwischen. »Seid ihr fertig, können wir rein?«
»Ja, alles bereit. Wir sehen uns jetzt in den anderen Zimmern um. Ich hoffe, ihr habt nicht alles durcheinandergebracht.«
»Ich habe einen Blick hineingeworfen, bin aber nicht reingegangen«, erklärte Gilles.
»Solange der Neandertaler hier im Flur geblieben ist, habe ich kein Problem damit.«
Gilles schob Jacques ins Wohnzimmer, bevor der antworten konnte. Der Verwesungsgeruch wurde noch stärker. Elsa Moulin, Pagès’ Assistentin, hatte davon unbeeindruckt ihre Utensilien zusammengeräumt und machte gerade Fotos.
»Dein Overall steht dir einfach unglaublich gut«, begrüßte Jacques sie und strich ihr über die Plastikhaube, die ihre Haare bedeckte. »Dieser Aufzug macht mich wirklich immer mehr an. Du musst mich irgendwann mal zum Essen bei dir einladen oder mir die Sachen für eine meiner Freundinnen leihen.«
Elsa Moulin zog ihren Mundschutz unters Kinn und streckte ihm die Zunge raus. »Ich leih ihn dir, wann immer du willst!«
Das Wohnzimmer war ungefähr dreißig Quadratmeter groß und durch einen Tresen von der Küche abgeteilt. Eine Fenstertür führte auf den sonnenbeschienenen Balkon. In der Mitte des Raums thronte ein Tisch mit einem rot-weiß karierten Wachstuch darauf. Dazu gehörten vier Stühle: Zwei davon standen noch ordentlich unter den Tisch geschoben, auf dem dritten hing die Leiche, der vierte stand ihr gegenüber. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, wie der Täter vor seinem Opfer gesessen und es angesehen hatte. Oder mit ihm geredet hatte.
»Kannst du kurz für uns zusammenfassen?«, bat Gilles die junge Frau. »Molina hat deinen Boss beleidigt.«
Elsa Moulin näherte sich der Leiche, die von den Fesseln an den Handgelenken auf dem Stuhl gehalten wurde. Was vom Kopf übrig war, hing auf der rechten Schulter. Elsa zeigte auf die Schusswunde hinten am Kopf.
»Die Kugel ist hier eingetreten und mitten im Gesicht wieder ausgetreten.«
Sie schob den Kopf des Opfers hoch. Der Mann hatte keine Nase mehr, und ein Teil der rechten Wange fehlte.
»Ein Nahschuss?«, fragte Jacques.
»Nicht ganz.« Sie deutete auf ein in eine Plastikhülle verpacktes Kissen. »Das hat der Täter als Schalldämpfer benutzt.«
»Und das hat gereicht?«, wunderte sich Jacques.
»Anscheinend schon, es hat sich ja niemand gemeldet.«
»Seit wann ist er deiner Meinung nach tot?«, wollte Gilles von Elsa wissen.
»Die Verwesung hat schon stark eingesetzt. Der Nase nach – und das ist ausnahmsweise mal wörtlich zu nehmen – würde ich schätzen seit fünf, vielleicht auch sechs Tagen.«
»Wahnsinn, stell dir das vor!«, sagte Jacques. »Sechs Tage, und niemand macht sich Sorgen um ihn, das ist wirklich unglaublich. Früher hätte es so was nicht gegeben, aber heutzutage, verdammt, da regieren wirklich nur noch Egoismus und Gleichgültigkeit. Verfluchte Gesellschaft, in der wir da leben … Scheiße!«
Gilles ließ seinen Kollegen wettern, obwohl ihm Jacques’ Ausbruch wenn auch treffend doch vergeblich erschien. Man konnte schnell mal eben große Reden über ehrenwerte Absichten schwingen, das dann aber auch in die Tat umzusetzen war eine ganz andere Sache. Wenn Gilles seinen Kollegen über seine Nachbarn reden hörte, dann nur, wenn der sich über sie beschwerte. Er selbst hatte den Kontakt zu seiner Umgebung immer auf das Nötigste begrenzt, und er bezweifelte, dass er mitbekäme, wenn in einem seiner Nachbarhäuser ein Unglück passierte. Warum sich also aufregen, wenn man nicht in der Lage war, sein eigenes Verhalten zu ändern? Nicht der Egoismus oder die Gleichgültigkeit in Frankreich heutzutage erschütterten ihn, sondern die Tatsache, dass man immer mehr Besserwissern begegnete und immer weniger Menschen, die selbst mit gutem Beispiel vorangingen.
»Fünf, vielleicht sechs Tage«, wiederholte er laut. »Da wird es nicht leicht, zuverlässige Zeugenaussagen zu bekommen.«
»Der Gerichtsmediziner wird noch genauer sein können. Die Zimmertemperatur ist in etwa konstant gewesen, da wird er keine Probleme haben, ein Zeitfenster von wenigen Stunden zu bestimmen.«
Diese gute Nachricht hörte Gilles gern.
»Was meinst du, wie alt das Opfer war?«
»78.«
Beide Inspecteurs machten keinen Hehl aus ihrer Überraschung angesichts dieser exakten Angabe. Elsa Moulin grinste breit. Mit einer Kopfbewegung deutete sie auf die Kommode.
»In der linken Schublade findet ihr alle nützlichen Unterlagen. Ausweis, Führerschein, Versichertenkarte, Steuererklärung, etc.«
Gilles näherte sich der Leiche. Ein offenbar harmloser kleiner, alter Mann, in einen dreckigen und abgetragenen Morgenmantel gekleidet, der den Blick auf ein Unterhemd freigab, aus dem drei jämmerliche weiße Brusthaare hervorlugten.
»Laut seiner Papiere hieß der Tote Bernard Martinez. 1934 in Algier geboren.«
Algier … Natürlich. Die weiße Stadt auf den Fotos im Flur.
»Aber das Interessanteste ist das hier.« Elsa ging zur Wohnzimmertür.
Sie schloss die Tür, und Gilles entdeckte besagtes Wort, die drei mit schwarzer Farbe gemalten Buchstaben, an die Lambert sich nicht erinnern konnte. »Was für ein Idiot, aber wirklich«, sagte er sich.
Auch wenn sie nicht durch Punkte voneinander getrennt waren, so war doch klar, dass die Buchstaben kein Wort bildeten, sondern eine Abkürzung. Und nichts daran war fremd. Auch wenn Gilles sich nicht besonders gut in Geschichte auskannte, so kannte er doch diese drei Buchstaben. Sie standen für die Organisation, die fünfzig Jahre zuvor in den Straßen von Algier ihr Unwesen getrieben und die arabische Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt hatte.
OAS.
OAS, Organisation armée secrète. Organisation der geheimen Armee.
Wie ein Todesurteil stand das Emblem an der Tür. Jacques ging darauf zu und sah es sich ebenfalls genauer an. Er gab einen langen Pfiff von sich.
»Verdammte Scheiße!«
4 Mit einer Handbewegung bat Commissaire Castello um Ruhe. Sein sorgfältig gestutzter graumelierter Bart verdeckte nicht das zufriedene Lächeln auf seinen Lippen. Trotz der vor kurzem von oben angeordneten Veränderungen in Bezug auf seine Aufgaben war und blieb der Chef des Kommissariats von Perpignan ein Praktiker und erfreute sich nicht so sehr an Statistiken: Nichts brachte ihn mehr in Fahrt, als »seine Männer« zusammenzutrommeln und mit ihnen über einem wichtigen Fall zu brüten. Als er vom Mord in Moulin-à-Vent erfahren hatte, hatte er sofort seine gesamte Mannschaft mobilisiert. Sieben Männer insgesamt. Joan Llach und François Ménard hatten am späten Vormittag ihre aktuellen Fälle liegenlassen müssen, damit sie Sebag, Molina und Lambert helfen konnten. Raynaud und Moreno hingegen, die beiden Unzertrennlichen, hatte man nicht früher erreicht, und sie waren gerade erst zu ihren Kollegen im Besprechungsraum des Reviers gestoßen.
Es war Zeit, den ersten Ermittlungstag zu erörtern.
Castello verteilte die Berichte von Gilles Sebag und Jacques Molina sowie die Ergebnisse von Jean Pagès.
»Das Opfer heißt Bernard Martinez«, fasste der Commissaire für alle zusammen. »1934 in Algerien geboren, ein Pied-noir also. Er kam 1962 nach Frankreich und hat sich in den Pyrénées-Orientales als Winzer niedergelassen. Seitdem er in Rente war, lebte er in einer Wohnung in Moulin-à-Vent. Alles bis hierhin unauffällig. Aber jetzt zum Mord. Jean, würden Sie uns bitte direkt Ihre Schlussfolgerungen mitteilen? Für die Details haben wir Ihren Bericht.« Er klopfte auf den Papierstapel vor sich auf dem Tisch. »Und bravo, das war mal wieder außerordentlich schnell. Wie immer tadellos.«
Der Leiter der Kriminaltechnik errötete. Auch wenn er schon vierzig Jahre im Dienst war und eine barsche Art hatte, von Komplimenten konnte er nicht genug kriegen. Er räusperte sich, bevor er begann.
»Der Mörder hat im Alleingang und ohne jegliche Vorsichtsmaßnahme gehandelt. Wir haben zahlreiche ausgezeichnete Fingerabdrücke vorgefunden, an den Türgriffen, auf den Stühlen und auf den Fesseln. Leider helfen sie uns bisher noch nicht, da sich der Täter weder in unserer noch in der Datenbank der Gendarmerie befindet. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb er so unvorsichtig war.«
»Sie werden uns aber trotzdem später von Nutzen sein«, bemerkte Castello optimistisch. »Wenn wir den Täter erstmal gefasst haben, sind sie handfester Beweis. Sonst noch etwas, Jean?«
»Unser Mann hat eine Faustfeuerwaffe benutzt, wahrscheinlich ein relativ altes Modell, Kaliber 9 mm. Die Kugel haben wir in der Fußleiste gefunden. Das Opfer war mit Handschellen an den Stuhl gefesselt, aber davon können wir uns momentan auch nicht viel erhoffen, denn es handelt sich um ein gängiges Modell, das man leicht im Internet finden kann.«
»Man kann im Internet Handschellen finden?«, wunderte sich der junge Lambert.
»Man kann alles im Internet finden«, erwiderte Joan Llach.
»Schon, aber Handschellen? Wofür denn?«
Hier und da tauchte auf den Gesichtern ein Grinsen auf. Jacques legte seinem Kollegen eine Hand auf den Arm.
»Die findet man auch in Sex-Shops. Da gibt es richtige Liebhabermodelle. Irgendwann erklär ich es dir, Thierry.«
Castello gefiel diese Abschweifung vom Thema gar nicht, und er ergriff wieder das Wort. »Wie ist der Täter in die Wohnung gekommen?«
»Keinerlei Zeichen von gewaltsamem Eindringen. Es scheint, als hätte das Opfer ihm aufgemacht.«
»Können wir also davon ausgehen, dass Martinez seinen Mörder kannte?«, überlegte Llach. Er war ein großer Fan einfacher Folgerungen, die zu schneller Fallaufklärung führen sollten.
Jean Pagès verzog den Mund. Sein bereits von tiefen Furchen durchzogenes Gesicht zerknitterte noch mehr.
»Das ist eine Hypothese, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein ahnungsloses Opfer seinem Mörder die Tür aufmacht, ohne dass sie sich je zuvor begegnet wären.«
Joan Llach zog seine dichten, dunklen Augenbrauen zusammen. Ein sturer Strich bildete sich über seinen schwarzen Augen.
»Trotzdem, heutzutage, wo sich alle immer weniger sicher fühlen, da machen die Alten einem Fremden nicht mehr einfach so die Tür auf …«
»Auf die Mehrheit trifft das vermutlich zu, aber nicht auf alle«, erwiderte Pagès. »Manche Leute sind immer noch äußerst gutgläubig. Man muss ihnen nur einen Kalender von der Post oder von der Feuerwehr unter die Nase halten, und schon lassen sie einen rein. Sie holen sogar ihr Portemonnaie raus und machen es auf.«
»Es ist erst Ende Oktober, das ist doch ein bisschen früh für Kalender«, nörgelte Llach.
»Das war nur ein Beispiel. Die Leute würden ebenso bereitwillig jemandem vom Stromanbieter, einem Volkszähler oder, noch besser, jemandem, der sich als Polizist ausgibt, aufmachen.«
»Gilles, was sagen Sie dazu?«, wandte sich Castello an Gilles.
Der fand es entsetzlich, wenn er so angesprochen wurde. Da Castello ihn als Chef der Truppe ansah, fragte er Gilles in der Runde der Inspecteurs oft nach seiner Meinung. Nun war Gilles aber nicht nur von nichts und niemandem der Chef, er hatte sogar jegliche Beförderung abgelehnt, die man ihm in letzter Zeit angeboten hatte. Er wich der Frage aus.
»Beide Hypothesen sind plausibel …«
Verstimmt wandte Castello sich wieder an Pagès. »Noch etwas?«
»Es gibt einen Aspekt, der das Opfer vielleicht beruhigt und es dazu bewegt hat, seinem Mörder so bereitwillig aufzumachen. Ich kann momentan noch nicht sicher sein, aber wir können die Hypothese nicht verwerfen, dass der Täter selbst auch älter ist.«
»Ach was!«, sagte der Commissaire.
»Ein Opi als Todesschütze …«, scherzte Jacques.
Jean Pagès beachtete ihn nicht.
»Auf der Rückenlehne des Stuhls, der dem Opfer gegenüberstand, habe ich ein weißes Haar gefunden.«
Lautes Gelächter unterbrach ihn.
»Wow, ein weißes Haar in der Wohnung eines Rentners«, spottete Jacques, »was für eine Sensation!«
Ohne mit der Wimper zu zucken, wandte der Kriminaltechniker sich weiter an Castello. »Es schien mir weißer und länger zu sein als die Haare des Opfers.«
»Ein Rentner, der manchmal andere Rentner zu Besuch hat«, fuhr Jacques fort, »noch eine Sensation! Ich gebe ja gern zu, dass es bei deiner Arbeit um Haarspalterei geht, aber jetzt gehst du wirklich zu weit.«
Jean Pagès biss sich auf die Lippe. Vermutlich bereute er in diesem Moment, dass er seinen Ruhestand um ein Jahr verschoben hatte. Er hätte sich eigentlich nach dem Sommer verabschieden sollen, sich aber nicht dazu durchringen können.
»Ich weiß sehr wohl, wer hier zu weit geht«, kam Castello Pagès zu Hilfe. »Und mit dieser Art von sarkastischen, wenn nicht sogar aggressiven Bemerkungen bringen wir die Diskussion bestimmt nicht voran.«
Der Commissaire warf Jacques einen finsteren Blick zu. Dann wurden seine Gesichtszüge wieder weich, und seine Stimme nahm einen sanfteren, beinahe übertrieben freundlichen Klang an.
»Man muss aber trotzdem anerkennen, Jean, dass Molinas Anmerkung grundsätzlich – aber wirklich nur grundsätzlich – nicht komplett unbegründet ist. Ich vertraue auf Ihre Intuition, aber das muss bestätigt werden. Haben Sie sonst noch etwas in der Wohnung entdeckt?«
»Nein, sonst nichts«, knurrte Pagès.
Castello wandte sich an Lambert. »Zu Ihnen, Thierry: Was haben Sie bei der Befragung der Nachbarn herausgefunden?«
Der junge Inspecteur riss überrascht die Augen auf. Sicher, er hatte die Befragung der Nachbarn begonnen, aber Joan Llach hatte sich ihm schnell angeschlossen, und er hatte nicht damit gerechnet, in der Besprechung das Wort übergeben zu bekommen. Er war das jüngste Mitglied der Belegschaft und erst vor einem Jahr nach seiner Ausbildung übernommen worden.
Er richtete sich auf seinem Stuhl auf, und diese kleine Bewegung reichte schon aus, um den strengen Geruch eines billigen Deodorants im Raum zu verteilen. Jacques hielt sich mit einem Blick auf Gilles die Nase zu. Lambert hatte eine Körpergeruchphobie und vor nichts mehr Angst als davor, schlecht zu riechen. Seine Begegnung mit der Leiche hatte ihn wohl dazu gebracht, einen ganzen Behälter an einem Tag aufzubrauchen.
»Wie Sie eben schon sagten, Commissaire, er war offenbar ein unauffälliger Rentner. Seine Nachbarn haben nur positiv über ihn gesprochen, außer dass er vielleicht manchmal etwas zu laut ferngesehen hat. Sie sagten, dass er wohl schon ungefähr fünfzehn Jahre dort in der Wohnung lebte. Martinez war Winzer, das erwähnten Sie auch schon, Chef, Winzer in den Aspres, aber er ist bankrottgegangen und musste sein Land verkaufen. Keine Familie, keine Kinder, wie es aussieht nur eine Freundin, oder vielleicht eher Lebensabschnittsgefährtin. Seitdem er nach Moulin-à-Vent gezogen ist, waren seine Hauptbeschäftigungen neben dem Fernsehen anscheinend Kreuzworträtsel und Boule-Spielen. Und in einem Verein von Algerienfranzosen war er auch.«
»Hm, hm«, brummte Castello und nickte dabei nachdenklich. »Und die Nachbarn haben in den letzten Tagen nichts Ungewöhnliches bemerkt?«
»Da der Mord schon mindestens fünf Tage her ist, konnten sie nichts dazu sagen. Sie erinnern sich an nichts.«
»Und haben Sie mit der Nachbarin gesprochen, die die Leiche entdeckt hat?«
»Sie stand unter Schock. Hat geweint und am ganzen Körper gezittert. Es hat sie ganz schön mitgenommen.«
»Was hat sie gerade an diesem Vormittag dazu gebracht, nach ihrem Nachbarn zu sehen?«
»Wir dachten zuerst, der Geruch hätte sie aufhorchen lassen …«
»Wohl eher aufriechen lassen«, witzelte Jacques.
Lambert gluckste, doch der Commissaire bewegte knapp und autoritär das Kinn, und der Inspecteur redete weiter.
»Martinez’ Freundin, von der ich eben erzählt habe, hatte die Nachbarin gebeten, bei ihm zu klingeln. Sie ist gerade im Urlaub bei ihrer Tochter in Barcelona. Martinez hatte nicht auf ihre Nachrichten auf dem AB reagiert, deswegen hat sie sich Sorgen gemacht.«
François Ménard hob die Hand, er wollte sich einschalten. »Sie heißt nicht zufällig Josette?«
»Ja, ich glaube, so heißt sie«, antwortete Lambert. Er breitete seine Notizen – bekritzelte Kassenbons – vor sich aus. »Genau, da steht es: Josette Vidal.«
»Ich habe eine aktuelle Postkarte gefunden, die mit Josette unterschrieben ist«, erklärte Ménard.
»Wo Sie schon das Wort ergriffen haben, François, fahren Sie doch fort«, schlug der Commissaire vor. »Sie hatten sich den Papierkram vorgenommen, den wir beim Opfer gefunden haben.«
Ménard breitete ebenfalls seine Notizen vor sich aus: mehrere dicht beschriebene DIN-A4-Blätter.
»Im Grunde nur Alltägliches, was jeder andere auch in seinen Schubladen aufbewahrt: Kontoauszüge, Gas- und Stromrechnungen, Familienbuch, ein paar Fotos – nicht viele –, Unterlagen der Hausratsversicherung, Briefe und Postkarten, im Wesentlichen von besagter Josette Vidal. Kurz gesagt also nichts von großer Bedeutung, aber ich habe doch einige Informationen aus den Unterlagen zusammentragen können, die präzisieren, was wir eben festgestellt haben.«
Er beugte sein langes Gesicht über seine Papiere.
»Und zwar … dass Bernard Martinez das erste Kind von Jean Martinez, Geschäftsmann in Algier, und Odette Blanchard, Schneiderin, war. Er hatte einen jüngeren Bruder, geboren 1937 und ein Jahr später gestorben. Martinez ist wie die meisten anderen Algerienfranzosen im Sommer 1962 nach Frankreich zurückgekehrt. Er und seine Eltern sind in Sète angekommen, seine Eltern haben sich dann in Marseille niedergelassen, er selbst in Perpignan. Die Eltern sind beide in den achtziger Jahren verstorben.«
Ménard gönnte sich eine kleine Verschnaufpause.
»Im Februar 1963 kaufte er zwölf Hektar für den Weinbau in Terrats, in der Nähe von Thuir. Die hat er bewirtschaftet, bis er dann 1997 in Konkurs gegangen ist. Die Rodungsprämie und der Landverkauf haben ihn gerade mal seine Schulden begleichen lassen. Seitdem lebte er von der Mindestrente.«
Ménard blätterte in seinen Notizen.
»Auf den ersten Blick wurde nichts bei ihm gestohlen. In seinem Portemonnaie waren sogar noch seine EC-Karte und Bargeld.«
»Vielleicht irgendwelche Wertgegenstände?«, hakte der Commissaire nach.
»Das lässt sich momentan nicht sagen«, erwiderte Ménard. »Dazu müssten wir die von Thierry erwähnte Freundin befragen. Sie wird uns sagen können, ob etwas fehlt. Aber da er nicht reich war, ist das eher unwahrscheinlich.«
»Dann sieht es also nicht so aus, als wäre es Raubmord gewesen?«, fragte Lambert besorgt.
»Nein«, entgegnete Castello.
Der Commissaire dachte ein paar Sekunden nach und sprach dann an, was ihn wohl am meisten beschäftigte.
»Im Augenblick ist also das Emblem auf der Wohnzimmertür die einzige Fährte.«
Hinten im Besprechungsraum kam Bewegung in Moreno und Raynaud, die bisher noch keinerlei Interesse an dem Fall bekundet hatten. Moreno räusperte sich und sagte dann mit dunkler Stimme: »Mit anderen Worten, es handelt sich um ein politisches Verbrechen!«
»Ein Racheakt gegen die OAS«, vervollständigte sein Kumpan.
Castello hob die Hände, um die Inbrunst des unkontrollierbarsten Duos in seinem Team zu bremsen. Raynaud und Moreno folgten einander stets auf Schritt und Tritt. Sie redeten nicht miteinander, sondern flüsterten und hatten dabei immer ein Auge auf die Dinge um sie herum, als tauschten sie schwerwiegende Staatsgeheimnisse aus. Sie waren zwar immer hinter dem großen Coup her, der ihre Karriere ankurbeln würde, hingen aber in tristen Bars und an zwielichtigen Orten herum, an denen nie etwas vorfiel. Kurz, ganz wie die Soldaten in der Tatarenwüste täuschten sie sich mit Routine über die Eintönigkeit hinweg.
»Sachte, sachte, die Herren, nicht so voreilig«, sagte Castello. »Ich gestehe Ihnen ja zu, dass zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen alles vorstellbar ist. Und die Presse wird sich leider auch schnell genug alles Mögliche ausdenken. Wir aber müssen Schritt für Schritt vorgehen. Und als Erstes heißt das zu überprüfen, welche Verbindung Martinez früher eventuell zu der Organisation hatte. Was genau wissen wir denn bisher über die länger zurückliegende Vergangenheit unseres Opfers?« Die Frage richtete sich in erster Linie an Ménard und Lambert.
»Ich habe keinerlei Schriftstück bei ihm gefunden, das auf irgendeine Verbindung zur OAS schließen ließe«, meldete sich Ménard als Erster zu Wort. »Bis auf dass er ein paar Zeitschriften für Algerienfranzosen abonniert hatte, die nicht unbedingt zu den moderatesten zählen.«
Der Commissaire wandte sich an Lambert. »Was sagen die Nachbarn dazu, Thierry?«
Lambert machte sich ganz klein auf seinem Stuhl. »Äh, ich habe nicht daran gedacht, danach zu fragen«, stammelte er. »Ich wusste da noch nicht, was die OA … die OA-Dings ist.«
Der Commissaire seufzte und sah den jungen Inspecteur nicht gerade liebenswürdig an. Gilles warf heimlich einen Blick auf sein Handy. Schon sieben. Unter dem Tisch tippte er diskret eine SMS, damit Claire nicht mit dem Abendessen auf ihn wartete.
Castello legte die Hände flach vor sich auf den Tisch und atmete tief ein.
»Hier ist wohl ein kleiner Exkurs in die Geschichte angebracht. Ich habe mir schon gedacht, dass nicht alle hier unbedingt Spezialisten für den Algerienkrieg sind, aber ich bin doch zumindest davon ausgegangen, dass Sie alle schon mal von der OAS gehört haben.«
Jacques stieß Lambert mit dem Ellenbogen an, als Castello seinen Vortrag begann.
»Die OAS ist die Organisation armée secrète, eine geheime Untergrundbewegung, die 1961 als Reaktion auf die Attentate der FLN gegründet wurde.«
Castello fixierte erneut Lambert mit seinem Blick und formulierte es dann noch einmal ganz klar und deutlich aus: »FLN für Front de Libération Nationale, die Nationale Befreiungsfront, eine Unabhängigkeitsbewegung, die 1954 den bewaffneten Kampf eröffnet hatte.«
Dann fuhr er für die ganze Runde fort: »Die OAS war also eine Reaktion auf die FLN und die Selbstbestimmungspolitik de Gaulles …«
Hier hielt er wieder inne.
»Selbstbestimmung, Lambert, sagt Ihnen das irgendetwas?«
»Äh, vage, ja«, stammelte der junge Polizist.
»Und General de Gaulle?«, hakte Jacques hinterlistig nach.
»Ah, ja, der sagt mir was … der General … de Gaulle, ja, den kenn ich …«
»Und, wie geht’s dem so?«
Jacques’ Witzelei brachte die Inspecteurs zum Lachen und entlockte sogar dem Commissaire so etwas wie ein schiefes Lächeln, bevor er dann aber mit seinem Vortrag fortfuhr.
»Die Algerienfranzosen, die gegen die Unabhängigkeit waren, gründeten also die OAS, die dann insgesamt innerhalb von weniger als zwei Jahren gut zehntausend Sprengstoffanschläge verübte, nicht nur auf algerischem Boden, sondern auch hier in Frankreich selbst. Man schreibt ihnen mehr als 1600 Tote zu.«
Diese Zahl ließ die Zuhörer erschauern.
»Ja, ich weiß, das ist heutzutage kaum vorstellbar, aber ich habe die Anzahl überprüft. 1600 Tote. Die OAS hatte es vor allem auf Araber abgesehen, aber auch französische Polizisten im Dienst umgelegt.«
Ein entrüstetes Raunen ging durch den Raum.
»Ein paar der Anführer wurden festgenommen und hingerichtet. Viele sind im Gefängnis gelandet. Aber im Großen und Ganzen wurden sie Ende der sechziger Jahre begnadigt.«
Castello legte eine kurze Pause sein, um sicherzugehen, dass er die Aufmerksamkeit aller hatte.
»Wenn neben einer Leiche die Bezeichnung OAS auftaucht, wirft uns das also in diese unruhige Zeit zurück und auf das immer noch heikle Thema, beziehungsweise in die Gemeinschaft der Algerienfranzosen, die nebenbei gesagt hier im Département noch zehntausend Mitglieder zählt. Außerdem – und da erzähle ich Ihnen hoffentlich nichts Neues – waren die Spannungen in der Stadt in den letzten Jahren zwischen den Vereinigungen der Algerienfranzosen und ihren Gegnern ziemlich heftig, wenn es um die Denkmäler ging, die an mehreren öffentlichen Orten errichtet wurden. Jedes Mal gab es Demonstrationen dafür und dagegen, und wir sind gerade noch um Auseinandersetzungen herumgekommen. Kurzum, wir bewegen uns auf dünnem Eis, und ich kann Ihnen schon gleich sagen, dass viele Leute hier unsere Ermittlungen ganz genau verfolgen werden.«
Eine bleierne Stille folgte seinem Vortrag. Die Inspecteurs waren nachdenklich geworden. Niemand bei der Polizei arbeitete gern unter dem Druck der Politik und der Medien.
»Allerdings werden wir keine Spur außer Acht lassen«, fuhr Castello fort. »Auch nicht die einer persönlichen Abrechnung, die als politische Tat verschleiert wird. Morgen treffen sich Joan und Thierry mit Martinez’ Freundin. Sie werden mit ihr in die Wohnung gehen, damit sie uns bestätigen kann, dass nichts gestohlen wurde. Sie beide hier«, er deutete auf Raynaud und Moreno, »werden Martinez’ berufliche Vergangenheit unter die Lupe nehmen. Es muss überprüft werden, ob nicht eine Streitsache in seinen Bankrott hineingespielt hat.«
Gilles warf seinen Kollegen einen Seitenblick zu und freute sich zu sehen, dass sie enttäuscht waren, nicht auf die politische Fährte angesetzt worden zu sein. Dann konzentrierte er sich wieder auf die Anweisungen des Commissaire.
»Gilles und Jacques ermitteln zuerst in der Gemeinschaft der Algerienfranzosen und befragen in erster Linie die Vorsitzenden des Vereins, in dem Martinez Mitglied war. Wir müssen umgehend herausfinden, ob er der OAS angehört hat oder nicht. Dann statten die beiden denjenigen einen Besuch ab, die gegen die Denkmäler für die Algerienfranzosen waren. Und François schließlich kümmert sich insbesondere um den historischen Gesichtspunkt. Habe ich es richtig verstanden, dass Sie bereits einen Termin mit einem Geschichtsprofessor ausgemacht haben?«
»Ja, mit einem Experten für den Algerienkrieg. Leider ist er mehr auf die FLN spezialisiert als auf die OAS, aber er wird mich sicher an Kollegen und Zeitzeugen verweisen können.«
Castello sah seine Inspecteurs einen nach dem anderen an und schloss dann mit ernster Miene: »Meine Herren, ich zähle darauf, dass Sie morgen pünktlich zur Stelle sind. Wir müssen schnell handeln, denn es gibt da noch eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben. Dafür ist es noch zu früh, und wie ich vorhin schon sagte, ich will nichts überstürzen. Aber ich bin sicher, dass einige unter Ihnen schon daran gedacht haben.«
Er sah sich wieder in der Runde um.
»Wenn wir es mit Rache an der OAS zu tun haben, können wir nicht ausschließen, dass dieser Mord erst der Anfang einer Serie ist. Sie können jetzt gehen.«
Jacques Molina führte ein Telefonat, während Gilles die Papiere zu Mathieus Unfall zusammensammelte, die ein ungünstiger Luftzug im Büro verstreut hatte.
»Perfekt, Monsieur Albouker. Bis morgen.«
Jacques legte auf.
»Der Vorsitzende vom Verein der Algerienfranzosen hat morgen um halb elf Zeit für uns. Er hätte uns lieber abends getroffen, weil er den Kassenwart dabeihaben wollte und der vormittags nicht kann, aber ich hab ihm gesagt, dass wir abends schon einen anderen Termin haben.«
»Gut gemacht. Wenn man sich nach den Leuten richten würde, würde man Tag und Nacht arbeiten. Und ich habe für meinen ersten Tag nach dem Urlaub schon genug …«
»Der Kassenwart ist in Rente, da kann er sich ruhig ein bisschen Mühe geben. Und ich hatte für heute auch schon genug. Außerdem habe ich das Gefühl, der Verwesungsgeruch klebt noch an mir, vermischt mit Lamberts Duft. So eine abstoßende Mischung, die würde noch die gierigste Nymphomanin in die Flucht schlagen!«
Jacques stand auf und zog seine Jacke an.
»Ich habe eine schlechte Vorahnung bei diesem Fall. Ich sehe da einen ganzen Haufen an Verwicklungen auf uns zukommen. Da werden wir ganz schön unter Druck stehen.«
Da konnte Gilles ihm nur zustimmen. »Ich hoffe, dass wir schnell vorankommen.«
»Mit ein bisschen Glück hat seine Freundin ihn auf dem Gewissen und sie beichtet alles heulend an Lamberts Schulter. Tötung im Affekt mit siebzig, das hat’s doch schon gegeben, oder?«
»Ja, wahrscheinlich schon, aber mach dir da bei diesem Fall mal nicht zu große Hoffnungen.«
»Dein Gefühl sagt dir was anderes, oder?«
»Ja. Wie du tippe ich eher auf den Haufen an Verwicklungen.«
»Das habe ich schon befürchtet.«
Gilles hatte alle Papiere aus der Akte zusammengesammelt und sortiert. Er klopfte sie zu einem ordentlichen Stapel und klemmte ihn sich unter den Arm. Dann folgte er Jacques auf dem Fuße und verließ das Büro.
Claire und Séverine hatten es sich auf dem Sofa bequem gemacht und sahen fern, als Gilles nach Hause kam. Er gab ihnen einen Kuss und sah, wie sie das Gesicht verzogen. Er hatte sich nicht umziehen können, seitdem er in Martinez’ Wohnung gewesen war.
»Ich weiß, ich geh duschen.«
Ohne noch etwas hinzuzufügen, ging er ins Bad, das an das Schlafzimmer angrenzte. Er warf seine Sachen in den Wäschekorb und stieg dann unter das kochend heiße Wasser. Fünf volle Minuten lang ließ er es laufen, während er sich Haut und Haare sauber schrubbte. Dann trocknete er sich ab und zog einen Bademantel über.
»Ist Léo da?«, fragte er seine Frau und seine Tochter, die immer noch vor dem Bildschirm klebten.
»In seinem Zimmer«, antwortete Claire.
Gilles durchquerte das Wohnzimmer und ging den Flur entlang, der zu den Schlafzimmern seiner Kinder führte. Er klopfte an Léos Tür. Keine Antwort. Er trat ein. Mit Kopfhörern auf den Ohren starrte Léo auf seinen Computer.
»Bonsoir«, sagte Gilles extra laut.
Léo bewegte kaum den Kopf. »Salut, Papa.«
»Wie war dein Tag?«
»Ganz okay.«
»Nicht zu viele Hausaufgaben?«
»Nein, es geht.«
Gilles betrachtete ein paar Sekunden den Nacken seines Sohnes. Er zögerte. Er hatte ihn eigentlich nochmals warnen wollen, vorsichtig mit seinem Roller zu sein, aber ihm war klar, dass dieses »noch einmal« als »einmal zu viel« aufgefasst würde. Besser, er ritt nicht darauf herum. Die Beziehung zu seinem Sohn war nicht konfliktgeladen – noch nicht –, aber ihre einstige Verschworenheit war über die Jahre abgeflaut, und Gilles sehnte sich nach der Zeit zurück, in der sie gemeinsam im Garten oder am Computer gespielt und abends vorm Schlafengehen lange geredet hatten. Doch so war das Leben. Léo war groß geworden. Er war jetzt ein sechzehnjähriger Teenager. Ein Kind seiner Zeit. Seinen Eltern gegenüber ein Autist, aber in der Lage, den lieben langen Tag mit seinen Kumpels im Internet zu chatten.
Gilles seufzte, schloss die Tür und ging zurück ins Wohnzimmer. Es war nur durch einen Tresen von der Küche getrennt. Auf der Arbeitsplatte fand er unter einer Glasglocke einen Teller mit gefüllten Zucchini und ein bisschen Reis. Er stellte ihn zum Aufwärmen in die Mikrowelle. Während sich die Platte darin drehte, warf er einen Blick auf den Fernseher. Eine amerikanische Krimiserie natürlich. Es gab nichts anderes mehr im Fernsehen.
Die Mikrowelle piepte. Gilles holte seinen Teller heraus und setzte sich an den Tisch. Claire gesellte sich zu ihm. Séverine hatte sich Kopfhörer aufgesetzt, damit sie ungestört der Serie folgen konnte.
»Hattest du einen guten Tag?«, fragte ihn Claire.
»Wahrscheinlich so ähnlich wie die Serie da.«
»Ein Mord?«
Er nahm einen großen Bissen und konnte nur nicken.
»War das der Gestank?«
Er legte ihr den Fall in groben Zügen dar.
»Für deinen ersten Tag nach dem Urlaub hast du ja ordentlich was abbekommen«, bemerkte sie.
»Das kann man wohl sagen. Aber willst du nicht weiter fernsehen?«
»Ich habe erst eine Folge davon gesehen, und nach dem, was du mir gerade erzählt hast, habe ich überhaupt keine Lust mehr darauf.«
»Wie heißt es so schön, das Leben schreibt doch immer noch die schlimmsten Geschichten.«
»Hast du mir den Spruch nicht schon mal präsentiert?«
Gilles wandelte mit Vorliebe Redewendungen ab, aber nach zwanzig gemeinsamen Jahren mit Claire hatte er nicht mehr viele Neuheiten auf Lager.
»Ist gut möglich … Und wie war dein Tag?«
Claire erzählte ihm von ihrem Alltag als Französischlehrerin an einem Collège in Rivesaltes, den Spannungen zwischen den Lehrkräften und dem neuen Schuldirektor, den Problemen, eine überfüllte Klasse unter Kontrolle zu halten, vor allem die Quatrième C, in der zwei oder drei Schüler noch etwas unverschämter waren als der Durchschnitt. Und sie erzählte ihm auch von ihrem Gymnastikkurs, in dem sie sich etwas entspannen konnte, von ihrer Freude daran, sich körperlich auszutoben und den Tag dann im Hamam mit ihren Freundinnen ausklingen zu lassen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: