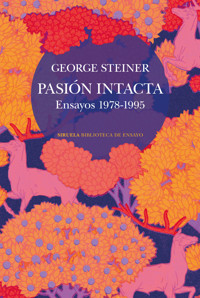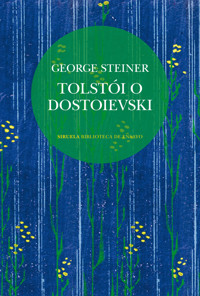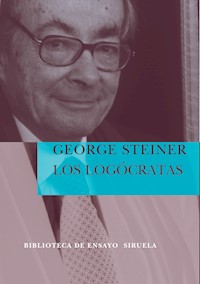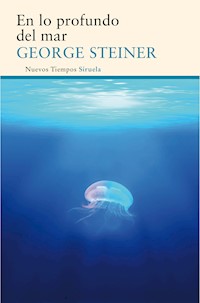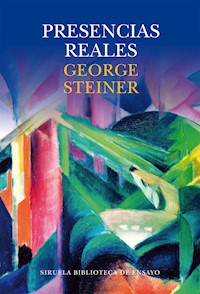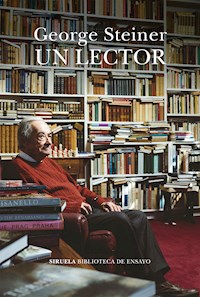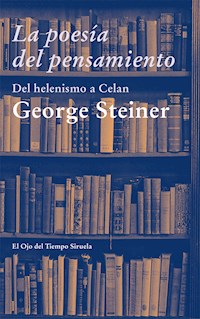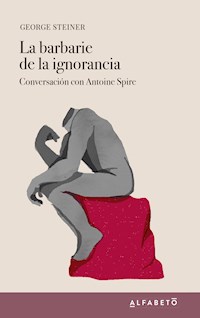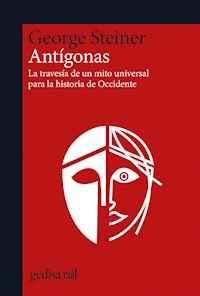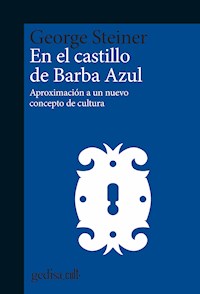21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Denken und Dichten: beide sind sie Kinder der Sprache. Eine sehr lange Zeit hat es gebraucht, bevor sich aus orphischen Gesängen, rhapsodischen Fiktionen und schamanischen Analogien autonomes Denken kristallisierte. Doch so sehr, seit der griechischen Klassik, dieses Denken sich auf Abstraktion zuspitzte – über Jahrtausende blieb es gebunden an das uralte Erbe der Dichtung: an Rhythmus, Phrasierung, Klangfarbe und Intonation, an rhetorische Figuren, Bilder und Symbole. Eine Sprache der Sinnlichkeit, vibrierend von Bedeutung und innerer Bewegung: das ist die Ausdrucksform der größten Denker von Heraklit über Platon, Descartes und Spinoza, Hegel und Nietzsche hin zu Wittgenstein, Heidegger, Sartre. Umgekehrt drängt es die Dichter immer wieder zum gedanklichen System: Den großen Meistern und Meisterwerken solcher Synthese, der schönen Verschmelzung von Dichtung und Denken gilt Steiners neuer mit poetischem Schwung geschriebene philosophisch-historische Essay.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
George Steiner
Gedanken dichten
Aus dem Englischenvon Nicolaus Bornhorn
Originalausgabe:
George Steiner
The Poetry of Thought
New York: New Directions 2011
© George Steiner 2011
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2011
© der deutschsprachigen Ausgabe
Suhrkamp Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das
des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Satz: Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
eISBN 978-3-518-75790-1
www.suhrkamp.de
Für Durs Grünbein
»Toute pensée commence par un poème.« 1
(Alain, Commentaire sur ›La jeune Parque‹, 1953)
»Il y a toujours dans la philosophie une prose littéraire cachée, une ambiguïté des termes.« 2
(Jean-Paul Sartre, Situations IX, 1965)
»On ne pense en philosophie que sous des métaphores.« 3
(Louis Althusser, Eléments d'autocritique, 1972)
Lucretius and Seneca are »models of philosophical-literary investigation, in which literary language and complex dialogical structures engage the interlocutor's (and the reader's) entire soul in a way that an abstract and impersonal prose treatise could not … Form is a crucial element in the work's philosophic content. Sometimes, indeed (as with the Medea), the content of the form proves so powerful that it calls into question the allegedly simpler teaching contained within it.« 4
(Martha Nussbaum, The Therapy of Desire, 1994)
»Gegenüber den Dichtern stehen die Philosophen unglaublich gut angezogen da. Dabei sind sie nackt, ganz erbärmlich nackt, wenn man bedenkt, mit welch dürftiger Bildsprache sie die meiste Zeit auskommen müssen.«
(Durs Grünbein, Das erste Jahr, 2001)
Vorwort
Welches sind die philosophischen Begriffe der Taubstummen? Welcher Art sind ihre metaphysischen Vorstellungen?
Alle philosophischen Akte, alle Versuche, das Denken zu denken, sind – mit Ausnahme vielleicht der formalen (mathematischen) und symbolischen Logik – unweigerlich sprachlicher Natur. Sie werden verwirklicht, als Geiseln gehalten, von der einen oder anderen diskursiven Geste, der Kodierung in Wörter und Grammatik. Die philosophische Aussage – sei sie mündlich oder schriftlich –, die Artikulation und Mitteilung eines Arguments sind dem Vollzug, der Dynamik und den Grenzen menschlicher Rede unterworfen.
Es könnte sein, daß in aller Philosophie, fast gewiß in der gesamten Theologie, ein verborgenes, aber beharrliches Begehren lauert – Spinozas conatus 1 –, das Begehren, dieser aufgezwungenen Knechtschaft zu entfliehen: entweder durch die Anpassung der natürlichen Sprache an die tautologische Genauigkeit, die Transparenz und Verifizierbarkeit der Mathematik (dieser kalte, aber inbrünstige Traum verfolgt Spinoza, Husserl, Wittgenstein) oder, auf rätselhaftere Weise, durch das Zurückgreifen auf vorsprachliche Intuitionen. Wir wissen nicht, ob es derartiges gibt, ob es ein dem Sagen vorgelagertes Denken geben kann. In den Künsten, in der Musik erfassen wir vielfache Bedeutungskräfte und Sinnfiguren. Die unerschöpfliche Ausdrucksfähigkeit der Musik, ihr Widerstand gegen jegliche Übersetzung oder Paraphrase setzen den philosophischen Szenarien eines Sokrates oder Nietzsche zu. Doch wenn wir den »Sinn« einer ästhetischen Darstellung oder musikalischen Form angeben, sprechen wir in Metaphern, arbeiten wir mit mehr oder minder versteckten Analogien. Wir schließen sie ein in die (be-)herrschenden Umrisse der Sprache. Daher die regelmäßig wiederkehrende Trope, so nachdrücklich bei Plotin oder im Tractatus, daß der Kern der philosophischen Botschaft aus dem Ungesagten bestehe, dem Unausgesprochenen zwischen den Zeilen. Das, was ausgesagt werden kann, die Annahme, daß Sprache mehr oder minder übereinstimmt mit wahrer Einsicht und Beweisführung, könnte eher den Verfall ursprünglichen, epiphanischen Erkennens enthüllen. Es könnte Hinweis sein auf den Glauben, daß die Sprache in einem früheren, »vorsokratischen« Zustand dem Quell der Unmittelbarkeit näher war, näher war dem ungedämpften »Licht des Seins« (Heidegger). Doch gibt es keinerlei Beweise für einen solchen dem Ursprung näherstehenden Vorrang. Unausweichlich bewohnt das »sprechende Tier«, wie die alten Griechen den Menschen definierten, die begrenzte Unermeßlichkeit des Wortes, der grammatikalischen Werkzeuge. Der Logos setzt schon in seiner Grundlegung Wort mit Vernunft gleich. Das Denken könnte sich sehr wohl in der Verbannung befinden. Aber wenn dem so ist, wissen wir nicht oder, um genauer zu sein, können wir nicht sagen, woraus es verbannt ist.
Daraus folgt, daß Philosophie und Literatur denselben schöpferischen, obschon letztlich eingeschränkten Raum einnehmen. Die Mittel, die ihnen dabei zur Verfügung stehen, sind identisch: eine Aneinanderreihung von Wörtern, die Formen der Syntax, Zeichensetzung (eine subtile Hilfsquelle). Dies gilt sowohl für Kinderreime als auch für eine Kritik Kants, für ein Groschenheft wie für den Phaidon. Es sind Sprachhandlungen. Die Vorstellung, etwa bei Nietzsche oder Valéry, abstraktes Denken könne durch Tanz ausgedrückt werden, ist eine allegorische Laune. Einzig die Äußerung zählt, die verständliche Aussage. Sie ist es, die sich der Übersetzung, Paraphrase, Metaphrase, jeglicher Technik der Übertragung oder des Betrugs widersetzt oder, umgekehrt, den Anstoß dazu gibt.
Männer des Fachs haben dies immer schon gewußt. In jeder Philosophie, räumte Sartre ein, steckt »eine verborgene literarische Prosa«. Philosophisches Denken könne »nur metaphorisch« verwirklicht werden, lehrte Althusser. Wiederholt gestand Wittgenstein ein (aber wie ernst war es ihm damit?), daß er seine Philosophischen Untersuchungen in Verse hätte setzen sollen. Jean-Luc Nancy spricht die entscheidenden Komplikationen an, die Philosophie und Dichtung einander bereiten: »Zusammen sind sie der Inbegriff des Schwierigen, der Schwierigkeit, verständlich, sinnvoll zu sein.« Die Aussage weist hin auf die Hauptproblematik, die Erzeugung von Bedeutung und die Poetik der Vernunft.
Der beständige prägende Druck von Sprachformen, von Stil auf philosophische und metaphysische Konzeptionen ist weniger erhellt worden. Inwieweit ist eine philosophische Behauptung, und sei sie auch so entblößt wie in der Logik Freges, rhetorischer Natur? Kann irgendein kognitives, erkenntnistheoretisches Lehrgebäude losgelöst werden von den stilistischen Übereinkünften, von den Ausdrucksformen, die zu seiner Zeit und in seiner Umgebung vorherrschten oder angefochten wurden? Bis zu welchem Grad war die Metaphysik eines Descartes, Spinoza oder Leibniz bedingt durch die komplexen sozialen und instrumentellen Idealvorstellungen des Spätlateins, durch die Elemente und den zugrundeliegenden Einfluß einer teilweise künstlichen Latinität im modernen Europa? An anderen Orten beginnt die Philosophie, neue Sprachen zu entwerfen, Ideolekte, zugeschnitten auf ihre Zwecke. Doch diese Unternehmungen, offensichtlich bei Nietzsche oder Heidegger, sind selbst aufgeladen mit den jeweiligen oratorischen, umgangssprachlichen oder ästhetischen Zusammenhängen (man beachte etwa den »Expressionismus« im Zarathustra). Außerhalb der von Surrealismus und Dada initiierten Wortspiele, die der Akrobatik automatischen Schreibens gegenüber immun sind, gäbe es keinen Derrida. Was stünde der Dekonstruktion näher als Finnegans Wake oder Gertrude Steins lapidare Feststellung, daß »da kein da da ist«?
Aspekte dieser »Stilisierung« in bestimmten philosophischen Texten, die Schaffung solcher Texte mittels literarischer Werkzeuge und Moden sind es, die ich hier (auf unvermeidlich partielle, provisorische Weise) behandeln möchte. Vermerken möchte ich die Wechselwirkungen, Rivalitäten zwischen Dichter, Romanautor, Dramatiker einerseits und dem erklärten Denker andererseits. »Beides sein, Spinoza und Stendhal.« (Sartre) Vertrautheiten und gegenseitiges Mißtrauen, von Platon ins Bild gesetzt und wiedergeboren in Heideggers Dialog mit Hölderlin.
Wesentlich für diesen Essay ist eine Mutmaßung, die ich nur schwer in Worte zu fassen vermag. Die enge Verbindung von Musik und Dichtung ist ein Gemeinplatz. Beide teilen ursprüngliche Kategorien wie Rhythmus, Phrasierung, Kadenz, Klang, Intonation und Takt. »Die Musik der Dichtung« ist genau dies. Wörter in Musik zu setzen oder Musik in Wörter sind Übungen, bei denen sie das Rohmaterial gemein haben.
Gibt es in verwandtem Sinn »eine Lyrik, eine Musik des Denkens«, die tiefer gehen als jenes Denken, das sich an äußerliche Verwendungen von Sprache und Stil bindet?
Wir neigen dazu, die Bezeichnung, den Begriff »Denken« mit gedankenloser Streuung und Freigebigkeit zu benutzen. Wir heften das Etikett des »Denkprozesses« einer wimmelnden Vielfalt geistiger Tätigkeiten an, die vom unbewußten, chaotischen Strom selbst im Schlaf vorhandenen, verinnerlichten Treibguts bis hin zu rigorosesten analytischen Verfahren reichen können, die das ununterbrochene Geplapper des Alltags ebenso umfassen wie die fokussierten Meditationen eines Aristoteles über den Geist oder die Hegels über das Selbst. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das »Denken« demokratisiert. Es ist universal und bedarf keiner Genehmigung. Doch werden auf diese Weise unterschiedliche, ja einander entgegengesetzte Phänomene gänzlich durcheinandergebracht. Ernsthaftes, wahres Denken – uns fehlt ein wegweisender, verantwortungsbewußt definierter Begriff – ist selten. Die Disziplin, die es erfordert, die Fähigkeit, sich bequemer, nachlässiger Denkwege zu enthalten, sind kaum oder gar nicht in Reichweite der großen Mehrheit. Die meisten von uns sind sich dessen, was es bedeutet zu »denken«, nicht bewußt, sind nicht in der Lage, den Trödel, den abgegriffenen Ramsch unserer geistigen Ströme in »Denken« zu verwandeln. Recht betrachtet – wann halten wir inne um dieser Betrachtung willen? – tritt erstrangiges Denken ebenso selten auf wie ein Sonett Shakespeares oder eine Fuge Bachs. Vielleicht haben wir in unserer kurzen Evolutionsgeschichte noch nicht gelernt zu denken. Die Bezeichnung homo sapiens mag, von einer Handvoll Menschen abgesehen, auf unbegründete Prahlerei hinauslaufen.
Vortreffliches, mahnt Spinoza, »ist selten und anspruchsvoll«. Warum sollte ein herausragender philosophischer Text leichter zugänglich sein als höhere Mathematik oder ein Quartett des späten Beethoven? Einem solchen Text liegt ein Schaffensprozeß zugrunde, wohnt eine »Poesie« inne, die er offenbart, aber gegen die er sich auch sträubt. Große philosophisch-metaphysische Denkgebäude enthüllen und verbergen zugleich die in ihnen enthaltenen »äußersten Fiktionen«. Das Leckwasser unserer unkritischen Grübeleien bildet in der Tat die Prosa der Welt. Ganz wie die »Dichtung« im kategorischen Sinne hat auch die Philosophie ihre Musik, ihren Pulsschlag des Tragischen, kennt sie Verzückung und sogar, wenn auch selten (wie bei Montaigne oder Hume), Gelächter. »Alles Denken beginnt mit einem Gedicht«, lehrte Alain in seinem Austausch mit Valéry. Dieser gemeinsame Ursprung, dieses Auftreten zweier Welten läßt sich nur schwer beschwören. Doch hinterläßt es Spuren, ähnlich jenen, deren Flüstern vom Ursprung unserer Galaxie kündet. Ich vermute, daß diese Spuren im mysterium tremendum der Metapher wahrnehmbar sind. Selbst die Melodie, »das größte Rätsel in der Wissenschaft vom Menschen« (Lévi-Strauss), mag in gewissem Sinne metaphorisch sein. Sind wir also »sprechende Tiere«, so sind wir insbesondere Primaten, die in der Lage sind, Metaphern zu benutzen, die in Blitzesschnelle ein Gleichnis Heraklits, die verstreuten Scherben des Seins und passive Wahrnehmung zueinander in Bezug setzen können.
Dort, wo Philosophie und Literatur ineinandergreifen, wo sie, in Form und Inhalt, miteinander streiten, ist das Echo dieses Ursprungs zu vernehmen. Das poetische Genie abstrakten Denkens wird entzündet, wird hörbar. Die Erörterung, selbst dort, wo sie analytisch ist, besitzt den ihr eigenen Trommelschlag. Sie wird zur Ode. Was entspräche den abschließenden Sätzen in Hegels Phänomenologie besser als Edith Piafs non de non, eine doppelte Verneinung, die Hegel gepriesen hätte?
Dieser Essay ist ein Versuch, genauer hinzuhören.
1
Wir sprechen in der Tat über Musik. Die in Worte gefaßte Analyse einer Partitur kann bis zu einem gewissen Grad ihre formale Struktur, ihre technischen Bestandteile und die Instrumentation erhellen. Aber dort, wo es sich bei diesen – mündlichen oder schriftlichen – Äußerungen zur Musik nicht um Musikwissenschaft im strengen Sinn handelt, wo sie nicht zu einer parasitären »Metasprache« über Musik – »Tonart«, »Tonhöhe«, »Synkope« – Zuflucht nehmen, gehen sie einen verdächtigen Kompromiß ein. Ein Bericht, eine Kritik musikalischer Aufführung hat weniger mit der eigentlichen Klangwelt zu tun, sondern richtet sich vielmehr an die Ausführenden und an die Zuhörer. Er arbeitet mit Analogien, sagt nur wenig aus über die Substanz der Komposition. Eine Handvoll mutiger Geister, Boethius, Rousseau, Nietzsche, Proust und Adorno unter anderen, haben den Versuch unternommen, die musikalische Materie und deren Bedeutung in Worte zu übersetzen. Gelegentlich sind sie dabei auf suggestive, metaphorische »Kontrapunkte« gestoßen, (Ab-)Bilder von großer beschwörender Wirkung (Proust über die Sonate Vinteuils). Doch selbst die verführerischsten dieser semiotischen Kunststücke sind im wahrsten Sinne des Wortes »neben-sächlich« (»beside the point«). Es sind Nachahmungen.
Über Musik zu sprechen heißt eine Illusion nähren, einen »kategorischen Irrtum« begehen, wie die Logiker sagen würden. Heißt Musik als natürliche Sprache ansehen, oder zumindest als etwas der natürlichen Sprache sehr Nahes, und heißt auch semantische Sachverhalte aus dem sprachlichen Bereich in den musikalischen Code übernehmen. Musikalische Elemente werden als Syntax erfahren oder klassifiziert; der sich entfaltende Aufbau einer Sonate, ihre Haupt- und Neben»sätze« werden grammatikalisch gekennzeichnet. Musikalische Aussagen – dies selbst eine übertragene Bezeichnung – besitzen ihre Rhetorik, ihren Redefluß oder ihre Ökonomie. Wir übersehen dabei nur zu gern, daß all diese Rubriken sprachlichen Gesetzmäßigkeiten entlehnt sind. All diese Analogien sind zwangsläufig nur eingeschränkt gültig. Eine musikalische »Phrase« besteht nicht aus Worten.
Diese Kontaminierung wird noch verschärft durch die mannigfaltigen Beziehungen zwischen Wörtern und ihrer Vertonung. Ein sprachlich geordnetes System wird einem »Nicht-Sprachlichen« eingepaßt, angepaßt oder ihm entgegengesetzt. Diese hybride Koexistenz tritt in zahllosen Abwandlungen und Verwicklungen auf (oft negiert ein Lied Hugo Wolfs den Text). Wir nehmen dieses Amalgam nur sehr oberflächlich wahr. Wer außer den zu hoher Konzentration Befähigten vermag schon, mit Partitur und Libretto in den Händen, zugleich die Noten, die dazugehörigen Silben und ihr vielgestaltiges, wahrhaft dialektisches Zusammenspiel zu erfassen? Dem menschlichen Gehirn fällt es schwer, gänzlich verschiedene, autonome Reize zu unterscheiden und wieder zu verknüpfen. Zweifellos gibt es Musikstücke, die darauf abzielen, sprachliche oder gegenständliche Phänomene zu begleiten oder nachzuahmen. Es gibt »Programmmusik« für Sturm und Windstille, für Feier und Trauer. Mussorgsky vertont die »Bilder einer Ausstellung«. Filmmusik ist oft wesentlich für die visuelle Dramatik des Drehbuchs. Doch werden diese Gattungen zu Recht als zweitrangige Mischformen angesehen. Wo Musik per se auftritt, wo sie laut Schopenhauer beständiger ist als der Mensch, da ist sie nur mit sich selbst identisch. Das ontologische Echo liegt auf der Hand: »Ich bin, der ich bin.«
Ihre einzige (be-)deutende »Übersetzung« oder Paraphrase ist die in körperliche Bewegung: Musik, umgesetzt in Tanz. Doch ist diese bezaubernde Spiegelung nicht mehr als Näherung. Hält man den Ton an, kann auf keine zuverlässige Weise mehr festgestellt werden, zu welcher Musik getanzt wird (ein Ärgernis, das Platon in den Nomoi anspricht). Doch ist Musik im Gegensatz zu den natürlichen Sprachen universell. Viele ethnische Gruppen sind nur im Besitz rudimentärer, mündlich überlieferter Dichtkunst. Aber keine menschliche Gemeinschaft existiert ohne Musik, die zudem oft hochentwickelt und komplex gegliedert ist. Die sinnlichen und emotionalen Gegebenheiten der Musik sind weit unmittelbarer als jene der Rede (sie könnten bis in den Mutterleib zurückreichen). Abgesehen von gewissen intellektuellen Extremen, zumeist eng verbunden mit Modernität und Technologie des Westens, benötigt Musik keine Entschlüsselung. Sie wird unmittelbar aufgenommen auf den Ebenen der Psyche, der Nerven und des »Bauches«, Ebenen, deren synaptisches Zusammenspiel, deren durch Häufung oder Überlagerung erzeugten Ertrag wir kaum erst verstehen.
Was aber ist es, das da empfangen, verinnerlicht wird, das Reaktionen hervorruft? Hier stoßen wir auf eine Dualität von »Sinn« und »Bedeutung«, der Erkenntnistheorie, philosophische Hermeneutik und psychologische Untersuchungen praktisch hilflos gegenüberstanden. Was zur Vermutung Anlaß gibt, daß unerschöpfliche Bedeutungsfülle zugleich sinnlos sein kann. Die Bedeutung von Musik besteht in ihrer Aufführung und im Zuhören (einige wenige sind in der Lage, eine Komposition zu »hören«, während sie die Partitur lesen). Zu erläutern, was eine Komposition bedeutet, heißt, so Schumann, sie erneut spielen. Seit den Anfängen der Menschheit ist die Musik so wichtig, so bedeutungsvoll, daß ein Leben ohne sie kaum vorstellbar war und wäre. Musique avant toute chose (Verlaine). Musik nimmt unseren Leib und unser Bewußtsein in Besitz. Sie beruhigt oder macht toll, tröstet oder stimmt traurig. Für zahllose Sterbliche stellt – wie vage auch immer – die Musik eine fühlbare Präsenz, die Andeutung, Prophezeiung einer möglichen transzendenten Wirklichkeit dar, einer Begegnung mit dem Numinosen, mit dem Übernatürlichen, liegen diese doch jenseits des empirischen Fassungsvermögens. Für wie viele wird Musik nicht zur Metapher religiösen Empfindens? Aber welchen Sinn hat sie, welche Bedeutung verifiziert sie? Kann Musik lügen, oder ist sie gegenüber den von Philosophen so bezeichneten »Wahrheitsfunktionen« immun? Dieselbe Musik kann unvereinbare Aussagen inspirieren und scheinbar artikulieren. Sie läßt sich in Antinomien »übersetzen«. Dieselbe Melodie Beethovens inspirierte Nazisolidarität oder kommunistische Verheißung oder wurde, in der Hymne der Vereinten Nationen, zum faden Allheilmittel. Derselbe Chor aus Wagners Rienzi preist Herzls Zionismus und Hitlers Vision des Reiches. Ein phantastischer Reichtum an variablen, ja widersprüchlichen Bedeutungen geht einher mit völliger Abwesenheit von Sinn. Weder Semiologie noch Psychologie, noch Metaphysik bekommen dieses Paradox in den Griff (was Denker des Absoluten, von Platon über Calvin bis hin zu Lenin, alarmierte). Keine Erkenntnistheorie war je in der Lage, eine überzeugende Antwort zu finden auf die Fragen »Wozu ist Musik da?« und »Welchen Sinn hat das Musizieren?«. Diese wesentliche Unfähigkeit deutet hin auf organische Beschränkungen der Sprache, Beschränkungen, die entscheidend sind für das philosophische Unterfangen. Verständliche, gesprochene oder in Schrift gefaßte Rede ist eine zweitrangige, eine Nachfolgeerscheinung. Sie könnte den Verfall ursprünglicher Ganzheit, psychosomatischer Bewußtheit verkörpern, die in der Musik noch wirksam sind. Zu oft heißt sprechen »mißverstehen«. Kurz vor seinem Tode singt Sokrates.
Wenn Gott für sich singt, war Leibniz überzeugt, dann singt er algebraisch. Die Affinitäten zwischen Mathematik und Musik, die Hilfsquellen, die sie gemein haben, sind seit Pythagoras bekannt. Hauptmerkmale der musikalischen Komposition wie etwa Tonhöhe, Lautstärke, Rhythmus können algebraisch dargestellt werden. Desgleichen historische Übereinkünfte wie Fuge, Kanon oder Kontrapunkt. Die Mathematik ist die andere universale Sprache, sogleich verständlich für all jene, die gelernt haben, sie zu lesen. Wie in der Musik ist auch in der Mathematik der Begriff der »Übersetzung« nur in einem oberflächlichen Sinn anwendbar. Gewisse mathematische Operationen können geschildert oder mit Worten beschrieben werden. Kunstgriffe lassen sich in Paraphrase oder Metaphrase fassen. Doch sind dies ergänzende, im Grunde dekorative Randbemerkungen. In sich und aus sich heraus läßt Mathematik sich nur in weitere Mathematik übersetzen (so etwa in der algebraischen Geometrie). In mathematischen Abhandlungen gibt es oft nur einen einzigen (er-)zeugenden Ausdruck, ein anfängliches »Gegeben sei«, das die Kette von Symbolen und Diagrammen ermöglicht und in Gang setzt. Vergleichbar ist es mit jenem gebieterischen »Es werde«, das in der Genesis die Axiome der Schöpfung einleitet.
Doch ist die Sprache der Mathematik ungeheuer reichhaltig. Ihre Entwicklung gehört zu den wenigen positiven, mustergültigen Expeditionen in den Annalen des menschlichen Geistes. Auch wenn sie für den Laien unzugänglich bleibt, offenbart sie doch Merkmale der Schönheit in einem exakten, beweisbaren Sinn. Nur hier ist die Gleichsetzung von Wahrheit und Schönheit gültig. Im Gegensatz zu den Aussagen der natürlichen Sprache sind jene der Mathematik verifizier- oder falsifizierbar. Dort, wo Unentscheidbarkeit aufkommt, hat auch dieser Begriff eine präzise, sorgsam definierte Bedeutung. Mündliche und schriftliche Ausdrucksweisen lügen, täuschen, verdunkeln auf Schritt und Tritt. Nur allzuoft bilden das Kurzlebige oder Erfundene ihren Antrieb. Mathematik kann Irrtümer hervorbringen, die später korrigiert werden. Sie kann nicht lügen. Ebenso wie Werke von Haydn oder Satie zeugen mathematische Konstruktionen und Beweise von Geist und Witz. Es mag Züge persönlichen Stils geben. Mathematiker haben mir berichtet, daß sie den Urheber eines Lehrsatzes und seines Beweises auf Grund stilistischer Merkmale identifizieren können. Einzig die Tatsache zählt, daß ein einmal bewiesenes mathematisches Verfahren Teil der kollektiven Wahrheit, der anonymen Verfügbarkeit wird. Zudem ist es von Dauer. Wenn Aischylos einst vergessen ist und ein Großteil seines Werkes verloren, werden die Lehrsätze Euklids noch Bestand haben (G.M. Hardy).
Seit Galilei ist die Mathematik auf einem souveränen Vormarsch. Eine Naturwissenschaft ist in dem Maße legitim, wie sie in mathematische Form gebracht werden kann. In zunehmendem Maße spielt die Mathematik eine Rolle in den Wirtschaftswissenschaften, in bedeutenden Zweigen der Sozialwissenschaften, selbst in den statistischen Bereichen der Geschichtswissenschaft (»Kliometrie«); Differential- und Integralrechnung sowie formale Logik bilden die Quelle und liefern die Struktur von Datenverarbeitung, Informationstheorie, elektromagnetischer Speicherung und Übertragung, wie sie heutzutage unseren Alltag organisieren und umformen. Die Jungen handhaben die kristalline Entfaltung von Fraktalen so, wie sie einst Reime handhabten. Angewandte Mathematik, oft von hohem Standard, durchdringt unsere individuelle und gesellschaftliche Existenz.
Von Beginn an haben Philosophie und Metaphysik die Mathematik gleich geprellten Falken umkreist, denen die Beute entging. Platons Forderung war eindeutig: »Gewähre nur jenen Zutritt zur Akademie, die in der Geometrie bewandert sind.« Bei Bergson und Wittgenstein ist die mathematische Libido Vorbild für die Erkenntnistheorie als ganze. In der langen Geschichte der Philosophie der Mathematik gibt es aufschlußreiche Episoden, dies trifft insbesondere für die frühen Untersuchungen Husserls zu. Aber die Fortschritte waren sporadischer Natur. Wenn auch die angewandte Mathematik mit ihren Anfängen in der Hydraulik, Landwirtschaft, Astronomie und Navigation in den Rahmen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedürfnisse eingeordnet werden kann, so stellen die reine Mathematik und ihr kometenhafter Aufstieg doch vor scheinbar unlösbare Probleme. Stammen die Lehrsätze, ihr Zusammenspiel in der höheren Mathematik, insbesondere in der Zahlentheorie, von Realitäten »da draußen« ab, beziehen sie sich auf eine Wirklichkeit, auch wenn diese noch unentdeckt ist? Stehen sie, auf welch formalisierter Ebene auch immer, im Zusammenhang mit Phänomenen der Existenz? Oder handelt es sich um ein autonomes Spiel, um Gruppen und Sequenzen von Operationen, die so willkürlich, so autistisch sind wie jene des Schachspiels? Ist der schrankenlose, man wäre versucht zu sagen »phantastische« Vorwärtsdrang der Mathematik, beginnend mit Pythagoras' Dreieck bis hin zu Ellipsenfunktionen, aus sich selbst heraus erzeugt und genährt, unabhängig von der Wirklichkeit oder möglichen Anwendungen (auch wenn letztere sich einstellen mögen)? Zu welchen psychologischen oder ästhetischen Impulsen stellt die Mathematik die »Antworten« bereit? Die Philosophen und die Mathematiker selbst haben diese Probleme über Jahrtausende hinweg erörtert. Und doch bleiben sie ungelöst. Hinzufügen ließe sich noch das bemerkenswerte Rätsel der mathematischen Fähigkeiten und Produktivität der ganz jungen, noch im Kindesalter befindlichen Menschen. Eine geheimnisvolle Tatsache, analog zu und nur dazu analog – dem Virtuosentum musikalischer Wunderkinder oder kindlicher Schachmeister. Gibt es da Querverbindungen? Existiert bei einer Handvoll menschlicher Wesen (Mozart, Gauß, Capablanca) eine hervorstechende Neigung zum Nutzlosen?
Da Philosophie und philosophische Psychologie auf sprachliche Mittel angewiesen sind, stehen sie diesem Puzzle hilflos gegenüber. So mancher Dichter wiederholte eine antike Klage: »Wäre ich Philosoph geworden, wenn ich Mathematiker hätte sein können?«
Im Hinblick auf die Erfordernisse der Philosophie weist die natürliche Sprache schwerwiegende Mängel auf: Sie kann sich weder mit der Universalität der Musik noch mit jener der Mathematik messen. Selbst die am weitesten verbreitete Sprache – heutzutage das Angloamerikanische – ist regional begrenzt und zeitgebunden. Keine Sprache kann es mit den Fähigkeiten der Musik zu polysemantischer Gleichzeitigkeit, zu unübersetzbarer, vielfältiger Bedeutung der Formen aufnehmen. Das Vermögen der Musik, Emotionen zugleich besonderen und allgemeinen, privaten und öffentlichen Charakters einzubeziehen, übersteigt jenes der Sprachen bei weitem. Blindheit kann bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden (es gibt Bücher in Blindenschrift). Taubheit, die Verbannung aus der Musik, bedeutet unweigerlich Exil. Auch können die natürlichen Sprachen mit der Präzision, der Eindeutigkeit, Endgültigkeit, der Berechenbarkeit und Transparenz der Mathematik nicht rivalisieren. Sie erfüllen die in der Mathematik geltenden Kriterien des Beweises oder der Widerlegung – es sind dieselben – nicht. Müssen wir, können wir meinen, was wir sagen, sagen, was wir meinen? Die implizite Erzeugung neuer Fragen, neuer Wahrnehmungen, innovativer Entdeckungen innerhalb der mathematischen Matrix hat in geschriebener oder gesprochener Sprache kein Äquivalent. Die voranstrebenden (Lösungs-)Wege der Mathematik scheinen freischwebend zu sein, keine Grenzen zu kennen. Sprachen wimmeln nur so von angestaubten Gespenstern und künstlichen Zirkelschlüssen.
Und dennoch. Die Definition der alten Griechen, die den Menschen als »sprechendes Tier« bezeichneten, die Sprache und sprachliche Kommunikation als das spezifisch Menschliche herausstellten, ist keine willkürlich gewählte Trope. Sätze, mündlich oder schriftlich geäußert (man kann die Tauben das Lesen und Schreiben lehren), sind das Organ, das unser Sein erst ermöglicht, jenen Dialog mit uns selbst und anderen, der unsere Identität schafft und festigt. Wörter, ungenau, zeitgebunden, wie sie nun einmal sind, lassen Erinnerung entstehen, artikulieren Zukunft. Hoffnung ist eine Zeitform der Zukunft. Selbst wenn wir sie auf naive Weise bildlich, un-bedacht gebrauchen, sind es doch Wörter, mit denen wir uns auf Begriffe wie Leben, Tod, das Ich oder der Andere beziehen. Hamlet zu Polonius. Das Schweigen ist selbst als Verneinung noch Echo der Sprache. Man kann schweigend lieben, aber wohl nur bis zu einem gewissen Punkt. Eigentliche Sprachlosigkeit tritt erst mit dem Tod ein. Ich habe versucht aufzuzeigen, daß die Episode von Babel ein Segen war. Jede Sprache kartographiert eine mögliche Welt, einen möglichen Kalender, eine mögliche Landschaft. Eine Sprache zu lernen heißt, das eigene Kirchturmdenken unermeßlich zu erweitern, heißt, ein neues Fenster der Existenz aufzustoßen. Wörter sind unbeholfen oder täuschen. Bestimmte Erkenntnistheorien sind der Ansicht, sie böten keinen Zugang zur Realität. Selbst reinste Lyrik wird von der Sprache begrenzt, in der sie zum Ausdruck kommt. Nichtsdestoweniger sind es die natürlichen Sprachen, die der Menschheit ihren Schwerpunkt verleihen (man beachte die moralischen und psychologischen Konnotationen dieses Begriffs). Aufrichtiges Lachen ist gleichfalls sprachlicher Natur. Vielleicht widersetzt nur das Lächeln sich der Paraphrase.
Die natürliche Sprache ist das unvermeidliche Medium der Philosophie. Der Philosoph mag seine Zuflucht zu technischen Begriffen und Neologismen nehmen; er mag wie Hegel danach trachten, vertraute Ausdrücke mit neuer Bedeutung aufzuladen. Doch im wesentlichen muß, abgesehen vom Symbolismus formaler Logik, die Sprache genügen. R.G. Collingwood drückte es in seinem Essay on Philosophic Method (1933) folgendermaßen aus: »Wenn Sprache sich selbst nicht erklären kann, kann nichts anderes sie erklären.« Deshalb ist die Sprache der Philosophie, »wie jeder aufmerksame Leser der großen Philosophen bereits weiß, keine Fach-, sondern eine literarische Sprache«. Die Grundsätze der Literatur sind maßgebend. In dieser sich aufdrängenden Hinsicht ähnelt die Philosophie der Dichtung. Sie ist »ein Gedicht der Vernunft« und repräsentiert »den Punkt, an dem Prosa der Lyrik am nächsten kommt«. Die Anziehung ist wechselseitig, denn oft wendet der Dichter sich an die Philosophen. Baudelaire verweist auf de Maistre, Mallarmé auf Hegel, Celan auf Heidegger, T.S. Eliot auf Bradley.
Wohl oder übel auf Übersetzungen zurückgreifend, möchte ich innerhalb der Begrenztheit meiner Sprachkompetenz einen Blick werfen auf einen Schatz an philosophischen Texten, auf ihre Entfaltung im Einzugsbereich literarischer Ideale und poetischer Redekunst, möchte synaptischen Berührungen zwischen philosophischem Argument und literarischem Ausdruck nachspüren. Dieses Ineinandergreifen, diese Verschmelzungen sind niemals vollständig, doch versetzen sie uns ins Herz der Sprache und der kreativen Vernunft. »Was wir nicht denken können, das können wir nicht denken; wir können also auch nicht sagen, was wir nicht denken können.« (Tractacus, 5.61)
2
Die Glut intellektueller und poetischer Kreativität auf dem griechischen Festland, in Kleinasien und auf Sizilien im fünften und sechsten Jahrhundert vor Christus ist einzigartig in der menschlichen Geschichte. In mancher Hinsicht ist das Leben des Geistes danach nur eine weitschweifige Fußnote. Soviel ist seit langem bekannt. Doch die Ursachen dieser Sonneneruption, die Triebkräfte, die sie zu jenem Zeitpunkt, an jenem Ort herbeiführten, bleiben unklar. Die jetzt vorherrschende reumütige »political correctness«, die postkolonialen Gewissensbisse lassen es als unangebracht erscheinen, die vielleicht einschlägigen Fragen zu stellen, zu fragen, warum das Feuer, das Wunder reinen Denkens fast nirgendwo sonst auftrat (welcher Lehrsatz wäre denn aus Afrika gekommen?).
Vielfache und komplexe Faktoren müssen in Wechselwirkung getreten, »implodiert« sein, um der Atomphysik einen entscheidenden Begriff aus dem Bereich der Teilchenkollisionen zu entlehnen. Dazu gehörten das milde Klima und der mühelose maritime Austausch. Argumente reisten schnell, sie waren im alten und im übertragenen Sinne »quecksilbrig« 1. Das Vorhandensein von Eiweiß, das der Welt südlich der Sahara so schmerzvoll abging, mag entscheidend gewesen sein. Ernährungswissenschaftler sprechen vom Eiweiß als »brain-food«. Hunger, Unterernährung lähmen die Gymnastik des Geistes. Es gibt noch viele ungeklärte Fragen im Hinblick auf das alltägliche Umfeld der Sklaverei und deren Einfluß auf individuelle und gesellschaftliche Sensibilität, auch wenn schon Hegel ihre zentrale Rolle erspürte. Offensichtlich jedoch ist, daß für die Privilegierten – und ihrer waren viele – der Besitz von Sklaven Muße und Befreiung von manuellen und häuslichen Aufgaben mit sich brachte. Er verschaffte Zeit und Raum für das freie Spiel des Geistes. Dies bedeutete eine immense Freiheit. Weder Parmenides noch Platon mußten ihren Lebensunterhalt verdienen. Unter gemäßigten Himmeln kann ein wohlgenährter Mann darangehen, auf der Agora oder in den Hainen der Akademie Argumente vorzubringen oder ihnen zu lauschen. Ein drittes Element ist am schwierigsten zu bewerten. Von brillanten Ausnahmen abgesehen, führten Frauen eine ans Haus gebundene Existenz, hatten oft eine dienende Rolle inne, ganz gewiß bei den philosophisch-rhetorischen Angelegenheiten der polis. Einige mögen Zugang zu höherer Bildung gehabt haben, doch gibt es aus der Zeit vor Plotin nur wenig Belege dafür. Trug diese (erzwungene, traditionelle?) Enthaltung zum Luxus und zur Arroganz spekulativen Denkens bei? Reicht sie, angesichts des auffallend moderaten Beitrags von Frauen zur Mathematik und Metaphysik, bis in unsere heutige, anders geartete Zeit? Eiweiß, Sklaverei, männliche Vorherrschaft: Wie groß war ihr kumulativer Einfluß auf des griechische Wunder?
Denn eines ist klar: Ein Wunder war es in der Tat.
Es bestand in der Entdeckung – auch wenn dieser Begriff die Sache nicht wirklich trifft – und Kultivierung abstrakten Denkens, zweckfreier Betrachtung und Fragestellung, unbeeinflußt vom Nützlichkeitsdenken und den Erfordernissen der Landwirtschaft, der Seefahrt, der Maßnahmen gegen Überschwemmungen, der astrologischen Vorhersage. Diese bei den Mittelmeeranrainern, den nahöstlichen und indischen Zivilisationen vorherrschenden Denkweisen hatten oft brillante Erfolge gezeitigt. Wir neigen dazu, die Revolution des griechischen Denkens als selbstverständlich vorauszusetzen, sind wir doch dessen Geschöpfe. Dabei ist sie merk-würdig und un-erhört. Parmenides' Gleichsetzung von Denken und Sein, Sokrates' Leitsatz, daß ein ungeprüftes Leben es nicht wert sei, gelebt zu werden, sind Provokationen von wahrhaft phantastischem Ausmaß. Sie verkörpern den Vorrang des Nutzlosen, so wie es uns aus der Musik vertraut ist. In Kants stolzen Worten: Sie streben das Ideal der Interesselosigkeit an. Die Bereitschaft, sein Leben abstrakten, nutzlosen Obsessionen zu opfern, wie Sokrates es tat oder auch Archimedes, als er über Kegelschnitte nachsann, mag seltsam, ja aus ethischer Sicht verdächtig erscheinen. Die Erscheinungsweise reinen Denkens ist in ihrer Fremdheit fast dämonisch. Pascal und Kierkegaard legen Zeugnis ab davon. Aber griechische Mathematik und spekulative, theoretische Diskussion, welche die Jagd nach Wahrheit über persönliches Wohl und Wehe stellen, diese Tiefenströmungen eines brillanten »Autismus« setzen die große westliche Reise in Gang, jene »Fahrt über seltene Meere«, die Wordsworth Newton zuschreibt. Unsere Theoriebildung, unsere Wissenschaften, unsere vernunftbestimmten, oft so dunklen Meinungsverschiedenheiten und Wahrheitsfunktionen entstammen jenem ionischen Licht. Wir sind, wie Shelley verkündete, »alle Griechen«. Ich wiederhole mich: Ein Wunder war es, das aber auch fremdartige – vielleicht unmenschliche Züge aufweist.
Philosophische und literarische Prosa, Prosa als solche, treten spät auf. Ihr Selbstverständnis geht kaum weiter als bis zu Thukydides zurück. Prosa ist völlig durchlässig für das Durcheinander und die Korruption der »realen Welt«. Ontologisch betrachtet ist sie weltlich (mundum). Erzählende Sequenzen führen oft das trügerische Versprechen logischer Bezüge und Zusammenhänge mit sich. Jahrtausende mündlicher Überlieferung gehen dem Gebrauch von Prosa – mit Ausnahme derjenigen für administrative oder merkantile Zwecke (jene in Linear B 2 abgefaßten Listen von Haustieren) – voraus. Die Niederschrift philosophischer Aussagen und Erörterungen, von Fiktionen und Geschichte ist eine spezialisierte Verästelung, möglicherweise Symptom eines Niedergangs. Wie bekannt betrachtete Platon sie mit Widerwillen. Die Schrift, macht er geltend, korrumpiere und schwäche die ursprünglichen Kräfte und Fähigkeiten des Gedächtnisses, der Mutter der Musen. Dadurch, daß sie unmittelbare Infragestellung und Selbstkorrektur verhindere, erwecke sie den Anschein von Autorität, doch sei diese künstlicher, unechter Natur. Sie erhebe unangemessene Ansprüche auf Größe und Bedeutung. Nur der mündliche Austausch, die Möglichkeit des Einschreitens, wie sie in der Dialektik auftrete, könne die geistige Erforschung beleben und zu verantwortungsbewußter Einsicht führen, einer Einsicht, die andere Auffassungen zulasse.
Daher der wiederholte Rückgriff auf den Dialog in Platons Werk selbst, in den verlorengegangenen Büchern des Aristoteles, bei Galilei, Hume oder Valéry. Weil sie in ihrer schriftlichen Form die Dynamik der gesprochenen Sprache bewahrt, weil sie ihrem Wesen nach stimmhaft ist und der Musik verwandt, geht Dichtung der Prosa nicht nur voraus, sondern ist paradoxerweise die natürlichere Ausdrucksweise. Im Gegensatz zur Prosa stärkt, nährt Dichtung das Gedächtnis. Ihre Allgemeingültigkeit ist in der Tat jene der Musik; viele ethnische Vermächtnisse kennen keine andere Gattung. In hebräischen Schriftstücken sind die prosaischen Elemente in Versmaß gefaßte innere Regungen. Liest man sie mit lauter Stimme, nähern sie sich dem Lied an. Ein gutes Gedicht vermittelt einen Neubeginn, die vita nova des Un-Erhörten, Noch-nie-Dagewesenen. Der überwiegende Teil der Prosa ist ein Geschöpf der Gewohnheit.
Grenzziehungen zwischen Metaphysik, Wissenschaft, Musik und Literatur, die wir fast beiläufig vornehmen, hatten im archaischen Griechenland keine Bedeutung. Wir wissen so gut wie nichts über die orakelhaften, rhapsodischen, didaktischen Ursprünge des späteren kosmologischen Denkens. Wissen nichts über jene Schamanen der Metapher, denen wir den westlichen Geist verdanken, die das Fundament legten für das, was Yeats »Monumente nicht alternden Geistes« nannte. Rückführungen auf orphische Zirkel, Mysterienkulte, erste Kontakte mit persischen, ägyptischen, vielleicht auch indischen Praktiken und Weisheiten bleiben im besten Fall hypothetisch. Man kann davon ausgehen, daß die vorsokratischen Lehren rezitiert, vielleicht gesungen wurden, wie Nietzsche glaubte. Lange Zeit waren die Grenzen zwischen Schöpfungsmythen, allegorischen Fiktionen einerseits und philosophischen Aussagen andererseits fließend (Platon war ein Virtuose des Mythos). In einer nicht näher bestimmbaren Phase nimmt die Abstraktion, das cogito, seine beherrschende, autonome Stellung, seine ideale Besonderheit ein; Theorien – ein erklärungsbedürftiger Begriff, der vielen Kulturen fremd ist –, welche die Elemente und Anordnungen der natürlichen Welt, die Natur des Menschen und seinen moralischen Status oder Politik im umfassenden Sinne betrafen, ließen sich am treffendsten in poetischer Form ausdrücken. Diese wiederum erleichterte das Erinnern, die Einprägung ins Gedächtnis. Die rhapsodischen Vorläufer, ihre Unterminierung der Textualität verstörten Platon. Man beachte nur seine besorgte Ironie in Ion. Auch in Wittgensteins Paradoxien zum Ungeschriebenen findet sich diese Unterminierung. Der Glaube, daß Homer und Hesiod die wahren Weisheitslehrer seien, dauert fort. Das Paradigma des philosophischen Gedichts, in dem ästhetische Artikulation und systematische Erkenntnis nahtlos ineinander übergehen, hat Bestand bis in die Moderne. Lukrez' Bestreben, »zu den dunkelsten Themen die hellsten Gesänge anzustimmen«, hat nie seinen Zauber verloren.
Die Ästhetik des Fragments hat in letzter Zeit Aufmerksamkeit erregt, und nicht nur in der Literatur. In den bildenden Künsten wurden die Skizze, das Modell, der grobe Entwurf mehr gepriesen als das abgeschlossene Werk. Die Romantik stattete das Unvollendete, von einem frühen Tod Gesegnete, mit einer Aura aus. Vieles von dem, was emblematisch ist für die Moderne, blieb unvollendet: die Romane Prousts und Musils, die Opern Bergs und Schönbergs, die Architektur eines Gaudí. Rilke preist den Torso, T.S. Eliot dienen Fragmente als Stützen »gegen unseren Ruin«.
Die Angelegenheit ist von Bedeutung. Die zentrifugalen, anarchischen Bewegungen in der modernen Politik, das accelerando in Wissenschaft und Technik, die Untergrabung klassischer, stabiler Vorstellungen von Bewußtsein und Bedeutung durch Psychoanalyse oder Dekonstruktion lassen eine systematische, umfassende Übereinstimmung als unwahrscheinlich erscheinen. »Das Zentrum hält nicht mehr.« Der enzyklopädische Ehrgeiz der Aufklärung, die ungeheuren, positivistischen Konstrukte eines Comte oder Marx überzeugen nicht länger. Es fällt uns schwer, die »großen Geschichten« zu erzählen oder an sie zu glauben. Wir fühlen uns hingezogen zum offenen Ende, zur forma aperta. Levinas unterscheidet zwischen den Zwängen, Ansprüchen, Ausschlüssen der »Totalität«, des Totalitären, und dem befreienden, seinem Wesen nach messianischen Versprechen der »Unendlichkeit«. Adorno setzt Vollständigkeit geradezu mit Falschheit gleich.
Diese Antinomien sind so alt wie die Philosophie selbst. Als Entsprechung vielleicht zu fundamentalen Gegensätzlichkeiten in der menschlichen Sensibilität gab es die großen Baumeister und jene anderen, die eine lebhafte Kurzschrift, eine wechselhafte, in Bewegung befindliche Wahrnehmung vorzogen. In die Ahnenreihe des Aristoteles gehören die Versuche umfassenden (Ein-)Sammelns, des Erntens. Die Fülle eines Augustinus oder die Summa des Thomas von Aquin stehen in dieser Reihe, ebenso der axiomatische Zusammenhang von Spinozas Ethik oder der Newtonsche Universalismus Kants. Unter den Systembildnern ragt Hegel heraus, dessen Rückgriff auf den Begriff »Enzyklopädie« einen jahrtausendealten Ehrgeiz krönt. Wenn die Sirenen dem vorbeifahrenden Seemann versprechen, alles, was gewesen ist, was ist und noch sein wird, zu enthüllen, setzen sie Hegel in Musik.
Die Gegenströmung reicht zurück bis zu den Vorsokratikern und den schroffen, parataktischen Aphorismen des Predigers Salomo. Auch wenn sie formal betrachtet wortreich und diskursiv sind, so schreiten doch Montaignes Essais – man beachte die ursprüngliche Wortbedeutung – sprunghaft und mit Abschweifungen voran. Sie beziehen Marginalien und Betrachtungen zur Existenz ein. Pascals Pensées gelingt es, das augenscheinlich Unvereinbare zu vereinen: fragmentarische Größe, gebrochene Unermeßlichkeit. Dieses Modell steht ebenfalls Pate bei den »Momentaufnahmen« eines Novalis oder Coleridge, und zwar genau dort, wo diese Denker vom Trugbild eines omnium gatherum (Coleridges makkaronisierende Wendung) heimgesucht wurden. Der gesamte Nietzsche, der gesamte Wittgenstein ist fragmentarisch, manches Mal gewollt, dann wieder zufälligen Umständen geschuldet. Im Gegensatz dazu belaufen sich Heideggers Schriften auf neunzig Bände, wobei er das unabgeschlossene Werk Sein und Zeit in der Folge unablässig überarbeitete. Nur jene schreiben und veröffentlichen Bücher, die zu schwach oder zu eitel sind, es nicht zu tun, sagt Wittgenstein. Die Wahrheit des Fragments mag, unter glücklichen Umständen, an jene des Schweigens heranreichen.
Die Form, in der vorsokratisches Denken zu uns gelangte, ist gewiß weitgehend vom Zufall bestimmt. Was wir besitzen, sind Restbestände. Viele der verstreuten Wendungen sind – möglicherweise ungenau – eingebettet in spätere, oft polemische und umstrittene Zusammenhänge (so etwa bei den Kirchenvätern oder bei aristotelischen Verleumdern). Die materiellen Voraussetzungen für die Erhaltung ausführlicher Schriften entwickelten sich nur langsam. Kaum daß sie der Abfassung der Homerischen Epen vorausgingen. Nur ein einziges Mal zieht Sokrates eine Schriftrolle zu Rate. Aber es gibt auch substantiellere Gründe für die aphoristische Form, den apodiktischen Ton dieser frühen Verkündigungen.
Wenn der Magus von Milet kundtut, daß alle Materie auf Wasser gründet, wenn ein rivalisierender Weiser aus Ephesus behauptet, daß alles letztlich aus Feuer bestehe, wenn ein sizilianischer Seher die Einheit aller Dinge verkündet, während ein umherziehender Sophist auf ihrer Vielfalt besteht, dann ist dem, streng betrachtet, nichts hinzuzufügen. Eine Beweisführung, die wie in der Mathematik Schritt für Schritt vorgeht, setzt sich in der Kosmologie und der Metaphysik nur allmählich durch. Anfänglich sind Denken und Sagen gewissermaßen berauscht vom Absoluten, trunken von der Macht, daß ein Satz die Welt aussage. Äußerste Knappheit übt zudem das Gedächtnis, und ihre Wirkung wird bei mündlicher Darbietung noch verstärkt. Das schiere Volumen der Platonischen Dialoge hat keinen geringen Anteil an ihrem revolutionären Genie. Obwohl auch dort häufig Rückgriffe auf eine fiktive mündliche Darstellung, auf Wiedergabe durch Erinnern anzutreffen sind. Die bündigen Lehren der Vorsokratiker können mündlich weitergegeben und so von einer des Lesens und Schreibens unkundigen Gemeinschaft erinnert werden. »Pygmäen ihrem Ausmaße nach« (Jonathan Barnes), erzählen diese archaischen Reste von gewagten, überwältigenden Vorstößen in unbekannte Meere. Die Gleichsetzung philosophischen Denkens mit einer Odyssee wird bis Schelling Bestand haben.
Daß diese Spuren dunkel bleiben, könnte durchaus beabsichtigt sein, auch wenn unsere Unwissenheit im Hinblick auf Szenerie und sprachliche Besonderheiten dazu beitragen. Die »Orphische«, »Heraklitische«, »Pythagoräische« Hermetik ließe auf eine mögliche Existenz theosophischer, philosophischer, selbst politischer Zirkel von Eingeweihten schließen. Wittgensteins Anhänger stellen ein modernes Gegenstück dar. Bezüge zwischen der Genese philosophischer Rationalität und viel älterer, ritualisierter dichterischer Darbietung bieten sich an. Das Orpheus-Thema ist unentwirrbar mythisch, läßt uns aber die gemeinsame Quelle von Musik und Sprache erahnen. Die schiere Kraft der Fabel hat über Jahrtausende nicht nachgelassen. Schon zu Zeiten der Alten belehrte Orpheus' visionäre Weisheit die gebannten Zuhörer über den Ursprung des Kosmos und die Einsetzung der olympischen Hierarchie. Für Mythographen des Mittelalters und der Renaissance, für Künstler und Dichter machte dieser gesungene Abriß, wie er etwa in den Argonautika des Apollonios von Rhodos überliefert war, Orpheus zum Urheber kosmologischer Einsichten. Zu einem tragischen Urheber, in dessen Nachfolge die Philosophie nie den inspirierenden, belehrenden Schatten des Todes verließ.
Die Einheit aus Dichtung, Musik und Metaphysik sucht die Philosophie weiterhin heim gleich einem brüderlichen Geist. Kurz vor seinem Ende wendet Sokrates sich Aesop und dem Gesang zu. Hobbes übersetzt Homer in Verse. Der harsche Hegel schreibt ein tiefempfundenes Gedicht an Hölderlin. Nietzsche sieht sich als Komponist. Wie Wittgenstein zur Dichtung* 3 stand, habe ich schon zitiert. Passagen aus Platon und aus dem Tractatus sind vertont worden. Wir haben gesehen, daß die herausragendsten dieser Bestrebungen auf keinerlei Nutzen aus sind. Schon Thales soll alle materiellen Vorteile ausgeschlagen haben. Pragmatisch betrachtet ist es absurd, der Verteidigung einer spekulativen Hypothese sein Leben zu opfern, auf wirtschaftliche Sicherheit und gesellschaftliche Anerkennung zu verzichten, um Bilder zu malen, die niemand sehen, geschweige denn kaufen will; Musik zu komponieren, ohne daß eine realistische Aussicht auf Aufführung oder Hörerschaft besteht (elektronische Medien haben dieses Paradox abgeschwächt); topologische Räume zu entwerfen, die auf immer jenseits der Beweisbarkeit oder Entscheidbarkeit bleiben werden.
Es ist ein gefälliges Klischee, Dichtung mit den Verrücktheiten der Liebe in Verbindung zu bringen. Aber die innere Einsamkeit und das Meiden der Normalität, die es Gödel ermöglichten, all seine Energie der Logik zu widmen, sind nicht weniger seltsam. Der (philosophische) Eros hat seine Entschädigungen. Warum sind dunkle philosophische Erörterungen für einige Menschen unentbehrlich? Welche selbstlose Leidenschaft, oder welcher Hochmut, brachte Parmenides und Descartes dazu, Denken und Sein als identisch zu setzen? Wir wissen es nicht wirklich.
Ich habe angeregt, die »Entdeckung« der Metapher als Zündfunken abstrakten, uneigennützigen Denkens zu sehen. Sind Tiere in der Lage, Metaphern zu bilden? Nicht nur die Sprache ist gesättigt mit Metaphern. Unser Drang, unsere Fähigkeit, alternative Welten zu ersinnen und zu untersuchen, logische und narrative Möglichkeiten jenseits empirischer Beschränkungen zu konstruieren, sind es auch. Die Metapher trotzt dem Tod, überwindet ihn – wie in der Erzählung von Orpheus aus Thrakien –, gerade weil sie Zeit und Raum transzendiert. Leider sind wir nicht in der Lage, den Ort oder die Stunde anzugeben, da im alten Griechenland oder in Ionien jemand zum ersten Mal das Meer sich »weinrot« färben sah oder der Mann im Kampf zum »brüllenden Löwen« wurde. Kann man überzeugend darlegen, daß Musik und Mathematik metaphorischer Natur sind? Inwieweit kann man ihren Bezug zum Alltag metaphorisch, als radikale Distanzierung deuten? Wofür steht eine Mozartsonate, eine Goldberg-Variation?
Die vorsokratische Philosophie scheint aus einem metaphorischen Magma hervorgebrochen zu sein (das Vulkanische liegt nicht weitab). Hatte ein Reisender in Argos die Schafhirten auf den steinigen Hügeln erst einmal als »Hirten des Windes« gesehen, ein Seemann aus Piräus gespürt, daß sein Kiel »die Meere durchpflügte«, war der Weg frei für Platon und Immanuel Kant. Alles begann mit Dichtung und hat sich nie sehr weit davon entfernt.
»Die Kraft des Heraklitischen Denkens und Stils ist so überwältigend, daß sie die Vorstellungskraft seiner Leser mit sich zu reißen vermag, in Bereiche jenseits der Grenzen nüchterner Interpretation.« Dies bemerkte Hermann Fränkel, ein eher sachlicher Gelehrter. Die Geschichte der Auslegungsversuche Heraklitischer Fragmente, die in späteren Zusammenhängen oft verstümmelt oder ungenau wiedergegeben wurden, gehört selbst zu den großen Abenteuern des westlichen Geistes, von vorplatonischer Zeit bis hin zu Heidegger. Für Blanchot ist Heraklit der erste surreale Virtuose. Für viele Künstler und Dichter ist er das Inbild meditativer Einsamkeit und aristokratischen Alleinseins. »Ce génie fier, stable et anxieux« 4, schreibt René Char, wie T.S. Eliot im Banne einer Stimme, welche die Hülsen vereitelter Übersetzungen verzehrt. Doch Sextus Empiricus und Marc Aurel lasen Heraklit als engagierten (Staats-)Bürger und als jemanden, der gemeinschaftliche Bräuche gewissenhaft pflegte. Für Nietzsche »wird sein Erbe niemals altern«. Zusammen mit Pindar, so Heidegger, beherrscht Heraklit eine Sprache, die den unvergleichlichen »Adel des Anfangs« beweist. Die Morgenröte der Bedeutung.