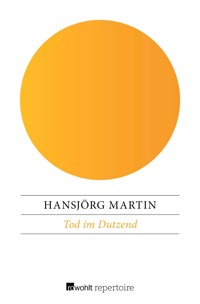4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Ich wollte Hannes Pohl wachrütteln, als unser kleiner Bus vor der Theaterwerkstatt hielt. Er hatte schon hinten in der Ecke gehockt, als wir Möbel, Requisiten und Kulissen im Anhänger verstaut hatten und einstiegen. Wir dachten, er schliefe. Als ich ihn nun rüttelte und ‹Aussteigen, Endstation!› sagte, rutschte er langsam von der Sitzbank und rollte auf die Seite. Er war blau im Gesicht und hatte die Augen offen. Ich sah, daß er mit seinem eigenen Schlips erdrosselt worden war …» Mord im Milieu der kleinen Wanderbühne, in deren Ensemble einer den anderen kennt wie seine Westentasche? Mord in der Kleinstadt, wo jeder von jedem alles weiß? Der Bühnenbildner Jost Ziball kann sich zwar nicht vorstellen, wer etwas gegen Hannes Pohl, den begabten und beliebten jungen Schauspieler, gehabt haben sollte, aber die Aufklärung des Verbrechens wird unter diesen Umständen sicherlich nicht lange auf sich warten lassen. Indessen stellt sich heraus, daß Menschen einander eben doch nicht immer so gut kennen, wie sie glauben, und allem Anschein nach kommt die Polizei nicht recht weiter. Das könnte Ziball egal sein – wenn er nicht den Zettel mit der anonymen Drohung und der Telefonnummer gefunden hätte. Wenn er nicht selbst etwas von Polizeiarbeit verstünde. Wenn nicht der Tote sein Freund gewesen wäre … Ziball will eigentlich gar nicht, aber plötzlich ertappt er sich dabei, wie er auf eigene Faust Ermittlungen anstellt. Ziball ist neugierig geworden. Aber es ist eine gefährliche Neugier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Hansjörg Martin
Gefährliche Neugier
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Ich wollte Hannes Pohl wachrütteln, als unser kleiner Bus vor der Theaterwerkstatt hielt. Er hatte schon hinten in der Ecke gehockt, als wir Möbel, Requisiten und Kulissen im Anhänger verstaut hatten und einstiegen. Wir dachten, er schliefe. Als ich ihn nun rüttelte und ‹Aussteigen, Endstation!› sagte, rutschte er langsam von der Sitzbank und rollte auf die Seite. Er war blau im Gesicht und hatte die Augen offen. Ich sah, daß er mit seinem eigenen Schlips erdrosselt worden war …»
Mord im Milieu der kleinen Wanderbühne, in deren Ensemble einer den anderen kennt wie seine Westentasche? Mord in der Kleinstadt, wo jeder von jedem alles weiß? Der Bühnenbildner Jost Ziball kann sich zwar nicht vorstellen, wer etwas gegen Hannes Pohl, den begabten und beliebten jungen Schauspieler, gehabt haben sollte, aber die Aufklärung des Verbrechens wird unter diesen Umständen sicherlich nicht lange auf sich warten lassen.
Indessen stellt sich heraus, daß Menschen einander eben doch nicht immer so gut kennen, wie sie glauben, und allem Anschein nach kommt die Polizei nicht recht weiter. Das könnte Ziball egal sein – wenn er nicht den Zettel mit der anonymen Drohung und der Telefonnummer gefunden hätte. Wenn er nicht selbst etwas von Polizeiarbeit verstünde. Wenn nicht der Tote sein Freund gewesen wäre … Ziball will eigentlich gar nicht, aber plötzlich ertappt er sich dabei, wie er auf eigene Faust Ermittlungen anstellt. Ziball ist neugierig geworden. Aber es ist eine gefährliche Neugier.
Über Hansjörg Martin
Hansjörg Martin (1920–1999) war ursprünglich Maler und Graphiker. Nach dem Krieg arbeitete er als Clown, war Bühnenbildner und Dramaturg, dann freier Schriftsteller. Er schrieb Kriminalromane und Kinder- und Jugendbücher.
Inhaltsübersicht
Die Hauptpersonen
JOST ZIBALL
lebt, aber man versucht, dem abzuhelfen
LYDIA BORNSCHEIN
lebt vom Zimmervermieten
HANNES POHL
lebt nicht mehr
WALTRAUD BURY
eine Lebedame
FERDINAND HOCH
lebt auf großem Fuß
GISELA EGGERS
lebt noch, weil sie Glück hatte
A. SIBBERFOOT
lebt vom Importgeschäft, aber kurz
DAS EHEPAAR ZANDER
lebt vom kulturellen Leben
EMMY GROTRIAN
lebt zurückgezogen, aber es hilft nichts
RICHARD WAGNER
lebt passenderweise im Nibelungenweg
KOMMISSAR WUST
ist auch nur ein Mensch, aber man merkt’s nicht gleich
DER STAATSANWALT
ist im entscheidenden Moment verreist
HERBERT PARIS
– sozusagen
einem meiner Vorbilder –
in Freundschaft gewidmet.
H.M.
ZUERST HAB ICH NUR GEDACHT: Geht das wieder los? – Denn ich kannte Gesichter wie dieses aus tausend bösen Träumen …
Ich hatte Hannes Pohl wachrütteln wollen, als unser kleiner Bus vor der Theaterwerkstatt hielt. Es war nachts halb eins. Wir hatten in Eckelsum gespielt. Sartre: «Geschlossene Gesellschaft». Hannes Pohl spielt den Garcin, Gisela Eggers die Ines, Waltraud Bury die Estelle und Ferdinand Hoch den Kellner. Es war eine gute Aufführung gewesen, obschon ich glaube, daß die Leute auf dem Lande nicht viel Freude an solchen Stücken haben. Aber wir können nicht immer nur Klamotten spielen, «Hurrah, ein Junge!» – oder so was.
Die Bury war in Ferdinand Hochs Auto mit nach Hause gefahren, so daß wir nur zu sechst im Bus waren. Gisela, Ludwig Hallbaum, der Beleuchter, der auch chauffierte, und ich saßen vorn. Die zwei Bühnenarbeiter hatten auf der Mittelbank Platz genommen, und hinten hatte Hannes Pohl in einer Ecke gehockt.
Er hatte schon dort gesessen, als wir mit dem Abbau der Dekoration fertig waren, die Möbel, Requisiten und Kulissen in den Anhänger verstaut hatten und einstiegen. Wir glaubten, er schliefe. Aber da muß er schon tot gewesen sein …
Ich hatte noch zu Ludwig Hallbaum gesagt: «Laß ihn doch in Ruh!» – als der ihm einen Bierdeckel unters Kinn schieben wollte.
Als ich ihn nun rüttelte und «Aussteigen, Endstation» sagte, rutschte er sanft von der Sitzbank und rollte auf die Seite. Sein Gesicht war wie die Gesichter, die mich so lange verfolgt haben: Graublau und mit offenen Augen.
Ich bin nämlich seinerzeit ein paar Monate in Polen gewesen. Sie hatten fast alle Beamten der Kripo, die unter dreißig waren, dorthin geholt. Wir mußten ‹aussiedeln› helfen. Jeder weiß, wie das war, und ich bin fast verrückt geworden und habe mich an die Front gemeldet.
Hannes Pohl sah genauso aus wie die, die damals – genug!
Ich hatte gehofft, solchen Gesichtern nicht mehr zu begegnen, als ich mit der Uniform auch den Beruf an den Nagel hängte.
Ich muß geschrien haben, denn Ludwig kam und die zwei Bühnenarbeiter kamen, und Gisela Eggers, die schon ausgestiegen war, kletterte zurück in den Bus. Sie sagte: «Was ist denn los?» und beugte sich über die Sitze. Wir zerrten zu viert Hannes wieder auf die Bank.
Sein Mantel ging auf und wir sahen, daß er mit seinem eigenen Schlips erdrosselt war.
Ein schicker Schlips, ich hatte Hannes noch damit gefoppt, weil ich’s albern fand, für einen Schlips fünfzehn Mark auszugeben, bei der Gage – auch wenn er nebenbei am Funk verdiente.
Gisela gab einen kleinen Schrei von sich und kippte auf den Fahrersitz und saß da und wimmerte. Das Ganze hat keine Viertelstunde gedauert, aber mir kommt es jetzt vor, als hätten wir einen Tag lang da gestanden. Ich gab Ludwig das Schlüsselbund: «Ruf von meinem Zimmer aus Doktor Herbst an», sagte ich, «und die Polizei!»
Ludwig ist ein Brocken von einem Mann, einsfünfundachtzig, hundert Kilo. Seine Hände zitterten, als er die Schlüssel nahm. Er schluckte und nickte und stieg mit einem verstörten Gesicht aus dem Bus. Gisela Eggers kriegte einen hysterischen Anfall, als Ludwig ausstieg.
«Tut doch was!» schrie sie und krampfte die Finger um die Lehne des Fahrersitzes. «Steht doch nicht rum, verdammt noch mal! So helft ihm doch!»
Der eine Bühnenarbeiter beugte sich zu Hannes.
«Nicht anfassen!» sagte ich.
«Was denn?» schrie Gisela. «Richtet ihn doch auf! Macht doch wenigstens Wiederbelebungsversuche!»
«Beruhige dich, Mädchen!» sagte ich. «Es hat keinen Sinn mehr!»
Sie vergrub den Kopf zwischen die Arme, so daß ihre langen blonden Locken über den Kunstlederbezug hingen.
«Ogottogottogott», flüsterte sie immerzu ganz schnell.
«Was sollen wir machen?» fragte der Bühnenarbeiter.
«Nichts», sagte ich, «warten!» Es war kalt.
«Mach ihm doch wenigstens die Augen zu!» stöhnte der andere Bühnenarbeiter.
Ich deckte vorsichtig meinen Schal über Hannes’ Gesicht.
Zu allem Überfluß war Frau Bornschein noch wach, als ich nach Hause kam. Sie ist immer wach, wenn irgendwas los ist, als ob sie einen sechsten Sinn für ungewöhnliche Ereignisse hat. Sie kam aus ihrer Stube, als sie mich hörte. Es war kurz nach zwei.
Sie sah aus wie eine Kaffeemütze meiner Mutter. Die war mit demselben großgeblümten Stoff überzogen, aus dem Frau Bornscheins Morgenrock bestand.
Ich mag Frau Bornschein gern, sie hat stets einen Ausdruck, als ob sie «Hast du deine Schulbrote aufgegessen?» sagen wollte. Ich mag auch gern in ihrer Stube sitzen und mit ihr schwatzen. Obwohl die Stube bei Tageslicht ein Greuel ist, mit all den Plüschtroddeln, Chippendalehunden und Fotos aus Frau Borscheins großer Zeit, als sie noch Soubrette am Stadttheater Chemnitz war und ihr die Welt zu Füßen lag, wenn sie die Adele sang, zum Beispiel … obwohl also die Stube am Tage ein Greuel ist – abends ist sie sehr gemütlich.
In dieser Nacht allerdings war mir nicht nach Gemütlichkeit und Chemnitzer Erinnerungen. Ich dachte an die Flasche Weinbrand, die in meinem Kleiderschrank stand, an mein Bett und hoffte, mit beider Hilfe über die Geschichte für’s erste hinwegzuschlafen.
Aber so leicht war’s natürlich nicht, an Frau Bornscheins angestauter Neugier vorbeizukommen.
«So spät?» fragte sie. «Hatten Sie eine Panne, Herr Ziball?»
«Ja», sagte ich und wollte «Gute Nacht» wünschen und weitergehen.
«Kommt denn der Herr Pohl auch gleich?» wollte sie wissen und blieb hartnäckig im schmalen Flur stehen.
«Nein», sagte ich, «der kommt heute nacht nicht.»
«Aha», meinte Frau Bornschein, und ihre Stimme klang nach Mißbilligung und zugleich nach mütterlicher Nachsicht. «Ja ja – die kleinen Mädchen!»
«Ja», brummte ich. Was sollte ich denn sagen? Wenn ich ihr erzählt hätte, was passiert war, wäre meine Aussicht auf Flasche und Bett zerronnen wie Schminke unter Jupiterlampen. Und was hätte es geholfen? Also wiederholte ich: «Ja – die kleinen Mädchen!» und drängelte mich an ihrem Kaffeemützen-Morgenmantel vorbei.
Um halb vier klingelte es. Ich wurde sehr schnell wach und wollte auf Hannes Pohl schimpfen, denn ich glaubte, er wäre es und hätte wieder mal den Hausschlüssel vergessen. Aber als ich richtig zu mir kam und die Weinbrandbetäubung abgeschüttelt hatte, fiel mir alles wieder ein. Das war, als ob mir jemand mit einem Eisbeutel den Rücken lang schrubbte.
Ich hörte Frau Bornschein an der Flurtür hantieren und gleich darauf fremde Stimmen. Es mußten mehrere sein, zwei oder drei, und sie kamen den Gang entlang, von Frau Bornscheins aufgeregten Ausrufen begleitet. Ich schaltete immer noch nicht, bis nebenan die Tür von Hannes Pohls Zimmer geöffnet wurde und Frau Bornschein rief: «Aber der Herr Ziball hat mir nichts davon gesagt, Herr Kommissar!» Ein paar Minuten überlegte ich, ob ich mich schlafend stellen sollte, doch dann stand ich auf, goß mir noch einen kleinen Schluck ins Wasserglas – das schmeckte wie Sodom und Gomorrha – und zog den Bademantel an, um rüberzugehen.
Die Tür zu Hannes’ Zimmer stand offen. Frau Bornschein saß auf dem verwaisten Bett. Sie hielt sich ihren geblümten Morgenrock zu. Ihre Hände zitterten. Sie sah aus wie sechs Nächte nicht geschlafen und schaute mich mit schreckgeweiteten Augen so vorwurfsvoll an, daß ich mir sicher schlecht vorgekommen wäre, wenn der dicke Kommissar Wust mich nicht gleich angegrobscht hätte.
«Was wollen Sie denn hier?» fragte er. Manche Kommissare können einen so angucken, daß man sich ernsthaft überlegt, ob man ein Raub- oder ein Lustmörder ist.
«Ich wohne hier nebenan!» sagte ich. Er schnüffelte und kniff die Augen zusammen. Meine Weinbrandaussprache behagte ihm scheinbar nicht.
Wenn man sich nach so einem reizenden Abend keinen hinter die Binde gießen darf, wann dann sonst?
«Sagen Sie mal …» er vermied die direkte Anrede, «… wir haben Sie zwar schon zur Sache vernommen – aber warum haben Sie uns vorhin nicht gesagt, daß Hannes Pohl bedroht worden ist?»
Die zwei anderen, einer in Uniform, einer in Zivil, unterbrachen ihre Arbeit und sahen zu mir herüber. Drei Paar Kriminalpolizistenaugen sind schon eine Wucht, wenn man sie nicht mehr gewohnt ist, zwei Zahnputzbecher Schnaps im Magen und gerade einen Freund verloren hat. Ich war ein wenig langsam, meine Denkmaschine mußte erst durch einige Schichten Nebel durch.
«Sind Sie blau?» fragte Wust.
«Nicht so sehr, daß ich Ihnen nicht geistig noch eben so grade folgen könnte, Herr Kommissar», sagte ich. «Ich weiß von keiner Bedrohung! Wer hat ihn denn bedroht?»
Der dicke Wust brummte unzufrieden. Er zog sich einen Stuhl herbei, setzte sich gegenüber der armen Frau Bornschein neben die Tür und zündete sich eine Zigarette an. Daß er mir keine anbot, bewies, wie richtig ich ihn eingeschätzt hatte: Kleiner, tüchtiger, zuverlässiger Beamter – einer Mordsache gegenüber so hilflos wie ein Kabeljau auf Sand.
Mich haben Vernehmungen immer einen Haufen Zigaretten gekostet – damals. Man macht Leute, die Raucher sind, nur ärgerlich, wenn man sie in die Zange nimmt und ihnen dabei was vorqualmt. Und daß einer aus Wut was gestanden hätte, hab ich noch nicht gehört. Na ja, jeder hat seine Methode. Ich hatte nichts zu gestehen, sollte Wust ruhig rauchen. Die zwei anderen, die vorhin bei den Vernehmungen auf der Wache auch schon dabeigewesen waren, machten sich wieder an die Arbeit. Sie blätterten in Hannes Pohls Büchern, schüttelten jedes einzelne, nahmen die zwei Dutzend Mädchenfotos ab, die mit Reißnägeln innen an der Tür des Wandschranks festgeheftet waren, durchsuchten Stück für Stück die Hosen, Jacken und Mäntel, die im Schrank hingen, drehten die Taschen um, tasteten die Nähte ab und griffen zwischen Futter und Stoff. Sie waren außerordentlich gewissenhaft, die zwei – arbeiteten ohne Pause und ohne ein Wort und so systematisch, daß ihnen sicher nicht entgangen wäre, wenn Hannes Uranpechblende, Entwürfe zu Wasserstoffbomben oder vielleicht gar einen Panzerkreuzer irgendwo versteckt gehabt hätte.
Ich sah ihnen interessiert zu. Ein Haufen Erinnerungen stieg in mir auf. Ich hatte damals auch eine Reihe Haussuchungen machen müssen. Das ist ein langweiliges Geschäft und meistens mit allerlei Ärger verbunden. Wenn man irgendwas übersieht, was leicht passieren kann, gibt’s noch einen Rüffel, und wenn man zuviel findet, unter Umständen auch.
Wir haben mal zu viert bei einem Literaturwissenschaftler nach Adressen gesucht, die der Sicherheitsdienst gerne haben wollte. Der Mann war bei Kriegsbeginn ins Ausland geflohen und hatte erst von Paris und dann von London aus über den Rundfunk alle seine Freunde aufgefordert, ‹weiterzuarbeiten›. Also mußten irgendwo Adressen sein. Wir haben vier Tage lang von früh bis abends in Büchern geblättert – elftausend hatte der Mann –, ohne was zu finden. Ich war froh darüber, denn er war mir sympathisch gewesen, aber die Sucherei war zum Auswachsen. Ich bin schon sehr glücklich, daß ich umgesattelt habe.
«Tut mir leid, Herr Kommissar», sagte ich wahrheitsgemäß, «er hatte keine Feinde, soviel ich weiß. Weder bei der Technik noch überhaupt im Ensemble.»
«Nun – eine freundschaftliche Handlung dürfte das Zuziehen des Schlipsknotens wohl kaum gewesen sein!»
«Sind Sie denn sicher, daß es jemand von uns gemacht hat?» fragte ich.
«Sicher nicht – natürlich nicht. Ich habe bis jetzt keinen Anhaltspunkt – außer einem zerknüllten Zettel, den wir in seiner Hosentasche gefunden haben.»
Er holte umständlich seine Brieftasche heraus.
Ich konnte dabei den Schultergurt sehen, den er trug. Immer frage ich mich, wer diese Art, Pistolen zu tragen, erfunden hat. Ich brauch ja zum Glück keine mehr rumzuschleppen, aber ob ich mir so eine Halfter ums Hemd schnüren würde, muß ich bezweifeln.
Wust gab mir den Wisch. Er sah mich dabei genau an – ob ich mich irgendwie auffällig betragen würde.
Wenn man sich seiner selbst noch so sicher ist – solch eine prüfende Beobachtung macht einen doch ganz hippelig.
‹Benimm dich völlig ungezwungen!› sagte ich zu mir selbst – und das Ergebnis war, daß ich so verkrampft und so nervös war wie nie. Die Buchstaben tanzten mir vor den Augen. Das Papier – gelblich mit grauen Linien – flatterte in meiner Hand wie ein Männerhemd auf der Wäscheleine. Na ja, eine Stunde Schlaf nach achtzehn Stunden Wachsein und der Schnaps und dieses Mißtrauen rundum, kein Wunder, daß der Zettel flatterte.
Ich riß mich zusammen. In Druckbuchstaben stand da: «ZUM LETZTEN MALE, POHL! BREMSEN SIE IHRE NEUGIER!» Blaue Buchstaben mit breiter Füllfeder gemalt.
«Auf was kann Pohl neugierig gewesen sein, Herr Ziball?» fragte der Beamte und sah sich suchend nach einem Aschenbecher um. «Sie kannten Pohl doch gut. Überlegen Sie mal! Oder erzählen Sie mir, was Sie von dem Jungen wissen, ja?»
Frau Bornschein war aufgestanden und hatte einen Aschenbecher geholt. Eins jener scheußlichen Andenkenstücke, von denen sie bestimmt fünf Dutzend besaß. ‹Gruß vom deutschen Rhein› war darauf gemalt und irgendein Felsen – Loreley, Königsstuhl – was weiß ich.
«Ich hab vorhin in Ihrem Büro schon mal ein gutes halbes Stündchen von Hannes Pohl erzählt, Herr Kommissar … glauben Sie, daß mir seitdem was Neues eingefallen ist?»
«Gehen Sie schlafen», knurrte er und wandte sich an Frau Bornschein, die ihn anguckte, wie Meerschweinchen Schlangen angucken. Ich hatte keine Lust, mir die Fütterung anzuschauen, es war auch nichts dabei zu tun für mich – am Ende hätte es noch nach Zeugenbeeinflussung ausgesehen.
Aber ich konnte mir nicht verkneifen «Lassen Sie sich nicht ins Bein beißen!» zu Frau Bornschein zu sagen.
«Raus!» brüllte Wust. Für einen Moment hatte ich Lust, böse zu werden – denn ich bin gegen bestimmte Töne allergisch wie andere Leute gegen Katzenhaar oder Zimmerlinden.
Doch das hätte nur wieder Ärger gegeben, und meine Portion für die letzten vier Stunden war völlig ausreichend. Also schlüpfte ich ins Bett, das in der Fußgegend zum Glück noch ein wenig Wärme aufgespeichert hielt, und plumpste in den Schlaf wie ein Stein ins Wasser.
Für 11.00 Uhr am nächsten Vormittag waren die ersten Stellproben zu «Minna von Barnhelm» angesetzt. Waltraud Bury sollte die Minna spielen, Hannes den Tellheim, Gisela Eggers die Franziska. Daraus wurde natürlich nichts, denn es war niemandem nach Probe zumute, schon gar nicht nach Lustspielprobe.
Dafür wurden wir acht, die gestern abend in Eckelsum gewesen waren, ins Zimmer des Dramaturgen geholt – nein, nur wir sieben, denn der achte, Hannes, kam für Vernehmungen nicht mehr in Frage.
Ich war heilfroh, daß ich meine Entwürfe und die Bauzeichnungen für das Bühnenbild fertig hatte, so konnten die Tischler wenigstens anfangen zu bauen.
Der Intendant kam gegen zwei. Er war schrecklich aufgeregt, denn sie hatten ihn in B. im Hotel angerufen, frühmorgens. Er hatte seine Termine abgesagt und war in fünf Stunden die 500 Kilometer gefahren. Eine beachtliche Leistung. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Im Dramaturgenzimmer hockten wir sieben, unter der Aufsicht zweier Polizisten, beisammen, rauchten und schwiegen meistens. Wir hatten strenge Anweisung, mit niemand im Haus Kontakt aufzunehmen. Der Intendant, der bei seiner Ankunft einfach hereingekommen war und uns mit den irrsinnigsten Fragen überfallen hatte, wurde von einem Polizisten höflich, aber bestimmt hinauskomplimentiert.
Halb drei brachte uns die Kellnerin vom Gasthof «Deutsches Haus» ein Tablett mit Essen – Gulasch, Kartoffeln, Blumenkohl.
«Wissen Sie schon, wer’s war?» flüsterte sie mir zu.
Ich schüttelte den Kopf, der eine Beamte fuhr auch bereits dazwischen. Das arme Mädchen war völlig verschüchtert, als sie schließlich unsere schweigsame, bedrückte Runde mit dem Geschirr wieder verließ. Außer Ferdinand Hoch und Ludwig Hallbaum hatte niemand mehr als ein paar Löffel gegessen.
Die Polizisten wurden abgelöst. Der Ringelreihen ging weiter. Wir wurden einzeln aufgerufen und im Schreibzimmer nebenan vernommen. Manche blieben länger drin, manche kürzer. Gisela kam erst nach einer Dreiviertelstunde wieder heraus, Ludwig schon nach zehn Minuten – dafür wurde er später noch mal geholt.
Ich kam auch zweimal dran, gleich als dritter für zwanzig Minuten und ganz zum Schluß, als es schon auf halb fünf ging und wir nicht wußten, was mit der Abendvorstellung werden sollte. So gegen fünf mußten wir starten, wenn wir um acht in Südhausen den Vorhang zum «Spiel im Schloß» aufziehen wollten. Hannes hatte da nur eine kleine Rolle. Da konnte schon irgendwer einspringen – notfalls ich. Das hatte ich schon öfter mal gemußt – und ich machte es gerne.
Als sie mich das zweite Mal hereinholten, sah der Staatsanwalt, der selbst die Ermittlungen leitete, so elend aus, daß ich ihm allein auf sein Gesicht hin drei Monate Sanatorium verordnet hätte, wenn ich sein Arzt gewesen wäre. Er war ein schmaler Mann mit tiefen Magenfalten im Gesicht, mit kühlen, aber sympathischen Augen und mit einer ganz leisen Stimme – so leise, daß man sich wahnsinnig auf ihn konzentrieren mußte, wenn man ihn verstehen wollte. Das war seine Masche; eine gute Masche, fand ich.
Nachdem ich Platz genommen und mir die angebotene Zigarette angezündet hatte – die fünfundzwanzigste an diesem Tag, der noch nicht zu Ende war sagte er: «Mich hat beim Durchblättern der Protokolle und Papiere etwas überrascht, Herr Ziball … warum helfen Sie uns nicht?»
Ich sah ihn an: «Wieso?»
«Sie sind ja viereinhalb Jahre vor dem Krieg schon Kriminalbeamter gewesen, Sie haben also in unserer Branche schon Staub gewischt, als ich noch auf der Schulbank saß – gerade Sie müßten doch Verständnis dafür haben, daß jede vollständige Aussage wertvoll ist, nicht wahr!»
Ich war ziemlich perplex, Kommissar Wust, der links am Tisch neben den Stenographen saß, offenbar auch.
«Das hab ich nicht gewußt», murmelte er.
«Hannes Pohl war Ihr Freund, wenn ich recht unterrichtet bin», fuhr der Staatsanwalt fort, «also müßten Sie mehr als alle anderen von ihm erzählen können.»
«Warum ist er nicht mehr bei der Kripo?» fragte Wust.
«Das gehört nicht hierher – außerdem sind es Gründe, die ich verstehen kann», sagte der Staatsanwalt und ich merkte, daß er sich in diesem Augenblick auch wünschte, einen anderen Beruf zu haben. «Aber ein bißchen helfen könnten Sie uns immerhin, finde ich.»
Er hatte von seinem Standpunkt aus völlig recht. Keiner hatte Hannes so gut gekannt wie ich. Keiner hatte ihn wohl auch so gern gemocht wie ich – von den Mädchen und Frauen abgesehen, die reihenweise in ihn verknallt waren.
Aber ich sah nicht ein, warum eine Schilderung seines Charakters – seines ziemlich labilen Charakters übrigens – der Klärung des Verbrechens nützen sollte.
Ich hatte Hannes gekannt und gemocht, jawohl – aber das verpflichtete mich eigentlich erst recht, so dachte ich, über die Dinge zu schweigen, die sein Andenken vielleicht belastet hätten.
Außerdem wußte ich vieles von dem Jungen, was er mir – oft beschwipst oder in einer seiner depressiven Launen – quasi als Beichtgeheimnis anvertraut hatte. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich aber noch nicht, daß ich manches nicht wußte …
Sie hatten demnach nichts erreicht in den sechs Stunden, die sie hier saßen.
«Nun …?» fragte er.
«Ich habe alles gesagt.»
«Das ist eine verzwickte Sache – weil ich vor allem nirgends ein Motiv sehe», sagte der Staatsanwalt so leise, daß ich nicht wagte, meine Zigarette auszudrücken, um keins seiner Worte zu verpassen. «Da wird ein junger, begabter Schauspieler erdrosselt – und wohin man blickt, hat er keinen Feind. Außer dem mysteriösen Zettelschreiber … Er hatte das Zeug, große Karriere zu machen, soweit ich das nach den drei, vier Rollen, in denen ich ihn gesehen habe, beurteilen kann. Habe ich nicht recht?»
Ich nickte. Hannes war ein begabter Kerl, er arbeitete verbissen und besaß darüber hinaus jene Ausstrahlung, die immer über die Rampe kommt – ganz gleich, ob er in einem Schwank albern sein mußte oder in einem Stück mit Tiefgang ernst zu sein hatte. Er war zum Beispiel ein großartiger Garcin in «Geschlossene Gesellschaft» – so überzeugend selbstquälerisch und so faszinierend hoffnungslos. Diese Rolle hatte seinem eigentlichen Charakter entsprochen, als wäre sie ihm auf den Leib geschrieben. Wir würden nicht leicht einen gleichwertigen Ersatz finden.
«Es tut mir sehr leid», sagte ich, «aber für mich ist die Sache ebenso dunkel wie für Sie.»
«Wenn Ihnen irgendwas einfällt – eine Bemerkung Pohls, eine Andeutung, ein besonderes Verhalten in letzter Zeit, irgendwas, das uns weiterhelfen könnte, dann rufen Sie mich bitte an, egal zu welcher Stunde.»
Wir fuhren kurz nach fünf mit dem großen Bus. Den kleinen hatte die Kripo zur Sicherung eventueller Spuren noch beschlagnahmt.
Ich mußte tatsächlich die kleine Rolle von Hannes übernehmen. Während der Busfahrt nach Südhausen versuchte ich, die paar Sätze, die ich zu sagen hatte, zu lernen.
Das war gar nicht so leicht. Denn der Mord an Hannes Pohl hatte die Gemüter seiner lieben Kollegen erhitzt, und nun platzten sie alle gleichzeitig mit den verrücktesten Mutmaßungen heraus, wer ihn umgebracht haben könnte und warum. Dabei sollte nun einer lernen. Als Waltraud Bury anfing, ihre Aufregung mit zweideutigen Witzen abzureagieren, gab ich es auf. Ich sah zu ihr hinüber und fing dabei einen Blick von ihr auf, der zu ihrem losen Gerede paßte wie Senf auf Sahneschnitten. Kein Zweifel, was ich in ihren dunklen, langbewimperten Augen entdeckte, war Angst. Na, sollte sie Angst haben. Wir alle fühlten uns ja nicht gerade wohl in unserer Haut
Unser Senior war es schließlich, der das Thema wechselte. Er schien von uns allen das dickste Fell zu haben. Oder er hatte die größte Selbstdisziplin. Oder er war eben doch der beste Komödiant in diesem Verein. Der Senior war ein Mann über siebzig. An seinem wallenden weißen Haar und seinem raumgreifenden Gehabe war er schon hundert Meter gegen den Wind als Künstler zu erkennen. Er war der Schrecken aller modernen Regisseure, die bei uns gastierten. Denn mit seinen großen Gesten und seinem rollenden R aus der alten Meininger Theaterschule machte er jedes moderne Stück – und vor allem die tragischen – zu einem Heiterkeitserfolg.
Der Senior sprach über irgendein Fernsehspiel und löste mit seinem Urteil eine aufgeregte Diskussion aus. Niemand sprach mehr von Hannes Pohl und seinem gewaltsamen Ende.
Der Bus fuhr durch das flache Land, durch Dörfer, in denen das Leben weiterging, durch Weiden, Wiesen, Felder und Wälder – Kühe glotzten uns nach, ein Reh stand unbeweglich am Waldrand. Aus den Schornsteinen der flachen Bauernhäuser stieg der Rauch kerzengrade zum Himmel. Es würde schönes Wetter geben.
Ich hatte in Südhausen alle Hände voll zu tun. Während sich die Schauspieler im Clubzimmer des Hotels, in dessen Saal wir spielten, für den Abend einrichteten, aßen, tranken, lasen oder Karten spielten, half ich mit, die Dekoration aufzubauen. Das klappte nicht sofort. Es klappt nie sofort.
Mal ist die Bühne zehn Meter breit und vier tief, mal neun Meter und sechs, mal nur sechs Meter und dreieinhalb. Wir haben ‹Ziehharmonika›-Bühnenbilder – die man strecken und quetschen kann, ohne daß sich ihre Grundaufteilung wesentlich ändert. Denn diese Tür wird für jenen Auftritt, jenes Fenster für dieses Spiel immer gebraucht – es geht also nicht, daß wir einfach eine Türwand weglassen, sonst kommen die Schauspieler, die ja nicht nur Worte, sondern auch Gänge, Schritte, Bewegungen einstudiert haben, völlig durcheinander. Sie kommen auch ohne diese technischen Schwierigkeiten manchmal durcheinander, weil wir ja auch vor großem Theater nicht zurückschrecken, obschon wir nur ein kleines Ensemble sind. Das heißt, daß einer oft zwei oder gar drei Rollen spielen muß. So ist es zum Beispiel passiert, daß Stoltze, der Spielleiter und Schauspieler zugleich ist, in der Eile vergessen hatte, sich umzuziehen, und bei einer «Hamlet»-Aufführung noch im Gewand des Totengräbers auftrat, um den König zu sprechen – was einige Verwirrung zur Folge hatte.
Hier in Südhausen ist die breiteste Bühne – aber sie mißt nur knapp vier Meter von der Rückwand bis zur Rampe. Das ist jedesmal eine furchtbare Fummelei, bis das Bild steht. Die Garderoben, zwei lange, schmale Räume zu beiden Seiten, sind lediglich durch eine Sperrholzwand von der Bühne getrennt. Es darf darin nur geflüstert werden, wenn das Stück läuft.
Vor meiner Zeit, so erzählt man, hat in der Herrengarderobe mal einer einen Witz erzählt und das anschließende Gelächter prasselte direkt in die große Sterbeszene des Prinzen von Homburg, die gerade auf der Bühne stattfand – das muß wenig Erfolg beim erschütterten Publikum gehabt haben.
Ich mühte mich also mit der ‹Technik› (so heißen bei uns die Bühnenarbeiter und Beleuchter) ab, die Dekoration zu «Spiel im Schloß» hinzukriegen – schließlich gelang es, aber in letzter Minute. Vor lauter Wühlerei hatte auch ich Hannes’ Tod vergessen.
Doch als ich jetzt in die Garderobe kam, um mich in das Kostüm zu schmeißen und schnell noch ein paar Striche Schminke ins Gesicht zu ziehen, da sprang mich die ganze Geschichte wie ein eisiger Nordostwind an: da – der großkarierte Anzug, den Hannes noch vor drei Tagen getragen hatte; da – auf dem Schminktisch der Programmzettel, auf dem noch sein Name stand.
Ich war also der Tote für die kommenden zwei Stunden. Das war so unheimlich, daß sogar die Kollegen, die eben noch lachend Maske gemacht hatten, betreten schwiegen, als ich mich umzog. Frau Fischlein, die Garderobiere, steckte mir die Weste etwas enger, und ich merkte, wie ihre Hände dabei zitterten. Die Klingel schepperte draußen los. Man konnte fern die summenden Stimmen des Publikums hören. Wir hatten ausgemacht, daß die Umbesetzung der kleinen Rolle nicht extra bekanntgegeben werden sollte. Für viele Leute in Südhausen trat ich also als Hannes Pohl auf, denn in den Zeitungen hatte heute auch noch nichts gestanden.
Nun, ich versuchte die Beklemmung abzuschütteln, memorierte schnell noch mal meine Sätze und ließ mir von Ferdinand Hoch über die Schulter spucken – toitoitoi. Ich stand in der Kulisse und wartete auf mein Stichwort.
Gisela Eggers, die von der Bühne kam, mußte an mir vorbei. Sie sah mich, vom Scheinwerferlicht noch geblendet, erst, als sie drei Schritte vor mir stand.
«Um Gottes willen!» flüsterte sie, schloß die Augen und schwankte … ich konnte sie gerade noch auffangen. Bärner kam, der Inspizient. Er wollte eine dreckige Bemerkung machen, als er mich mit Gisela im Arm da stehen sah – ich merkte es an seinem Gesichtsausdruck. Aber dann kapierte er, daß sie halb ohnmächtig war.
«Dein Auftritt!» zischte er und nahm sie mir ab.
Ich ging raus und haspelte recht und schlecht meinen Auftritt ab. Ferdinand Hoch half mir, als ich steckenzubleiben drohte.
In der zweiten Reihe sah ich Kriminalkommissar Wust sitzen. Das war ja nicht besonders erstaunlich. Klar, daß sie uns beschatteten. Als ich wieder draußen war, griff ich mechanisch in die Jackentasche, um eine Zigarette zu angeln – aber da waren natürlich keine Zigaretten. Dafür kriegte ich mit den Fingerspitzen ein Stück Papier zu fassen. Ich zog es heraus. Es war gelblich mit grauen Linien.
VORSICHT POHL, LASSEN SIE DIE SCHNÜFFELEI –
ICH WERDE SONST SEHR UNANGENEHM!
Auf der Rückseite war mit Bleistift eine Zahl – offenbar eine Telefonnummer – hingekritzelt: 130527. Das mußte eine Rufnummer in Olders sein, denn bei uns gab es keine sechsstelligen Nummern.
Ich war allein in der Herrengarderobe, als ich das Papier fand und entzifferte. Ich bin kein Held. Die Zigarette, die ich mir anzündete, zitterte in meiner Hand wie ein Lämmerschwänzchen.
Ich war so erleichtert wie selten, als ich nach der Vorstellung aus Hannes Pohls Kostüm raus konnte und wieder in meine eigenen Sachen schlüpfte.
«Tut mir leid, daß ich dich vorhin erschreckt habe!» sagte ich zu Gisela, die schon im Clubzimmer saß, als ich hinunterkam, um endlich was zu essen. Beim Abbau und bei der Verladung der Dekoration mußte ich nicht dabei sein.
«Schon gut, Jost», sagte sie, «ich war bloß nicht darauf gefaßt gewesen!»
Ich setzte mich zu ihr, bestellte ein Beefsteak Tatar mit viel Zwiebeln und ein großes Bier.
«Was möchtest du?» fragte ich Gisela.
«Einen harten Schnaps!» sagte sie, und ich bestellte ihr einen. Es war, weiß Gott, eine irre Geschichte, und ich war wütend, daß ich ebenso rat- und ausweglos war wie die Polizei. Sie hatten recht, wenn sie von mir mehr erwarteten als eine knappe Schilderung von Hannes. Doch ich wußte wirklich nichts, woraus sie auf den Mörder hätten schließen können. Und auch das machte mich wütend.
Da hatte ich monatelang mit dem jungen, netten Burschen Wand an Wand gewohnt, hatte mit ihm viele Flaschen geleert, und wir mochten uns so gut leiden, daß wir uns sogar die Körbe beichteten, die wir hie und da gekriegt hatten – ich öfter als er, schon weil er zehn Jahre jünger war und aussah wie eine Mischung aus Ben Hur und James Dean selig.
Aber ich hatte nicht gemerkt, daß er von irgendwem unter Druck gesetzt wurde in letzter Zeit. Schön, er war ein bissel ruhiger als sonst – aber er hatte auch viel um die Ohren: Montag Sartre, Dienstag Klamottenklamauk von Arnold und Bach, Mittwoch den Max Piccolomini, Donnerstag wieder Sartre – und nebenbei lernte er schon den Teilheim und fuhr auch noch nach Olders, wo sie im Sender auf ihn aufmerksam geworden waren und ihn für Hörspiele oder Kommentare einsetzten … halt! Fast hätte ich mein Bier umgeschmissen.
Hier mußte des Rätsels Lösung sein. Gut, ich würde nachsehen!
Mein Beefsteak kam und sah herrlich aus. Das Bierglas gab ich dem Kellner zum Nachfüllen mit. Gisela hob den Zeigefinger- und Mittelfinger ihrer linken Hand und tippte mit der rechten auf ihr Schnapsglas. Der Kellner nickte und brachte gleich darauf noch zwei Schnäpse und ein neues Bier für mich.
Ich matschte mein Tatar durcheinander, drückte Eigelb, Zwiebel, Pfeffer, Salz und einen Spritzer Ketchup in den rotbraunen Fleischkloß und schluckte heftig, denn mir lief das Wasser im Munde zusammen.
«Prost!» sagte Gisela, die sich am Stummel ihrer vorigen Zigarette gleich eine neue angezündet hatte und schob mir das schmale, hohe Schnapsglas zu, das außen beschlagen war.
«Prost!» sagte ich und kippte das herrliche Zeug, das eiskalt war und das einem doch sofort die Kehle und den Magen wärmte, wenn man’s hinunter hatte. Ich goß ein bißchen Bier nach und fing an, das grobe graue Brot mit Butter zu bestreichen und mit Fleisch zu beladen.
Ich weiß nicht, warum ich überhaupt nicht überrascht war, als das Mädchen zu reden anfing.
Sie ist sehr reizend, nicht hübsch, sondern eher apart – wie eine Tochter der ollen Nofretete –, aber dazu ein Schuß Mongolei, und das Ganze verrückterweise von einem blonden Haarkringel eingerahmt, so daß einem, je länger man hinsieht, ganz anders wird – so nach Weihnachtsmärchen, Feenkönigin und ‹alle guten Geister steht mir bei›. Auch ihre dusselige Anzieherei – sie trägt immer steingraue oder schwarze Pullis, die Max Schmeling zu groß wären, und graue Jeans, die sich in Korkenzieherkurven bis auf die pottflachen Schuhe ringeln – auch diese Anzieherei kann die Wirkung ihres Kopfes und ihrer Satansbraten-Augen nicht schmälern. Sie hat einen Blick, bei dem die Männer vergessen, sich nach ihren Beinen umzusehen. Dabei lohnte sich das – was ich von ihren Bühnenauftritten her weiß –, denn unter der Straßenjungen-Tarnung ist alles durchaus am richtigen Platze.
Ich mag sie sehr gern und habe oft und nicht immer ganz brav an sie gedacht. Aber das sind so Ideen … Sie ist wie eingekapselt in eine umwerfende, abkühlende Selbstsicherheit – ich könnte mir zwar vorstellen, wie sie verliebt sein würde, aber Anhaltspunkte gibt’s nicht für solche Vorstellungen. Waltraud Bury hat gesagt, da hätte der liebe Gott jemand alle Zutaten für einen guten Kuchen gegeben, aber das Backrezept und den Ofen vergessen.
Jetzt, da wir an einem kleinen Ecktisch im Clubzimmer des Gasthofes von Südhausen saßen, Gisela und ich, und beide müde waren, abgespannt nach dem Schreck von gestern und dem Warten, Herumsitzen, Verhörtwerden von heute und erledigt nach der Aufführung eben – jetzt hätte ich sie gerne in die Arme genommen und irgendwas Tröstliches zu ihr gesagt, aber auch gerne was Tröstliches von ihr gehört.
Sie saß neben mir, rauchte und guckte auf meinen blutig-schmierigen Tatar-Teller. Ich schob ihr mit der Gabel einen Bissen in den Mund. Sie schloß abwehrend die Augen, aber dann kaute sie doch und warf mir dabei einen schrägen Blick zu, der ‹lieber großer Bruder› heißen konnte.
Eigentlich hatte ich keinen Appetit auf ‹großer Bruder› – aber besser als gar nichts.
Und plötzlich fing sie an zu reden, leise, mit großen Pausen, ohne auf Antwort zu warten.
«Ich habe es nicht gesagt. Er ist meinetwegen hierhergekommen. Hast du das gewußt? Wir haben vor zwei Jahren bei den ‹Leuchtturmwärtern› zusammen getingelt, und im letzten Winter hat er sich dann hier beworben. Er hätte sicher was Besseres kriegen können. Und er war schrecklich enttäuscht, daß ich nichts mit ihm haben wollte, als er hier anfing. Ich fand ihn sehr nett – aber nicht so. Du weißt selber gut, wie er war. Du kannst sicher verstehen, daß er zu … zu weich oder zu wankelmütig war oder selbst zuwenig Halt hatte, um jemandem wie mir Mut zu machen, sich bei ihm anzuhalten. Er hat mir keine Szene gemacht und auch keine Vorwürfe – aber es ist zwischen uns aus gewesen, ehe es anfing. Nun mach ich mir Gedanken – denn er würde noch leben, wenn er nicht hergekommen wäre – meinetwegen. Er würde sicher noch leben. Hat er dir was gesagt, Jost? Ihr seid doch dauernd zusammen gewesen. Hat Hannes mich gehaßt? Ich hab so ein entsetzliches Schuldgefühl …» Sie schwieg und stützte den Kopf in die Hände, braune, schlanke Hände ohne Nagellack, wie die Hände eines Jungen.
Ich war so verdutzt, daß ich gar nicht wußte, was ich sagen sollte. Immer hatte ich mir eingebildet, Hannes Pohl gut zu kennen – aber ich hatte keine Ahnung von seiner Neigung zu Gisela Eggers gehabt, keinen blassen Schimmer.
Jetzt fiel mir allerdings ein, daß von ihr zwischen uns nie die Rede gewesen war, wir hatten bestimmt das ganze Ensemble durchgehechelt bei unseren Flaschensitzungen – aber niemals über sie gesprochen. Doch – einmal: Ich hatte, schon ziemlich beschwipst, mit Hannes das ‹Einsame-Insel-Fragespiel› gespielt. Es galt, innerhalb fünf Minuten die fünf Bücher, die fünf Schallplatten und die zwei Menschen aufzuzählen, die man aussuchen und mitnehmen möchte, wenn man für fünf Jahre auf eine einsame Insel fahren würde. Mir stand die Szene auf einmal deutlich vor Augen. Bei den Büchern und Platten waren wir uns schnell einig geworden. Als es um die zwei Menschen ging, hatte ich gesagt, daß ich eine rüstige Endvierzigerin mitnehmen wolle, die gut kochen könne und über eine perfekte Sanitätsausbildung inklusive Zahnmedizin verfügen müsse und dazu – vielleicht – Gisela Eggers. Hannes Pohl hatte nicht gelacht, sondern sein eben erhobenes Glas abgestellt und mich ein paar lange Sekunden angeschaut.
«Gisela –? Du auch? Sieh mal einer an –!» hatte er gesagt.
«Wieso ich auch?» wollte ich wissen.
«Nun, da verlieren doch sicher viele den Kopf …» meinte er nachdenklich. «Kein Wunder, so eine Melusine!»
Das war es gewesen, und jetzt fiel es mir ein. Melusine … Ich hatte nachschlagen müssen, was eigentlich mit Melusine gemeint war, aber ich hatte nicht viel mehr in meinem kleinen Lexikon gefunden, als daß sie eine Meerfee war. Ich hatte auch nicht weitergesucht und die Sache vergessen.
Aber jetzt meinte ich, Hannes sagen zu hören «… Du auch?» – und ich sah sein Gesicht vor mir: Sehr ernst, ein wenig unsichere Augen vom Weinbrand und die zusammengezogenen Augenbrauen.
«Du sagst ja gar nichts!» sagte Gisela zwischen ihren Händen hervor, ohne den Blick zu heben.
Ich gab mir einen Ruck. «Das ist natürlich Quatsch, wenn du dir Vorwürfe machst», stotterte ich.
Der Kellner kam und räumte meinen Teller ab, ich gab ihm durch Fingerheben noch mal eine Bestellung für zwei Harte auf, die er umgehend brachte. Dann zündete ich zwei Zigaretten an, schob Gisela das Schnapsglas zwischen die aufgestützten Arme und legte die brennende Zigarette quer darüber. Sie strich sich den Haarvorhang aus der Stirn, sagte «Danke, Jost!» und nahm die Zigarette.
Wir tranken, und ich sah an ihrer Kehle eine zartblaue Aderlinie, die mich seltsam rührte. ‹Behalt den Kopf oben, alter Esel›, schimpfte ich mit mir selber, ‹es gibt im Augenblick einiges zu tun, wozu du einen klaren Gehirnkasten brauchst …›
Frau Bornschein hatte von innen die Kette vor die Tür gelegt und guckte durch den Spion, ehe sie mir öffnete.
«Tschuldigen Sie nur, Herr Ziball», sagte sie, «ich glaube, Sie verstehen, daß ich umkomme vor Angst! Ich habe schon daran gedacht, zu meiner Schwester Klara in den Harz zu fahren, Sie wissen doch, die Postinspektorswitwe, die da mit ihrer Tochter zusammenwohnt. So allein den ganzen Tag, keine Menschenseele im Haus außer dem tauben und halbgelähmten alten Herrn Fehsefeld im Erdgeschoß. Der kann mir doch nicht helfen, wenn hier jemand eindringt – oh, Herr Ziball, wie konnte das nur geschehen? Und der arme, arme Herr Pohl, so ein hübscher Junge, wie haben Sie ihn denn gefunden?»
An dieser Stelle mußte sie endlich Luft holen, so daß ich auch was sagen konnte. Sie tat mir sehr leid, und ich hatte auch einen Haufen Schuldgefühl ihr gegenüber. Deshalb konnte ich ihre Einladung, bei ihr einen Tee zu trinken und ein Butterbrot zu essen, nicht abschlagen.
Es war kurz nach halb zwölf gewesen, als ich kam. Um zwei saß ich da immer noch im Lichtkreis der mit Schmetterlingen bestickten Hängelampe, erzählte ihr von den Vernehmungen heute, rätselte mit ihr zusammen herum, wer wohl – und warum wer wohl – und wie wer wohl Hannes gehaßt und erdrosselt hatte.
Frau Bornschein ging auf meine Versuche, das Thema zu wechseln, nicht ein. Sie war hartnäckig wie eine Fliege, die sich einem immer wieder ins Gesicht setzt, wenn man einschlafen will. Allmählich geriet ich in einen Zustand leichter Blödigkeit.
Ich begann Gespenster zu sehen. Die Porzellanhunde hatten plötzlich die Gesichter von Kommissar Wust, vom Staatsanwalt und immer wieder von Hannes Pohl. Sie nickten und blinzelten mir zu, wenn ich hinsah. Und ich konnte gar nicht anders als hinsehen, denn in jeder Ecke des Zimmers, auf jeder Konsole, auf jedem Tischchen, in jeder Vitrine saßen wenigstens zwei von den dämlichen Viechern.
Das Gespräch lief immerzu im Kreise herum, wie eine Maus, die in einen Eimer gefallen ist. Ich war so müde, daß ich zu müde war, meine Müdigkeit zu verbergen. Schließlich, als mir der Kopf zum zweiten Male nach vorn kippte, merkte es auch die gute Frau Bornschein und entließ mich aus dem Kreis ihrer mütterlichen Fürsorge und weiblichen Angst.
Ich tappte den Gang entlang in meine Bude, nahm mir nicht mal Zeit, die Hosen auf den Spanner zu hängen, sondern schmiß meine Sachen auf einen Stuhl und rollte mich ins Bett. Ein Wunder, daß ich noch in der Lage war, die Augen zuzumachen.
Wir teilten uns die Benutzung des Stadttheaters mit zwei anderen Unternehmen. Das eine war eine sogenannte ‹Heimatbühne›, eine Truppe von sechs Schauspielern und Schauspielerinnen, die zusammen mit Laien plattdeutsche Stücke, meist Lustspiele und Schwänke spielte – oft sehr hübsch und wirklich komisch, soweit ich verstand, was da gesprochen wurde. Das andere war eine ‹Konzertdirektion›, die Varietégruppen, Konzerte kleiner Orchester, Kammermusikabende, Kabaretts, Vorträge (zum Beispiel ‹Über die Einflüsse des Buddhismus auf die westliche Literatur› oder ähnlichen Quark) und Rezitationsabende managte.
Jeder von uns – wir, die ‹Landesbühne›, die ‹Heimatbühne› und die ‹Konzertdirektion› – hatte die Räume des Stadttheatergebäudes zeitlich etwa zu einem Drittel in Gebrauch. Wir spielten meist sonntags und dienstags, hie und da auch noch am Montag auf der schönen großen Bühne, die ‹Heimatbühne› hatte jeden Freitag mit Beschlag belegt und benutzte die Donnerstage, die ihr zustanden, oft nur zu Proben auf der Bühne. Die ‹Konzertdirektion› veranstaltete regelmäßig mittwochs einen ihrer ‹kleinen Abende› – also so was wie den erwähnten Vortrag (und da saßen auch höchstens dreißig, vierzig Menschen vor dem Podium) – und sonnabends zog sie dort ihre ‹Großen Abende› ab, die – wenn zum Beispiel ein Fernsehfritze kam und die beliebte Unterhosenkomik bot – stets knüppelvoll waren.
Gelegentlich gab es kleine Reibereien zwischen den drei Benutzern des Stadttheaters, dabei ging es meist um Termine oder um Geld für Strom, Reinigung – was weiß ich.
Im allgemeinen aber lief dieses Nebeneinander recht reibungslos und glatt. Wir vom Ensemble der Landesbühne (das heißt, die Schauspieler vor allem) versuchten, uns gut mit Herrn Zander, dem Chef und Inhaber der Konzertdirektion, zu stellen, denn der bot uns diese und jene Möglichkeit, zusätzlich ein paar Mark zu verdienen. Er organisierte Lesungen in den Schulen des Landkreises, er vermittelte ‹Wilhelm-Busch-› oder ‹Rainer-Maria-Rilke-Abende› bei allen möglichen Organisationen, er hatte Verbindungen zu Kegelclubs, Kleingärtnervereinen, Großbetrieben und allen Parteien von links nach rechts – bei denen zu Vereinsfeiern, ‹Bunten Abenden› oder sonstigen Versammlungen Ansager, Komiker, Alleinunterhalter oder Dichterinterpreten gebraucht wurden. Auch ich vermied Ärger mit Zander.