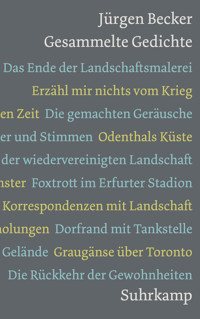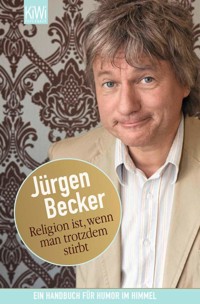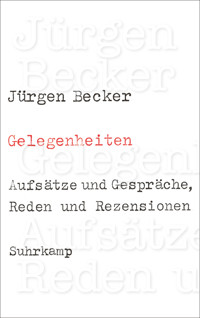
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit langem sind die erzählerischen und lyrischen Wortmeldungen Jürgen Beckers im Bewusstsein der literarischen Öffentlichkeit fest verankert. Aus mehr als fünf Jahrzehnten stammt ein eigensinniges und polyphones Werk, das immer auch im historischen Kontext und in seiner Korrespondenz mit den Nachbarkünsten gesehen werden will: Malerei, Musik, Fotografie sind Elemente, die sich direkt in das poetische Werk des Autors eingeschrieben haben. Parallel dazu hat sich Jürgen Becker immer auch in reflexiver Form mit poetologischen Fragestellungen und zeitgenössischen Positionen in den verschiedenen Künsten auseinandergesetzt. Erhellend sind seine Rezensionen amerikanischer Literatur, insbesondere der Lyrik, die seine eigene Schreibweise beeinflusst hat. Daneben stehen Beckers Positionen in der Beschäftigung mit Büchern u. a. von Uwe Johnson, Peter Handke, Peter Weiss und Günter Grass.
Gabriele Ewenz' Edition macht diese wichtigen und erhellenden Texte erneut zugänglich. Sie werden flankiert von Gesprächen und Reden, in denen sich Becker dezidiert über biographische Aspekte sowie gattungsspezifische Fragestellungen im Kontext seines Werkes äußert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jürgen Becker
Gelegenheiten
Aufsätze und Gespräche, Reden und Rezensionen
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Gabriele Ewenz
Suhrkamp
Inhalt
Rezensionen und Aufsätze
Die Revolte der Widersprüche
Heimatlose Poesie. Zu den Dichtungen Yvan Golls
Mutmassungen über Jakob. Über den gleichnamigen Roman von Uwe Johnson
Fa:m’ Ahniesgwow. Über das gleichnamige Buch von Hans G Helms
Revolution aus Überlieferung
Das Riesen-Phantasus-Nonplusultra-Poem. Die ersten drei Bände der neuen Arno-Holz-Ausgabe
Nicht Reim und Metrik, doch Rhythmus
Sein Platz ist in der Gegenwart
Gegen die Erhaltung des literarischen status quo (1964)
Einführung zum Hörspiel Glückliche Tage von Samuel Beckett
Einführung zu Happenings. Fluxus Pop Art Nouveau Réalisme. Eine Dokumentation
Modell eines möglichen Politikers
Nachwort zu Der Kopf des Vitus Bering von Konrad Bayer
Peter Handkes erster Roman Die Hornissen
Dadamax
Eine Art zu leben. Über Werner Schmalenbach: Kurt Schwitters
Rekonstruktionen I-IV. IV Ludwig Harig: Ein Blumenstück
Schreckliche Märchenstunde. Über Donald Barthelme: Schneewittchen
Daß alles ein Dreck ist. Oswald Wieners monströse Verbesserung von Mitteleuropa
Ansichten der Einsamkeit. Die Rheinlandschaften des Photographen August Sander
Die vergehende Zeit für einen Moment zum Stillstand bringen. Das Gedicht als Tagebuch
Was habe ich geträumt?
Leben in Sprache verwandeln
Entdecker des Unvertrauten. Der Fotograf Eugène Atget
An den Rändern der Existenz. Ilse Aichingers Prosa Schlechte Wörter
Eher Visionen als Reportagen. Wieland Schmieds Monographie über Werner Heldt
Maler der Stunde Null
Gesamtbild kollektiver Verstörung
Fügungen, verfügt über uns. Gedanken zu Beckett-Inszenierungen in Düsseldorf und Frankfurt
So reden und handeln – jetzt und in fünfundzwanzig Jahren
Bei Löscher: Marionetten im Anonymen
Bei Roggisch: Gelände als Front
Entkommen übers Nichts hinaus
Rainer Maria Rilke. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
Mythos der Nacht. Noch zu entdecken: die größte amerikanische Dichterin unserer Zeit. Djuna Barnes
Inzucht des Schmerzes
Zeitungsgeschichten als Literatur
Anregung für die Phantasie
Dokumente einer Epoche. Photographien von Gisèle Freund
Stille Liebe. Dokumente der Erinnerung: Die Photographien von Walker Evans
Die Warteschleifen der Erinnerung. Gerhard Richter im Albertinum Dresden
Vergehende Zeit, bleibende Bilder
Gespräche
Klaus Schöning. Gespräch mit Jürgen Becker
Ralf Siepmann. Akustik der neuen Wirklichkeit »Der Rundfunk braucht das Hörspiel« . Ein Gespräch mit Jürgen Becker
Wolfgang Heidenreich. Selbstauskunft . Ein Werkstattgespräch mit Jürgen Becker
Renatus Deckert. Gespräch mit Jürgen Becker
Reden
Kunst und Gesellschaft. Eine Rede anläßlich der Verleihung des Kölner Kunstpreises 1968
Rede zum Döblin-Preis 1979
Schreiben ist nicht selbstverständlich
Clique, Caféhaus, Mafia, Markt
»Rückkehr zur einfach menschlichen Anständigkeit«. Laudatio auf Hans Mayer zur Verleihung des Heinrich-Böll-Preises der Stadt Köln am 16. 12. 1980
»Ein wahrhaft beispielhaftes Doppelleben«. Laudatio auf Helmut Heißenbüttel zur Verleihung des Heinrich-Böll-Preises der Stadt Köln am 6. 11. 1984
Laudatio auf John Ashbery zur Verleihung des Horst-Bienek-Preises für Lyrik 1991
»Vom Dichten nebenbei«. Dankrede zum Peter-Huchel-Preis 1994
»Das Vergangene wieder vergegenwärtigen«. Dankesrede zum Uwe-Johnson-Preis des Jahres 2001
Poesie und Praxis. Jenaer Vorlesung
Schillers unverwischbare Spur. Dankesrede zur Verleihung des Schiller-Rings der Deutschen Schillerstiftung am 14. Mai 2009 in der Akademie der Künste in Berlin
Dankesrede zur Verleihung des Günter-Eich-Preises der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig 2013
Vom Mitschreiben der Wirklichkeit. Dankesrede. Gehalten bei der Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2014. Herbsttagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, 25. Oktober 2014
Gespräche
Reden
Nachweise
Bibliographie (Auswahl)
Nachwort
Personenregister
Rezensionen und Aufsätze
Die Revolte der Widersprüche
»Die einfachste surrealistische Tat besteht darin, mit Revolvern in der Hand auf die Straße zu gehen und solange wie möglich blind in die Menge zu schießen«, schrieb André Breton, Chef-Ideologe der surrealistischen Bewegung.
Der so auf die radikalste Formel gebrachten Revolutionsbereitschaft der Breton’schen Maximen blieb indessen diese Aktion erspart. Vielmehr entstanden Gebilde, surrealistische Gebilde, die die künstlerische Landschaft des 20. Jahrhunderts ausformen halfen. Die Ergebnisse sind inzwischen klassifiziert und verhalten sich durchaus konträr dem Breton’schen Satz: »Vor allem soll man vor der Anerkennung der Masse fliehen« – was den Surrealisten auch ohne Anstrengung gelang. Daß die surrealistische Kunst schließlich ins Museum wanderte, war einer der Widersprüche, der die Bewegung mit in Frage stellte. Aber die Geschichte des Surrealismus ist nicht zuletzt die Geschichte seiner Gefährdung durch seine Widersprüche.
Was ist überhaupt Surrealismus? Ihn heute zu definieren heißt eine Synthese bilden, eine Synthese aus dem Wandel seiner Definitionen, Regeln und Absichten. Sicher ist, daß der Surrealismus primär keinen Stil brach, keinen Stil schuf – wie vergleichsweise der Kubismus. Sicher ist ebenso, daß sich der Surrealismus keineswegs allein im künstlerischen Ausdruck verstanden wissen wollte. André Breton und Philippe Soupault übten sich zunächst im Schreiben automatischer Texte, außerdem entdeckten sie jene außerordentlichen Zustände, die die Vorzimmer des Wunderbaren sind, also Traum, Hypnose, Halluzination.
Somit siedelte der Surrealismus auf dem jenseitigen Ufer der Wirklichkeit. Hier zu leben bedeutete die Absolutierung der Alogik, des Phantastischen, bedeutete die Herrschaft des Fiebers, der Nacht. Indessen besaß die Bewegung Impulse, die ihr über die eigenen Grenzen hinüberhalfen oder Tunnel ins offizielle Leben zurückschlugen. Fraglich, ob die Reflexionen über existentielle und künstlerische Möglichkeiten nicht schon ihre Reinheit aufs Spiel setzten. Gewiss jedoch, daß die Offizialisierung ihr zu einer Wirkung verhalf, die durchaus ihren Intentionen entsprach.
Von 1924 ab hören wir die ersten Stellungnahmen der Surrealisten selbst. Breton schrieb im ersten surrealistischen Manifest: »Surrealismus ist reiner psychischer Automatismus, durch den man sich vornimmt, sei es mündlich, sei es schriftlich, sei es auf ganz andere Weise, das wirkliche Funktionieren der Gedanken auszudrücken.«
Louis Aragon verkündete: »Das Surrealismus genannte Laster ist die in Unordnung gebrachte und leidenschaftliche Anwendung des Rauschgiftes Bild.«
Mit Paul Eluard, dem Lyriker, fügte sich eine neue Komponente in das theoretische Gerüst ein, die soziale Komponente, der Anspruch auf gegenseitige Kommunikation. Er sagt: »Der Surrealismus arbeitet dahin, die Unterschiede, die zwischen den Menschen bestehen, geringer zu machen.«
Mit der Veröffentlichung ihrer Thesen stieß die Bewegung auf neue Problemstellungen. Es erwies sich, daß die isolierende Selbstbeschäftigung die Theoreme sterilisierte, die doch revolutionären Elan keineswegs vortäuschend die Reibung am Realen verlangten. Daß es der logischen Sprache bedurfte, um alogische Sachverhalte auszudrücken, war bereits konzediert – der nächste Schritt führte ins kulturelle Engagement. Weiterhin wurde eingestanden, daß der Surrealismus als Erkenntnismethode ein durchaus ästhetisches Interesse entwickle hinsichtlich einer surrealistischen Literatur und Malerei. Welche Folge diese Konzession hatte, zeigt sich heute, wenn bei der Erwähnung des Begriffs Surrealismus sich im Publikum vorzüglich Erinnerung an surrealistische Bildwerke einstellt. Daß die ausführliche Weise des surrealistischen Malens, das ja ein Malen des sachlichen, gleichviel irrealen Gegenstandes ist, den spontanen Akt des assoziierenden Träumens hintanstellt, hat selbst unter den Anhängern der Bewegung Verwirrung gestiftet. Indessen blieb es das Verdienst der Künstler, mittels ihrer Dokumente das surrealistische Phänomen überhaupt greifbar gemacht und über die Jahrzehnte in die Gegenwart geschleust zu haben. Selbst André Breton und Louis Aragon besannen sich auf die Verwandlungskraft der Poesie und verschmolzen ihre Vorstellungen in Rhythmus und Reim. Und Paul Eluard, der vielleicht bedeutendste Dichter des Surrealismus, widmete ihm seine ganze Person erst nach seiner Reverenz vor der Literatur.
Es verwundert nicht, daß die Anbetung aller revolutionären Tendenzen den Surrealismus in die magnetischen Felder der Politik zog. Seinen Vorstellungen von Revolte, die ja auch das soziale Empfinden umschlossen, mußte also eine politische Idee, wie sie der Kommunismus vortrug, verwandt genug erscheinen, um ihr vorerst Sympathie, später Beitrittserklärungen zu vermitteln. Jedoch bekam dieser Pakt dem Surrealismus ebenso schlecht, wie er dem Kommunismus keine Spuren einprägte. Lediglich Missverständnisse und Aufspaltungen – was den Surrealismus anging. Seine weitere Entwicklung war gezeichnet von Differenzen zwischen ihren Wortführern. Die gemeinsame Artikulation verstummte, die Richtungen trennten und verzweigten sich, nicht nur politische Diskrepanzen trieben Keile, man ging eigene Wege.
Exemplarisch der Fall Aragon. Louis Aragon, eine Kampfnatur, war der Realist unter den Surrealisten. Kennzeichnend für ihn sein Leitsatz: »Ich will wissen, an was ich mich halten kann.« Im Unterschied zu jenen, die die surrealistische Idee mit surrealen Mitteln durchzusetzen suchten, verlegte Aragon seine menschliche und dichterische Aktivität aufs Irdische, Diesseitige. Abseits der Sekten spürte er dem Menschen nach, seine Konzeption zielte auf die Erneuerung des Menschen mittels der Revolte. Er entschied sich für das praktische Engagement, er hielt die Anerkennung des Kommunismus als Möglichkeit unter Möglichkeiten für ungenügend und verschrieb sich den Direktiven Moskaus. André Breton, der dem Surrealismus lediglich die Trotzkische Variante des Kommunismus vorbehalten wollte, unterstellte ihm Verrat und schloß ihn aus der surrealistischen Gemeinde aus. Jedoch, dessen bedurfte es nicht allein, um die spätere Entwicklung Aragons festzulegen. Er schrieb seine Gedichte, als politischer Konvertit hatte er seinen Skandal, die Widerstandsbewegung sah ihn als Initiator und Kämpfer, nach dem Krieg propagierte er die engagierte Literatur und gab eine Zeitung heraus, in letzter Zeit machte er durch seinen Roman La Semaine sainte von sich reden – Tätigkeit genug, um dem französischen Publikum die Gewißheit zu geben, einen redseligen und beflissenen Autor mehr zu besitzen.
Auch Paul Eluard distanzierte sich bereits 1938 von der sich zersetzenden Gruppe, gab aber kurz vor seinem Tod, 1952, zu, daß der Surrealismus die »Befreiung« seiner Dichtung und seine »wunderbare Fähigkeit zu lieben« bewirkt habe. Paul Eluard war auf jeden Fall einer der profiliertesten Dichter, die der Surrealismus entließ: weniger Theoretiker und Propagandist als eben reiner Poet, von dem es hieß, er sei nur zufällig Surrealist gewesen. Um so widersprüchlicher mußte demnach seine Bindung an die Kommunistische Partei erscheinen, obwohl er während des Krieges als Widerstandskämpfer, danach als Funktionär eine enorme, teilweise internationale politische Einsatzfreude entwickelte. Aragon kommentierte zwar: »Mit seinem Beispiel wird eine gewisse Konzeption vom Dichter an den Nagel gehängt. Nichts kann mehr die Tatsache ändern, daß der alte Widerspruch überholt ist, der Widerspruch zwischen reiner Dichtung und Politik« – angesichts seiner späteren Dichtungen jedoch muß man fragen, ob die neue Zufuhr von patriotischen und politischen Themen auch neue poetische Qualitäten enthalten habe. Die Flügel des Surrealismus trugen den Dichter Eluard in fruchtbares Land, aber er legte sie ab und trug sich in die Parteiliste ein – als ein Außenseiter, der seiner Isolation durch Eingliederung in die gelenkte Gemeinschaft zu entgehen suchte.
Versagte also der Surrealismus, der seine besten Talente verlor – u. a. René Char, Philippe Soupault, Tristan Tzara, Salvador Dalí? Nun, André Breton verließ das sinkende Schiff nicht, er lenkt es noch heute. Er verteidigte seine Gewässer, er lichtete und ergänzte die Mannschaft, wie es seiner Doktrin paßte. Sein Kampf galt mehr und mehr der inneren Reinheit der Bewegung, es war ein Kampf um verlorenes Terrain, gegen Unterströme, Unterwanderung. Angesichts der breiten Wirkung, die der Surrealismus inzwischen auf die Kunst übte, angesichts der Verworrenheiten, die unter der Flagge des Surrealismus fuhren, wetterte er: »Es ist schon nicht möglich, daß der Surrealismus alles decken kann, was offen oder nicht in seinem Namen unternommen wird, von den geheimsten Teestuben Japans bis zu den strahlendsten Schaufenstern der Fifth Avenue. Im übrigen fühle ich mich verpflichtet, mich gegen jedes Anpassungsbestreben auszusprechen. Zu viele Bilder schmücken sich heute in der ganzen Welt mit dem, was die zahllosen Jünger nichts gekostet hat – alle diejenigen, die nicht wissen, daß es in der Kunst keinen großen Aufbruch gibt, der sich nicht unter Lebensgefahr vollzieht.«
Breton also schürte das surrealistische Feuer, indem er alle Nebenbrände löschte. Er exkommunizierte, wer den Abänderungen seines Reglements widersprach, er schloß die Tür vor Gästen und Besuchern. Indessen drosselte dieser radikale Purismus jede Blutzufuhr ab. Die alten Zeugnisse verblaßten, die neuen Sensationen blieben aus. So nahm Breton den zweiten Weltkrieg zum Anlaß, den Surrealismus zu verpflanzen. Er ging nicht, wie seine ehemaligen Freunde Aragon und Eluard, in die Résistance, vielmehr emigrierte er nach Amerika, um dort eine intensive surrealistische Missionstätigkeit zu entfalten. Ohne Zweifel erfolgreich. Die amerikanische Sentimentalität gegenüber den Demonstrationen des europäischen Geistes ausnutzend, sammelte die surrealistische Idee eine Legion echter und halbechter Talente um sich – und Amerika hatte seinen neuen Stil. Eine wichtige Entdeckung Bretons war auf jeden Fall Aimé Césaire, der schwarze Orpheus von den Antillen. Wenngleich Césaire sich weigerte, als Surrealist etikettiert zu werden, wirkte die zornige Lava seiner Sprache nachgerade stimulierend auf den erschlafften Elan der Europäer. Césaires Wortwelt, durchleuchtet von Trancen und Tropen, enthielt jenes »Rauschgift Bild«, das die ersten Surrealisten aus ihren Träumen gefiltert hatten. Breton feierte dieses erregende Phänomen, und im gleichen Sinne löste er nun seine Formeln zugunsten verschiedener Einflüsse auf. Er betrieb eine Archäologie der surrealistischen Kunst, deren Vorläufer er in den magischen und steinernen Dokumenten wilder Kulturen suchte. Zurückgekehrt nach Frankreich, überraschte er dort seine Anhänger durch seine neue Toleranz gegenüber Richtungen, von denen er sich eine Weiterentwicklung der surrealistischen Idee versprach. Aber dem Surrealismus fehlte jenes Erlebnis, das den Stilen und Strömungen die entschleierten Gesichter der Katastrophe gezeigt hatte: der Krieg. Die Vorstellungen von Anarchie waren inzwischen durch Tatsachen belegt oder übertroffen. Der Alptraum hatte sich realisiert. Eine Renovierung der surrealistischen Vision mußte als ein Akt der Denkmalpflege erscheinen. Die aktuelle Kunst ging ihre Wege – Engagierte, Existentialisten, Abstrakte. Wiederholt also die Frage: Versagte der Surrealismus, insofern die Anschlüsse nicht klappten?
André Breton hatte geschrieben: »Alle Ideen, die siegen, eilen ihrem Untergang entgegen.« Überblickt man heute die Geschichte des Surrealismus, ist sie eine Kette von abwechselnden Siegen und Niederlagen, Teilerfolgen, Teilverlusten. Einen endgültigen Sieg oder einen Todesstoß hat der Surrealismus nie erfahren – wie nie eine Erkenntnis oder eine Kunst vor ihm.
Eine ästhetische Richtung ist kein Staatsgedanke, der inthronisiert und wieder gestürzt wird. Der Existentialismus löste den Surrealismus nicht ab, sondern tangierte ihn. Art brut, die Bildrevolte der ›Primitiven‹ und ›Irren‹, revoltierte nicht gegen ihn, sondern stand auf seinen Schultern, und Breton half die Leiter halten. Die neue abstrakte Malerei war nicht der Gegenpol der surrealistischen, vielmehr in ihrer letzten Entwicklung knüpfte sie an den Surrealismus an. Tachismus – der jüngste Aufstand der Innenwelt gegen den Akademismus der Gewohnheit, die Renaissance der spontanen Griffe und Akte – von Breton ebenfalls unterschrieben und beglaubigt.
»Niemand«, schrieb einmal der Schriftsteller Luc Bérimont, »niemand kann heute mehr an die Dichtung, die Malerei und das Theater herangehen, wenn er nicht die Lehre des Surrealismus verstanden, innerlich verarbeitet und überwunden hat.«
So surrealisiert heute vieles in Zeitschriften und Ausstellungen vor sich hin – ohne überwunden zu haben. So erkennt man im Gewirr der Neben- und Abstellgleise die neuen Richtungen, die die Stationen des Surrealismus hinter sich gelassen haben und nun ins Ungewisse führen – Ionesco und das absurde Theater, Paul Celans Sprachträume, Günter Grass’ Zaubereien, bis zu Horst Bieneks Versuch, einen deutschen Neo-Surrealismus zu legitimieren. Was heute am Surrealismus antiquiert dünkte, wäre der Versuch, seine Theorien, die er selbst aufhob, zu regenerieren. Er hat Baumschulen gepflanzt, die dem Kahlschlag widerstanden und heute ausgewachsen sind. Er hat Früchte geworfen, seltsame, bittere, faszinierende. Er hat das bedrohte Wunder vor der Frostgrenze gerettet, hinter der das Schweigen beginnt.
Heimatlose Poesie. Zu den Dichtungen Yvan Golls
In der expressionistischen Lyrik-Anthologie Menschheitsdämmerung, deren erste Ausgabe 1920 erschien, findet sich über Yvan Goll die biographische Notiz: »Yvan Goll hat keine Heimat: durch Schicksal Jude, durch Zufall in Frankreich geboren, durch ein Stempelpapier als Deutscher bezeichnet.« Dreißig Jahre später, kurz vor seinem Tod, äußerte Goll, daß er »mit einem französischen Herzen, deutschem Geist, jüdischem Blut und einem amerikanischen Paß« sterbe. Aus diesen Hinweisen auf Herkunft und Staatsangehörigkeit spricht am wenigsten der Stolz der Internationalität, spricht vielmehr eine ironische Trauer über die Heimatlosigkeit, die Golls Leben und Werk zeichnet. In den Jahrzehnten der europäischen Wirren abwechselnd in Europa und Amerika lebend, schrieb Goll seine Dichtungen in drei Sprachen, und über drei Sprachräume haben sie sich verstreut. Im französischen und englischen haben sie Wohnrecht, der deutsche hat jüngst begonnen, sich ihrer zu erinnern. Doch bleibt die Tatsache, daß Yvan Goll, einst in der Spitzengruppe der neuen Poesie, in den historischen Hintergrund gerückt ist. Die ältere Generation hat ihn vergessen, die junge nimmt ihn nicht wahr. Die wenigen Publikationen der letzten Jahre blieben ohne Wirkung; selbst Golls zehnjähriger Todestag im Februar verging ohne die üblichen Requiems im Feuilleton. Wieder ist festzustellen, daß die Folgen der deutschen Kunstdiktatur der dreißiger und vierziger Jahre sowie deren Folgen nach wie vor wirksam sind. Es genügt nicht, daß wir die Literatur der jüngsten Vergangenheit im Komplex überblicken; zu viele Einzelwerke sind noch verschollen, zu viele Dichter – zu Unrecht – vergessen. Ihre Kenntnis würde auch manche Äußerungen der zeitgenössischen Literatur unter andere Aspekte rücken: zum Beispiel dünkte das sogenannte absurde Theater weniger überraschend, wenn das dramatische Werk Yvan Golls bekannt wäre. Goll experimentierte bereits 1920 mit den Möglichkeiten der alogischen Szene sowie den heute legitimen technischen Bühnenmitteln des Films und der Schallplatte. »Das neue Drama wird alle technischen Mittel zu Hilfe ziehen«, schrieb Goll im Vorwort seiner »Überdramen«, und in seiner Theorie des »Überrealismus« heißt es: »Alogik ist heute der geistige Humor, also die beste Waffe gegen die Phrasen, die das ganze Leben beherrschen … Die dramatische Alogik soll alle unsere Alltagsgespräche lächerlich machen … Gleichzeitig wird Alogik dazu dienen, das zehnfache Schillern eines menschlichen Gehirns zu zeigen, das das eine denkt und das andere spricht und sprunghaft von Gedanke zu Gedanke schweift, ohne den geringsten scheinbar-logischen Zusammenhang.« Ich weiß nicht, ob Ionesco Goll kennt: jedenfalls haben sich Golls Intentionen im französischen Theater wiederholt, und Ionescos Sprachsatire und Dialogtechnik sehen sich in Golls Manifestierung der Alogik theoretisch begründet. Mithin dünken die dramatischen Arbeiten Golls, soweit sie der vorliegende Band Dichtungen bekannt macht, aktuell. Gleichwohl posthum. Ihre Neuveröffentlichung trifft sich mit einer derzeit möglichen Schreibweise, die ihrerseits Golls Kühnheiten erhellt. Seine Stücke haben Versuchscharakter; ob sie sich für die Theaterpraxis hergeben, bleibt jedoch fraglich. Goll verfuhr kaum nach dramaturgischen Regeln; die Ereignisse sind ins poetische Rankenwerk verflochten, nicht strukturiert. Der ausschließlich sprachliche Impuls stellt den dramatischen hintan; die Reihung der Szenen erfolgt nach Einfall und Zufall. Selbst Melusine, am ehesten noch »gebautes« Stück, lebt mehr von der Metaphorik denn von den dramatischen Qualitäten. Gewiß, Goll war kein Dramatiker, seine Intentionen waren primär lyrische, und seine Maxime: »Es kann heute kein Drama mehr geben!« ist keineswegs als Rechtfertigung einer poetischen Impotenz zu verstehen. Aus dieser Maxime spricht vielmehr die Notwendigkeit einer Erneuerung dessen, was im Naturalismus noch geschlossene dramatische Einheit herzustellen vermochte. Deren Zerstörung brachte einen Rohstoff zutage, der unter den Händen des Lyrikers indes nur zu vorläufigen, zu Versuchsformen geriet. Freilich sind Golls Dichtung konstruktive Qualitäten fremd; sie wirkt improvisiert, nach Assoziationen gereiht; sie lebt vom Bild, von der Bild-Komposition. Nicht zuletzt seine Prosa. Die Satire Der Goldbazillus enthält zwar tatsächlich erzählte Fabel, doch hat sie sich möglicherweise aus autobiographischer Notwendigkeit ergeben. Ihre Nähe zum Gegenstand verändert diesen nicht. In dem Roman Die Eurokokke wird die Realität verwandelt, jedoch weniger durch romantechnische Manipulationen als durch Verschmelzungen in surreale Bildfolgen, die laufend von kulturkritischen Reflexionen unterbrochen werden. In der Beschreibung des Verfalls, den die europäische Krankheit namens Eurokokke auslöst, zeigt sich dessen makabre Schönheit in den Bildern, die Goll kraft seiner Imaginationsfähigkeit findet und gegen die Wirklichkeit hält. Golls Metaphern verzichten dabei auf den Sprung in die Autonomie. Durch Verschmelzung der einzelnen Wirklichkeitsteile gebildet, vergleichen sie sich auch in ihren überraschendsten Kombinationen noch mit Realität. Gleichwohl produziert diese lyrische Schreibweise »Über-Realität«, wie sie vor allem in Golls Gedichten sichtbar wird. »Das Kunstwerk soll die Realität überrealisieren«, sagte Goll in seinem Manifest des Surrealismus, darin er seine Zugehörigkeit zu dieser literarischen Bewegung ausspricht. Nun stimmt Golls theoretische Maxime mit der Praxis seiner gesamten Poesie überein, einschließlich jener der vor- und nachsurrealistischen Periode. Mithin unterscheidet sich sein Beitrag zum Surrealismus von der einspurigen Ideologie André Bretons. Schon seinen expressionistischen Präludien ist abzulesen, daß ein individueller Dichter wie Goll den literarischen Tendenzen allein die seinem Talent nützlichen Methoden entnahm, ohne sich darum an die jeweilige Doktrin zu engagieren. Es ist die Mischung deutsch-französischen Geistes, die Goll – als einzigen Dichter jener Zeit – nacheinander den Expressionismus und Surrealismus durchlaufen ließ. Doch scheint mir die romanische Komponente in Golls Begabung überwiegend: darauf weist einerseits die Handhabung der Genitivmetapher hin, andererseits sein Formgewissen gegenüber der – wenn auch mitunter alogisch komponierten – Syntax. Goll zerstörte weder Grammatik noch Worte; sein Expressionismus ist eine »Erlebnisform«, deren Ausdruck die Sprache intensiviert, aber nicht beschädigt. Ebenso versagte sich Goll die automatische Schreibweise des Surrealismus, die seine Theoretiker gerade voraussetzen. Indes öffnete Golls poetische Traumfähigkeit den Zugang zur Surrealität. Das heißt: Goll bediente sich ihrer nicht als Kulisse, vielmehr stellte er sie her kraft seiner Phantasie, die sich an seinen jeweiligen Themen entzündete. Deren Vielfalt erklärt die breite Skala seiner Dichtungen. Goll verwendete alttestamentarische und antike Stoffe, indianische Mythen, griff auf Kabbala und Gnosis zurück. Orpheus und Hiob zeigen sich in moderner Gestalt, Charly Chaplin dient als tragische Märchenfigur, Johann Ohneland geistert zwischen den Kontinenten. Golls thematischer Reichtum nährt sich sowohl von der Tradition als von den Phänomenen der Gegenwart. Beides verschmilzt zu poetischen Einheiten, die Goll jedoch häufig abwandelt und variiert. Variation ist nun ein Grundzug seiner Dichtung. So kehrt eine zentrale Figur seiner Gedichte unter stets wechselndem Namen wieder: Claire verwandelt sich in Melusine, Liane, Neila. Das Hiob-Thema kommt nicht zur Ruhe. Johann Ohneland erfährt sich in vielfachen Deutungen. Vor allem in den Gedichten um diese romantische Gestalt, die eine Transfiguration Yvan Golls ist, leistete er seinen lyrischen Beitrag zur Interpretation des modernen Menschen: »Johann Ohneland der Schubladenmensch«, »Johann Ohneland wird von der Leere benagt«, »Johann Ohneland füllt seinen Wanst« – diese Gedichttitel bereits skizzieren sein vielschichtiges Bild. Golls Instrumentationsweise dieses Themas kommentiert eine Briefstelle: »Ich nehme die Inhalte von Hunderten von kleinen verzettelten und nie vollendeten in Einem wieder auf und versuche ihre endgültige Gestaltung«. Indem also seine Gedichte stets zu ihrer endgültigen Gestalt unterwegs sind, produzieren sie das Kontinuum der lyrischen Rede. Das aber heißt, daß die herrschende Wirklichkeit ständig in Frage gestellt wird und schließlich zu Materialien zerfällt, die sich allein zur Herstellung der poetischen Wirklichkeit eignen. Yvan Goll arbeitete an ihr mit der Intensität des heimatlosen Lyrikers, der sie als einzige Heimat weiß, in der er zu Hause ist.
Zu dem vorliegenden Band der Dichtungen, die der Luchterhand-Verlag herausgegeben hat, ist zu sagen, daß er nun nicht – wie vergleichsweise die Ausgabe von Saint-John Perse – das Musterbeispiel einer guten Edition ist. So fehlen eine Biographie Golls sowie das Gesamtverzeichnis seiner Dichtungen, das man sich mühselig aus dem Quellenverzeichnis selbst zusammenstellen muß. Ein Überblick über das Gesamtwerk Golls ist dem Leser damit kaum möglich. Ebenso fahrlässig ist das Übersetzungsproblem gelöst. Von Golls englischen und französischen Texten finden sich lediglich einige Originale abgedruckt: so sind beispielsweise von den vierzig »Malaiischen Liebesliedern« nur zwei übersetzt. Für den Leser ist dabei erschwerend, daß sich kein Hinweis findet, von welchen Gedichten die Originale vorhanden sind, denn das übliche Verfahren, Original und Übersetzung gegenüberzustellen, ist nicht befolgt. Statt dessen werden ohne Übergang an die Johann-Ohneland-Gedichte einige Originaltexte angehängt, deren Übersetzungen innerhalb der 800 Seiten ausfindig zu machen der Geduld und dem Spürsinn des Lesers überlassen bleibt. Nach welchem Prinzip die Auswahl dieser Originale getroffen wurde, ist nicht gesagt. Ebenso wird das Prinzip verschwiegen, nach dem der Band, der auf eine Reihe von Golls Dichtungen verzichtet, zusammengestellt ist. Wohl sind die wichtigsten, dazu einige bisher unveröffentlichte Arbeiten abgedruckt, doch handelt es sich nicht um eine Gesamtausgabe, was man angesichts des Umfangs zunächst glauben möchte. Es fragt sich also, ob der Verlag nicht besser das Gesamtwerk Golls in mehreren Bänden herausgegeben hätte statt eines Bandes, der nur Querschnittcharakter hat und wohl viele Dichtungen Golls nun endgültig verlorengehen läßt.
Mutmassungen über Jakob. Über den gleichnamigen Roman von Uwe Johnson
Der politische Zustand, in dem sich Deutschland seit 15 Jahren befindet, hat nicht zuletzt seine Spuren in der Literatur hinterlassen: die Existenz zweier fragmentarischer Staatsgebilde hat die Existenz zweier Literaturen nachgezogen, deren einzig Gemeinsames – die Sprache – eigentlich nur noch den Charakter des Vorläufigen und Zufälligen hat. Die beiden Literaturen, die diesseits und jenseits des sogenannten Eisernen Vorhanges entstanden sind, ähneln durchaus der jeweiligen politischen Gestalt, oder konkreter: schreibt man hierzulande unter demokratischer Observanz in einer Freiheit, die, gleichwohl sie sich persönlich verantwortet wissen möchte, schon die Züge von Narrenfreiheit annimmt, so schreibt man im Osten unter den Wachtürmen der Ideologie nach parteiprogrammatischen Richtlinien und Saisonplänen. Über solchen und anderen Unterschieden, die allesamt den ehemals eindeutigen Begriff »Deutsche Literatur« pensioniert haben, fällt nun die Tatsache ins Auge, daß der politische Zustand selbst, der ja schließlich auch die literarische Spaltung verschuldet hat, bislang auf seine literarische Bewältigung hat warten müssen. Mit anderen Worten: unsere zeitgenössische Literatur hat vor einem ihrer dringlichsten Themen, nämlich der politischen, gesellschaftlichen und sozialen Spaltung, zu deren Opfern sie selbst zählt, entweder die Augen geschlossen oder versagt. Die wenigen Versuche, die sich – meist auf Hörspielebene – dem Thema genähert haben, machen in ihrer Harmlosigkeit dieses Versagen nur um so deutlicher. Indes mag solches gerade notwendig gewesen sein, um einen Roman zu ermöglichen, der all dem aufs nachdrücklichste widerspricht und insofern für die einzige Ausnahme sorgt: und zwar Uwe Johnsons Roman Mutmassungen über Jakob, der vor kurzem als das Dokument erschienen ist, auf welches man hierzulande die fünfziger Jahre hindurch gewartet hat.
Nun ist es sicher, daß dieses Buch über seinen dokumentarischen Charakter hoch hinauswächst und nichts hergibt, was als ideologisches Argument gegen diesen oder jenen Teil Deutschlands leichthin eingesetzt werden könnte. Johnson hat weder Partei ergriffen, noch spielt er die eine gegen die andere Seite aus. Sein Standort ist der, den heutzutage zu halten am schwierigsten, aber auch am tapfersten ist: nämlich der leere Raum zwischen den Stühlen, die dünne Zone zwischen den Fronten. Dieser Standort bedeutet keinen Mangel an Entschiedenheit, vielmehr gründet er in der latenten Fragwürdigkeit, die jede Parteinahme begleitet und die der Selbstsicherheit jeglichen Entscheidens den Boden entzieht. Der Alternative zum Beispiel, in welchem Teil Deutschlands es sich zu leben verlohne, stellt Johnson die Unmöglichkeit, in gleich welchem Teil leben zu können, entgegen: Jakob, die Zentralfigur des Buches, geht vom Osten in den Westen und wieder zurück, geht zuletzt »quer über die Gleise«, gerät zwischen zwei Züge und findet dabei seinen Tod.
»Aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen«, sagt Johnson im ersten Satz seines Romans und kennzeichnet damit von vornherein den Weg seines Helden, der den vorgegebenen Spuren nicht folgt. Dabei repräsentiert Jakob durchaus nicht den gängigen Typ des Nonkonformisten: redlich und freundlich übt er in einer Stadt an der Elbe den Beruf eines Streckendispatchers aus, der den sich ständig verfilzenden Zugverkehr geduldig aufdröselt und so das Seine tut, um der Sache des Sozialismus zu dienen. Aber »die Großen des Landes warfen ihr Auge auf Jakob«, heißt es dann, und Jakob findet sich im Netz des staatlichen Sicherheitsdienstes wieder. Jakob nämlich steht dem Mädchen Gesine nahe, das in der sowjetisch besetzten Zone studiert hat, dann aber in den Westen gegangen und zur Sekretärin bei den amerikanischen Streitkräften avanciert ist. Der sowjetzonale Sicherheitsdienst möchte nun Gesine für eine Spionagetätigkeit gewinnen, versucht es zunächst über Jakobs Mutter, die jedoch in den Westen flieht, dann über Jakob selbst, der aber dem Ansinnen des Agenten Rohlfs, der die ganze Aktion leitet, mit einer Haltung begegnet, die Rohlfs von seinem Auftrag ablenkt und für Augenblicke human handeln läßt. Doch Jakobs Loyalität ist erschüttert: Gespräche und Erfahrungen, dazu die zu gleicher Zeit stattfindenden Ereignisse in Ungarn verwehren es ihm, länger im Land zu leben; er fährt in den Westen zu Gesine und seiner Mutter. Jedoch nur besuchsweise. Die westdeutschen Verhältnisse bleiben ihm fremd, die beflissenen Bemühungen um seine Person stoßen ihn ab, er fährt zurück, doch auf dem Weg in die Neutralität seines Dienstes gerät er zwischen die Züge. Ob Unfall, Selbstmord oder Liquidation – die Ursache seines Todes bleibt Mutmaßungen überlassen.
Mutmassungen über Jakob – Mutmaßungen über die Realitäten, die Jakob zerreißen und zwischen denen seine Mitspieler sich wie zwischen Nebelwänden bewegen. Denn keineswegs erzählt Johnson in simpler Folge die Tatbestände, die ich hier grob aufgezeigt habe; nirgendwo in seinem Roman werden Zustände angegriffen oder verteidigt, maßen sich Urteile an, werden ideologische Positionen bezogen. Bei der Gegenwärtigkeit des Themas wäre das alles möglich gewesen, und ein politisch engagierter Leser würde dergleichen wohl verlangen; indes verharrt Johnson schweigsam und scheu vor Zuständen, die bestenfalls dem Geschäft der politischen Propaganda die Konjunktur garantieren. Gleichwohl ist Johnsons Roman ohne die Zustände nicht denkbar, und es ist sicher, daß der Roman nur in dem Teil Deutschlands entstehen konnte, in dem diese Zustände am schmerzlichsten empfunden werden. Uwe Johnson, seinerzeit in der Ostzone lebend, schrieb sein Buch im Schatten der politischen Realität, und insofern besitzt es seinen dokumentarischen Wert. Wenn es nun, wie ich schon sagte, darüber hinauswächst, so deshalb, weil Johnson die politische Realität in eine literarische verwandelt hat.
Und das ist das Überraschende an diesem Roman. Unabhängig von der heute schon grundsätzlichen Frage, ob noch und wie überhaupt ein Roman geschrieben werden kann, hat Johnson ein Geschehen entworfen, das, obwohl durch Tatsachen belegbar, in die Eigenwelt der poetischen Fiktion eingegangen ist. In dieser Eigenwelt nun verhält sich das Geschehen, verhalten sich die Figuren nach den Maßgaben der kompositorischen Ordnung. Ein Geschehen zum Beispiel, das in der Wirklichkeit an festem Ort in zeitlich ununterbrochener Folge abzulaufen scheint, sieht sich in Johnsons Roman laufend unterbrochen durch Reflexionen, Gespräche oder Geschehnisse, die zu anderer Zeit und an anderem Ort stattfinden. Jakob, dessen Tod am Ende des Romans berichtet wird, ist bereits tot, wenn der Roman beginnt. Was er gesagt, gedacht und getan hat, wird nun weniger nacherzählt denn in Mutmaßungen über ihn reflektiert; sein Tun und Lassen verteilt sich auf die Gespräche, Monologe und Erinnerungen seiner Mitspieler. Auf diese Weise ist das gesamte Geschehen aufgelöst und wieder verflochten: Handlung schlägt um in Reflexion, die ihrerseits die Handlung auf Monologebene weiterführt, bis sie sich in Gesprächen zwischen unsichtbar bleibenden Partnern zerfasert; daran knüpfen sich berichtende Perioden, die die Fäden der Handlung wieder zusammenziehen und fortspinnen. Mitunter steht das Bild des komplizierten Gleissystems, über das Jakob in seinem Beruf verfügt, für das erzählerische System des Romans, dessen Kreuzungen, Weichen, Signale, Anschlüsse, räumliche und zeitliche Überschneidungen in ebenso sensibler wie präziser Ordnung funktionieren. Diese Erzählweise ist wohl durch literarische Vorbilder – etwa Joyce und Faulkner – bereits legitim, indessen handhabt Johnson sie mit einer Selbstverständlichkeit, die diese Erzählweise ganz ihm zu eigen macht. Nicht minder eigen wirkt seine Sprache, in der epische, essayistische und lyrische Impulse einander abwechseln oder durchkreuzen. Durch Sprache läßt Johnson den Nebel entstehen, der sich über das senkt, was Sache des Schweigens ist; durch Sprache erzeugt er jene Welt, die präzis zu benennen, erfahrbar und meßbar ist. Zuweilen scheint Johnson unter die Haut der jeweiligen Figuren zu schlüpfen, wenn sie im Parteideutsch, im Dialekt, im Philologendeutsch, im amerikanischen oder russischen Kauderwelschdeutsch denken oder daherreden. Doch eine untergründige Schwermut und Melancholie stellt zuletzt wieder den Abstand zwischen ihm, den Figuren und Verhältnissen her, ein Abstand, der nur dann aufgehoben ist, wenn Johnson aus dem Mund Jakobs spricht: redlich, freundwillig, um Gerechtigkeit und richtiges Leben bemüht, das sich zwischen den Fronten versucht.
Zwischen den Fronten steht auch Johnsons Roman, der im Osten geschrieben und im Westen erschienen ist. Im Osten ist er nicht denkbar, fällt er unters Verdikt der Partei. Im Westen wird er – sozusagen – seine Narrenfreiheit genießen, gleichwohl dem sanften Terror des herrschenden Geschmacks ebenso widerstehen müssen wie dem heimlichen Ärger jener, die das Buch vergeblich nach Propagandamaterial durchforschen. Den Mutmassungen über Jakob aber – Uwe Johnsons erstem Buch – folgen auf jeden Fall die Mutmaßungen über das, was von Johnson in Zukunft zu erwarten ist.
Fa:m’ Ahniesgwow. Über das gleichnamige Buch von Hans G Helms
Von allen Künsten sieht sich die Literatur am nachdrücklichsten dem Anspruch ausgesetzt, ihrem Publikum eine Art von ästhetischem Kundendienst zu leisten. Über ihrer Bereitwilligkeit, diesem Anspruch mitunter allzu willfährig nachzukommen, vernachlässigt sie ihre künstlerische Funktion und verliert sich dabei im Genre sogenannter Belletristik. Erst die Entschiedenheit, mit der sich Literatur auf sich selbst und das heißt auf ihre Mittel und Materialien besinnt, macht sie zu dem, was sie vorgibt zu sein: nämlich Kunst. Die Radikalität, mit der solcher Purismus vorzugehen pflegt, entfernt sie dabei vom Leser, dessen sie als verifizierenden Teilhabers gleichwohl bedarf: ein Widerspruch, dem sich nicht zuletzt die Legende von der Krise der modernen Literatur verdankt. Genau besehen befindet sich die Literatur tatsächlich in der Krise, insofern sie sich hartnäckig jener Formen bedient, die schon deshalb antiquiert dünken, weil die Zeiten, die sie hervorbrachten und deren soziologischer und weltanschaulicher Habitus diese Formen legitimierte, inzwischen vergangen und nur noch in restaurativen Köpfen wirksam sind. Sensible Autoren greifen deshalb nur noch zögernd beispielsweise zur Romanform, um einer so vielschichtigen Wirklichkeit wie der gegenwärtigen zu begegnen. Indes verhindert die Tapferkeit, mit der diese oft raffinierten Versuche, das Ausgeleierte in Gang zu halten, durchgestanden werden, gerade die Möglichkeit, die Krise der Literatur als ihre Chance zu verstehen; als die Chance nämlich, zu einer Textform zu gelangen, die das Antiquierte seiner Ohnmacht überlassen hat und das Neue erkundet.
Die zu beobachtenden zeitgenössischen Tendenzen, die sich in diesem Sinne an das Unerprobte halten, tasten sich nun abseits der herrschenden Literatur – im »Labor«, wie das Schlagwort sagt – in unbekannte Richtung vor. Treten sie nach außen, in die Öffentlichkeit, scheinen sie sich durchaus nach dem Satze Ernst Blochs: »Das Neue kommt besonders vertrackt« zu verhalten. Das trifft vor allem auf jenes Buch zu, dem dieser Satz im Vorspruch mitgegeben ist: Hans Günter Helms’ Fa:m’ Ahniesgwow, das jüngst im Dumont Schauberg Verlag als erstes Buch des Autors erschienen ist. Helms, das sei vorweg gesagt, gehört zu den Autoren, die die Sprache beim Wort nehmen; was Helms freilich besorgt, ist eine Zerstörung dessen, was der Gebrauch ohnehin lädiert, aber als Medium noch handlich belassen hat. Macht Helms diesem Medium nun vollends den Garaus, so aus Kritik an jenen Instanzen, die es für ihre Zwecke zurichten. Das Ergebnis indessen ist weniger Chaos denn Utopie, die unter anderem die Hoffnung durchwaltet, daß die Sprache gerettet werde.
Helms’ Buch läßt sich geltenden literarischen Kategorien nicht zuordnen. Selbst der Unterschied zwischen »Prosa« und »Poesie« ist aufgehoben, obwohl dem Text noch erzählerische und reflektierende Momente innewohnen. Helms arbeitet mit puren linguistischen Mitteln; gewisse Techniken der Wortbildung erinnern dabei an die Kompositionsmethode von James Joyce: finden sich beispielsweise in dem Wort »pastoclockenschlucht« das englische »past« (vergangen), »o’ clock« (Uhr) sowie die Wörter Glocke, Glockenschlag, Schlucht und Schluchzen zu einem komplexen Zeitbegriff versammelt, der gleichzeitig über sich selbst hinaus auf Räumliches und Emotionelles verweist, so ähnelt diese Begriffskonstruktion jener aus Finnegans Wake, in der Joyce aus dem französischen »sang« (Blut), »sanglot« (Schluchzen), »sans« (ohne) und dem englischen »glory« (Ruhm) das Kompositum »sanglorians« bildet, das sich durch die Verschmelzung solch vielsagender Vokabeln wie Ruhm, Blut und Schluchzen mehrdeutig erklärt. Dieses artifizielle Verfahren ist historisch als ein durchaus sprachbildendes belegt: so verweist schon Wilhelm von Humboldt auf die Wortbildungen der amerikanischen Delaware-Sprache, die nach ähnlichen einverleibenden Prinzipien ihre Begriffe erzeugt.
Hat James Joyce in Finnegans Wake das Material aus siebzehn verschiedenen Sprachen verarbeitet, so verwendet Helms in Fa:m’ Ahniesgwow einige mehr: linguistische Studien haben dem Text offenbar vorgearbeitet, und um eben diesen Abstand bleibt der Leser zurück, der die für den Text verwendeten Fremdsprachen nicht kennt. Diesem Mißverhältnis begegnet nun der dem Buch beigegebene Kommentar des Komponisten Gottfried Michael Koenig. Seine theoretischen und analysierenden Untersuchungen gehen über den Rahmen des üblichen Nachwortes hinaus und bilden einen notwendigen Bestandteil des Buches. Daß die Analysen überraschenderweise ein Komponist zeitgenössischer Musik liefert, erklärt schon der Umstand, daß Helms seinen zunächst schriftlich konzipierten Text um die akustische Dimension erweitert hat (tatsächlich ähnelt das Klangbild des Textes mitunter auch musikalischen Phänomenen). Helms bedenkt dabei die Tatsache, daß Sprache, ehe sie sich als Schriftbild niederschlägt, vorerst als Klangzeichen kommt. Dessen Verwendung als kompositorisches Element für einen literarischen Text verlangt indes ebendieselbe Reproduzierbarkeit, die dem gedruckten Text eignet: die Schallplatte, die Helms besprochen hat, erfüllt damit die gleiche Funktion wie das Buch, dem sie beiliegt. Darüberhinaus enthält sie jene Textstellen, deren Schriftbild nicht ausreicht, um ihre vielschichtigen Bedeutungen zu vermitteln. Diese nämlich sollen sich erst einstellen, wenn der betreffende Text optisch und akustisch gleichzeitig rezipiert wird.
Koenigs Kommentar, der eine erste Brücke zum Leser schlägt, entschlüsselt nun mehrere Partien des Textes. Vor allem beseitigt er die Annahme, daß Helms gleichsam gegenstandslos gearbeitet und die Sprache als Zeichen ohne Bedeutung gehandhabt oder gar in Buchstabengraphik verwandelt habe. Der Titel Fa:m’ Ahniesgwow verrät bereits, daß hier die Fama, die Sage vom Ahnengau beziehungsweise Amigau mitgeteilt wird. »Ahniesgwow«, so interpretiert Koenig, »meint das zuerst unmittelbar, dann mittelbar von den Amerikanern besetzte Westdeutschland.« Darüber hinaus »enthüllt der Titel sich als Wortgerüst, das mehr trägt als den Amigau. Schon dessen letzte Silbe singt nicht bloß den deutschen Gauen, sondern erinnert zugleich jenen administrativen Bezirk der Nazis, dem der Gauleiter vorstand.« Diese so umrissene Realität, die über ihren aktuellen Zustand kaum hinausweisen möchte, hat Helms mit Fragmenten einer »story« besetzt, der Liebesgeschichte von Michael und Hélène, einem Studentenpaar. Dessen wechselndes, äußeren Umständen und persönlichen Hemmungen unterworfenes Verhältnis zueinander bestimmt den Fortgang des Geschehens. Dieses hätte eine konventionelle Schreibweise für eine der Dürftigkeit dieser Fabel gemäße Kurzgeschichte zugerichtet; der vulgäranekdotische Charakter der Handlung geht dann auch glücklicherweise in der Struktur des Ganzen auf. Im Vordergrund zeigt sich eher das, was als Hintergrund der Studentenstory gemeint ist: nämlich der politische, ideologische und gesellschaftliche Zustand einer Gegenwart, welcher – wie Helms unterstellt – der Faschismus nicht nur als »unbewältigte Vergangenheit« innewohnt. Dieser Zustand ist das dringliche Thema, der Gegenstand des Helms’schen Textes, dessen Unbehagen an diesem Zustand in rücksichtslose Polemik gegen ihn umschlagen möchte. Helms befindet sich dabei in der ohnmächtigen Lage des zeitkritischen Künstlers, der seine praktische Unfähigkeit, die herrschende Wirklichkeit zu ändern, an seinem Material ausläßt. Dieses, die Sprache, erfährt die Kritik, welche nicht eigentlich die Sprache meint, sondern das, wofür sie steht und dem sie als Medium dient. Indem Helms aber die Zerstörung der Realität an der Sprache vollzieht, in welcher ihm die Realität erscheint, zerstört er ein Surrogat: denn während die Sprache darniederliegt, gehen die Sprecher unbehelligt von dannen; die Kritik hat ihr Objekt da getroffen, wo es am wenigsten empfindlich ist.
Daß Fa:m’ Ahniesgwow seine Wirkungslosigkeit gleichwohl übersteht, bestätigt den Text als literarisches Kunstwerk und mithin als das, was er möglicherweise nicht sein will: ein selbständiges Gebilde, das in sich funktioniert und nicht einmal mehr des Ziels bedarf, zu dem es unterwegs ist. Seiner zeitkritischen Intention zufolge könnte Helms durchaus der Kunst die Autonomie absprechen und sie darüber zum Agitationsmittel des Nonkonformismus bestellen wollen. Aber dergleichen Absichten haben bislang kaum künstlerische Qualität eingebracht. In dem Maße aber, in dem solche dem Text zuwächst, treten seine Absichten und Anliegen zurück. Damit holen den Text auch jene literarischen Kriterien ein, denen er sich vorab entzogen hat: nämlich die, welche Fa:m’ Ahniesgwow als Kunstwerk qualifizieren.
Revolution aus Überlieferung
Es ist auf die Schwierigkeit der Übersetzung zurückzuführen, daß bis zum Jahr 1955 die Bücher der Gertrude Stein dem deutschen Leser vorenthalten blieben. Erschienen seitdem auch Picasso und Die Autobiographie der Alice B. Toklas, blieben Gertrude Stein und ihr eigentliches Prosawerk doch mehr oder weniger unbekannt. Dieser Umstand gibt schon insofern zu denken, als die Erfolge der neuen amerikanischen Literatur in Deutschland – vor allem die Erfolge Hemingways – sich zum Teil dem Werk Gertrude Steins verdanken. Und von dieser Tatsache wissen wir auch nur aus der Sekundärliteratur, die uns immerhin frühzeitig mitteilte, daß Gertrude Stein Pionierarbeit leistete, von deren Früchten sie selber nichts heimtrug. Erscheint als dritte deutsche Übersetzung nun ihr Buch Drei Leben, so ist das zunächst ein literaturgeschichtliches Paradoxon: indem es erscheint, holt es gleichsam sich selbst nach; eine Ursache wird bekannt, deren Wirkungen es längst sind (was für alle ihre Bücher gilt, sofern sie noch kommen werden).
Gertrude Stein schrieb die drei Erzählungen dieses Buches zu Anfang unseres Jahrhunderts, in der Zeit, in der sie Amerika verließ und in Paris als »Mutter der Moderne« (Thornton Wilder) sich wiederfand. Ihr Salon, wo die Avantgarde verkehrte, sucht seinesgleichen; gleichwohl erschöpfte sich Gertrude Stein nicht im Management ihrer eigenen Sache: Indem sie schrieb, revoltierte sie gegen die Tradition des 19. Jahrhunderts und arbeitete einer möglichen, zukünftigen Schreibweise vor.
Die Lektüre der Drei Leben möchte insofern zur Rekapitulation jener Schreibweisen werden, die sich an der Gertrude Steins inspirierten. Nun ist Drei Leben jedoch ihr erstes Buch, in dem zunächst ihr eigener Weg anfängt. Dieser lief später auf eine weitgehende Verselbständigung der sprachlichen Mittel hinaus und half jene Tendenzen vorbereiten, die in der progressiven Literatur der Gegenwart zutage treten. Der offenkundig historische Charakter des Buches läßt es jedoch unbeschadet: es ist jüngste, unabgeschlossene Historie, die ihre Wirksamkeit noch zurückhält. Allenfalls das Milieu, das in den drei Erzählungen geschildert wird, wirkt auf den zeitgenössischen Leser veraltet: das Küchenmilieu von Dienstmädchen, deren gesellschaftliches Bewußtsein im Klassenunterschied noch eine natürliche Ordnung erblickt. Allerdings ist es Gertrude Stein selbst, die an der bestehenden sozialen Ordnung in den amerikanischen Südstaaten nichts auszusetzen findet: Nicht anders erkläre ich mir die mörderische Neutralität, mit der Gertrude Stein erzählt, wie beispielsweise die »gute Anna« sich regelrecht zu Tode arbeitet, oder wie die »sanfte Lena« unter der Macht der Konventionen dahindämmert, ohne gar den Ansatz eines individuellen Lebens zu finden. Darin gleichen die »drei Leben« wieder dem Leben in der gegenwärtigen amerikanischen Gesellschaft, die im geheimen das Individuum schmälert und in die Front des Konformen einzwingt.
Man könnte in die Erzählungen nun eine gesellschaftskritische Tendenz hineinlesen, indem man unterstellte, die Beschreibung der »drei Leben« leiste schon eine Kritik am Leben selber, oder wenigstens an den Verhältnissen. Zu einer solchen Interpretation bietet sich indes kein Anlaß. Dagegen spricht vor allem der Pragmatismus der Gertrude Stein, ihre blinde Bejahung des sogenannten Seienden, ihre Einwilligung in die Ordnung dessen, was geschieht. So ignoriert sie die Tatsache, daß die drei Frauen, deren Leben sie erzählt, die Opfer der Gesellschaft sind, nach deren Order sie zum Dienen prädestiniert scheinen. Und was sich also »einfaches Leben« nennt, ist im Grunde ein ausgebeutetes Leben, ein Leben, dem die Erkenntnis seiner Lage vorenthalten bleibt und das damit um die Möglichkeit, es zu ändern, betrogen wird.
Die Schilderung dieses Lebens hat nun den gleichen pragmatischen Charakter wie der gesellschaftliche Zustand, unter dessen Herrschaft es vermummt bleibt. Gertrude Stein sagt, was der Sprache nützt. Der erzählerische Gegenstand ist totes Objekt, das in der Sprachmühle rotiert. Das Geschehen scheint endlos, entbehrt eigener Zwangsläufigkeit, paßt sich vielmehr den Bewegungen der Sprache an. Gertrude Stein erzählt kaum Ereignisse; was Ereignis, Konflikt oder dergleichen sein könnte und entsprechend eingeleitet, aufgebaut und zugespitzt sein müßte, ergibt sich dem pausenlosen Diktat der Sprache: und sie meint nichts anderes als ein pauschales »Sein«. So »sind« die auftretenden Figuren zunächst einmal, ehe ein beschränkter Vorrat an Adjektiven karge Auskunft über die Art und Weise ihres Seins gibt. »Lena war geduldig, sanft, lieb und deutsch.« Wohl scheint solch lapidare Charakterisierung den Vorzug des Direkten zu haben, doch erweisen sich die Figuren zuletzt als abgekürzt, als Entwürfe ihrer selbst. Daß in ihnen mehr enthalten ist, als ihre Beschreibung über sie sagt, verraten dann ihre Schicksale. Deren Ähnlichkeit ist aber auch nur scheinbar: Es ist die Darstellung, die die »drei Leben« einander ähnlich macht; es sind Gertrude Steins sprachliche Mittel, welche die Kontraste, Unterschiede und Differenzierungen über einen verbalen Leisten schlagen.
Und in diesem Sinn ist Gertrude Steins Sprache im Grunde totalitär. Ihre Vorherrschaft macht das Erzählte bedeutungslos. Bedeutung haben Syntax, Rhythmus und die Ökonomie der Worte. Die Schreibweise triumphiert, aber weil sie sich gleich bleibt, wiederholt sie sich und geht mit sich selber konform. Das Ergebnis heißt Monotonie. Liegt in der Schreibweise jedoch Gertrude Steins literarische Bedeutung, so deshalb, weil diese Schreibweise die Sprache beim Wort nimmt und das Schreiben als Materialarbeit versteht. Zu jener Zeit, in der Dichten Schwärmen hieß und das dichterische Wort in der Zwangsjacke des Klischees erstickte, mußte diese Anstrengung revolutionieren. Gleichwohl bleibt der merkwürdige Widerspruch: Indem Gertrude Stein auf sprachliches Machen ausging, entfernte sie sich vom sprachlichen Gegenstand, den unmittelbar zu nennen sie zwar vorgab, aber schließlich nur stilisierte. Die Schilderung der »drei Leben« ist durchaus ungewohnt und zerstört die herkömmliche Art, doch in den Zustand und in den gegängelten Ablauf dieser Leben willigt sie ein. Und wenn das Nachwort Gertrude Steins »Mut, sich vom Überlieferten zu lösen« rühmt, so ist es nur das literarische Überlieferte, dem sie absagt. Ihr Blick aufs Überlieferte, »uns umgebende Lebendige« heißt es gut.
Das Riesen-Phantasus-Nonplusultra-Poem. Die ersten drei Bände der neuen Arno-Holz-Ausgabe
Der Begriff von Weltliteratur wäre weniger verkommen, hätte man ihn geschont und verwendet immer für einen literarischen Text, in den die Erfahrung von Welt, von totaler Realität will ich sagen, eingegangen und sprachlich ratifiziert worden ist. So verstanden, wäre der Phantasus ein Beispiel von Weltliteratur. Als der durchgeführte Versuch einer Komposition, die Sprache autonom macht und zugleich den fortwährend wechselnden Erfahrungskomplexen anmißt, leitet der Phantasus eine Tendenz der zeitgenössischen Literatur ein. Er verlangt darum im gegenwärtigen literarischen Bewußtsein (im Bewußtsein derer, die Literatur machen) einen Ort, den er nicht hat. Denn er ist verschwiegen worden; er ist damit so gut wie gar nicht vorhanden; bestenfalls ist er Gegenstand der Literaturwissenschaft geblieben. Arno Holz aber ist kein Gipspoet der Gründerjahre, kein Fossil des Naturalismus. Sein Name ist bekannt, aber sein Werk wird nicht gelesen. Ist es greifbar? Es soll zehn Bände geben aus den zwanziger Jahren. Der Luchterhand-Verlag hat sechs Bände angezeigt; drei Bände – der Phantasus – liegen nun vor. Und indem ich dieses tausendfünfhundertvierundachtzig Seiten lange Wortkontinuum lese, jetzt, gerate ich in ein Stimmengemisch, darin schon Joyce mitreden und Döblin; die Expressionisten; Stramm, Benn, Schwitters; Arno Schmidt und Helms. Dieser Turmbau von Sätzen und Zeilen steht mitten im Feld einer bestimmten zeitgenössischen Sprechweise (die Beziehungen macht selbst zwischen Brock, Grass und Bense), unsichtbar bislang, aber nicht länger. »Aber Holz fehlt das dichterische Ingenium, und die neuerfundene Form, an der er mit unermüdlicher Willenskraft weiterarbeitete, war eben doch tatsächlich eine Auflösung aller Form und damit ein Ende der lyrischen Kunst. So fand er weder Nachfolge noch bleibende Wirkung.«
Hier wäre eine Revision geboten; notwendiger ist es, von dem zu sprechen, was Arno Holz im Phantasus machte. Ganz Falsches freilich lehrte der Professor Gerhard Fricke nicht: »ein Ende« machte Arno Holz »der lyrischen Kunst« wohl. Anders aber, als Fricke es gemeint haben dürfte, sah dieses Ende aus: Holz nämlich revidierte im Phantasus die literarische Arbeitsteilung, der zufolge in einem literarischen Text die Sprache nicht zu sich selbst, sondern in den Herrschaftsbereich der übergeordneten Kategorie kommt; darin tut sie das, was ihr als Prosa oder Lyrik eben zu tun bleibt.
Nicht Reim und Metrik, doch Rhythmus
Solche Revision ist noch heute nicht abgeschlossen (beginnt vielleicht wieder in derzeitig progressiver Literatur); und im Phantasus auch bleibt unübersehbar der lyrische Impuls. Pure Lyrik aber schrieb Holz nicht mehr. Sein Versuch, die totale Realität und ihre Erscheinungsweise im dichtenden Bewußtsein sprachlich zu demonstrieren, ließ das lyrische Wort nur noch zu in seiner Übertreibung, nämlich als Kitsch, oder in seiner Verhöhnung, nämlich als Parodie. Wohl zahlte Holz in gewissen Beispielen von Gedichten (daran der Phantasus nicht arm ist) seinen Tribut an die seinerzeit herrschende Schreibweise; gelang ihm der Nippes und der Tinnef, den das ästhetische Reglement des wilhelminischen Bürgertums noch den aufgeklärtesten Kopf dichten hieß: »So süß wob die Nacht. Unter den dunkelen Kastanien gegen die mondhelle Wand, lehntest du mit geschlossenen Augen im Schatten. Wir küßten uns nicht. Unser Schweigen sagte uns alles.« Doch Reime schon wollte Holz nicht mehr hören, so »wohllauttrunken« er war. Von Metrik wollte er nichts wissen, um so genauer hielt er es mit dem Rhythmus. Dies – so liest es sich im Phantasus – war seine besondere Obsession: den Textlauf rhythmisch zu organisieren, und zwar in der dem jeweiligen Thema, dem jeweiligen Gegenstand angemessenen Weise. Holz hatte dabei begriffen, daß Rhythmus durchaus optisch zu demonstrieren geht: nach dessen Maßgabe bestimmte er die je wechselnde Zeilenlänge. Indem er den Text um eine vertikale Mittelachse setzte, bot er zugleich eine typographische Lösung des Problems, wie dem (vor allem Lesen erst tastenden) Auge ein Bedeutungsfeld vorzuführen sei, das Gewicht einer Wortgruppe oder des einzelnen Wortes, eine Häufung syntaktischer Elemente, die Risse und Übergänge zwischen den Satzschüben. Die typographische Schreibweise hat ja keine vorab visuelle Absicht, will ja gar nicht Sprache, des graphischen Effektes wegen, als Bild vermitteln (es sei denn, einem Text wohnte die räumliche Dimension nicht ein oder eine typographische Einrichtung veränderte ihn nachträglich; solches geschieht derzeit). Nein. Im rechten Sinn ist der typographische Impuls zugleich ein grammatischer, hat die räumliche Verteilung von Worten den Sinn, ihre klanglichen, syntaktischen oder assoziativen Beziehungen (oder umgekehrt ihren Mangel daran) offenbar zu machen. Dies ist nun nichts Neues mehr. Wohl noch für Holz. Er akzentuierte Worte durch ihre Vereinzelung; er brach Zeilenglieder nach der Maßgabe ihres Inhalts; er schnitt Satzteile und trennte Wörter nach rhythmischen Impulsen. Er blähte das Satzbild, indem er grammatische Elemente häufte. Er verengte oder verbreiterte die Zeilenbahn und bestimmte so den Wechsel der Lesegeschwindigkeit. Er machte Sprechpausen, indem er die Wortfolge durch punktierte Abstände verzögerte. Freilich – das ist einzuwenden – wurde am Ende ein Schema draus. Holz trieb es zum Äußersten, ich meine zum nicht mehr Einsichtigen: was zunächst eine Erlösung vom geltenden typographischen System bedeutete, wurde selber zum System; verkam zur Methode, deren Mechanik zum Opfer fiel, was funktionell sie hätte interpretieren sollen.
Methodischer Starrsinn aber ging Holz selten ab. Sein Satzbau, der den Text als »Gedicht« zum Platzen brachte und als »Prosa« nicht zusammenschloß, hatte bei aller Monstrosität etwas Stures. Zumeist blieb er sich gleich: »Unter mir … radschaukelt sich der Dampfer querschräg … über die … Havel.« Dieser einfache Satz braucht siebzehn Seiten, die sind voll von Synonymen, Umschreibungen, Ergänzungen. Hier wirkte in Holzens Verfahren ein besonderer Widerspruch. So streng er seine Satzgerüste baute, so chaotisch gerieten sie. Was er ins Schema quetschte, arbeitete an seiner Zerstörung. Nicht umsonst. Nicht ohne Grund. Holz – so lese ich es im Phantasus – haderte mit dem Subjekt-Objekt-Schema des Satzbaus: seine Imaginationen, seine Phantasie, sein Erlebnis der Realität gingen über die Nutzmöglichkeiten dieses Schemas hinaus. Denn es bedeutet einen vorgegebenen Modus der Erfahrung und des Ausdrucks; es verhindert eine spontane Sprechweise; es unterschlägt der Sprache, was ihr zu vermitteln es vorgibt. Holz gab diesem Schema recht und wendete es loyal an: aber indem er dies tat, indem er seine Möglichkeiten bis zum Exzeß ausnutzte, machte er es zum Labyrinth, oder zur Farce. Nicht der Satzkünstler, sondern der Saboteur konstruierte Sätze seitenlang. Nicht der Artist jonglierte, sondern der Sprachlose zahlte heim dem System, das seine Sprachlosigkeit verwaltet.
Aber Holz war doch besessen vom Wort. Er war besessen vom Gegenstand. Vom Ding. Von der Realität. Er war besessen von der Utopie, die Realität im Wort zu fassen. »Die Kunst hat die Tendenz, die Natur zu sein.« Der Satz steht im Phantasus und in einem Essay (den kenne ich nicht). Diese Tendenz bedeutete nicht die Reproduktion der Realität durch Sprache. Sie meinte vielmehr ihre Reflexion. Holz versuchte sie in einer Weise, die das Wort zum Spiegel seines Gegenstandes, eines Vorganges machen sollte. Das im täglichen Umgang taugliche Wort taugte dafür nicht. »Frischrinselig.« »Lichtflitterflinkerndst.« »Fleischfetzenfestfettfraß.« »Durchbrickabrackte, schmelzflitterbeflunkerpackte, goldtroddelnbeklunkerklackte Eierdaunkissen.« Solche Klitterungen, aus denen Kritik am fertigen Wort (und das heißt zugleich: an einer vorgeprägten Verständnisweise der Wirklichkeit) spricht, solche Klitterungen versuchen eine totale Verbalisierung des gemeinten Gegenstands oder Vorgangs. Holz ging es dabei nicht um exakte Beschreibung, nicht um genaue Information. Die Realität sollte heimkommen in der Sprache. Indem aber Holz die Sprache veränderte, indem er Worte aufriß oder zu phonetischen Klumpen ballte, veränderte er die Realität. Sie blieb nicht heil, sie geriet am wenigsten zum »naturalistischen« Tableau, sie wurde zerstört. Holz betrieb in der Sprache einen Verschlingungsprozeß. Dutzende von Attributen fraßen den Gegenstand auf, dem sie galten. Haufen von Dingwörtern erdrückten die Dinge, die sie nennen sollten. Im Wortgeschiebe von Jargon und Kunstsprache, Dialekt und Poesie, Slogan und Fachsprache verwandelte sich die Realität in einen sprachlichen Kosmos, der das Bewußtsein dessen, der da redete, genau reflektierte.
Der da redet, ist das Ich des Arno Holz; aber dieses Ich versteht sich als eine Versammlung von Personen, historischen Figuren, Wunschhelden, Untieren, Traumtänzern, Terroristen, Idyllikern, Sängern, Schreihälsen, Spießbürgern, Teppichhändlern, Sternguckern etc. Dieses jeweils verwandelte Ich konkretisiert alle Erfahrungen, Imaginationen, Träume. »Alles durchrann mich.« Holz gab im Phantasus die Darstellung dessen, was in seinem Bewußtsein wohnte, rumorte oder schlief. Er beschwor die Geschichte und die Mythologie; er imaginierte Reisen in die Vergangenheit, in den Traum, in die Zukunft. Er besang die Kindheit, erinnerte Jugend und Lebenslauf. Er trug imaginäre Fehden aus mit Alperscheinungen und Kollegen aus der Literatur. Er bewegte sich durch phantastische Landschaften, feierte Orgien, trieb es zärtlich oder gewaltsam. Er wisperte in der Natur, flötete in Dörfern und Städtchen; er ächzte sich durch den Alltag. Sein Bewußtsein war ein Komplex von Assoziationsfeldern, die, in Bewegung gebracht, einander verschoben, abdrängten, antrieben, zurückstauten. Nicht kontinuierlich lief das ab. Wechsel von Bewußtseinszuständen, von Erlebnissen, Halluzinationen, Brüchen, Leerstellen, Kontrasten. Die plötzlichen Momente der Bewußtlosigkeit: »ähtsch, purrh, fih.« Solche pausenlosen Schübe paßten noch das Disparate zusammen; es blieben keine »Ränder« (auf denen Enzensberger besteht). Es blieben – innerhalb der einzelnen Passagen – gewissermaßen nur Rampen, von denen die Assoziationen sich abstießen.
Sein Platz ist in der Gegenwart
»Phantasus … dieser miserabele, dieser lamentabele, dieser formidabele, inexkulpabele, inkommensurabele, inkroyabele, blamabele Entsetzensschmöker, in dem ich mir Zeit und Weile vertrieb, in den ich sämtliche Farben rieb, in den ich alles geduldig schrieb, was mir das Leben schuldig blieb!« Hier wäre anzusetzen, hier wäre die Frage fällig nach Holzens Verhältnis zum »Leben«, zur Wirklichkeit; nach dem Verhältnis zwischen seiner Phantasie und dem, was sie provozierte. Holz zerstörte in seiner Sprache, was in seiner Sprache er darstellte: die Realität. Holz betete zugleich sie an, besang und feierte sie. »Nichts, was mich nicht entzückte.« Aber indem er sie bejahte, stellte er fest, was sie ihm vorenthielt. Sie verwaltete sich bereits. Das macht im Phantasus die anarchische Tendenz. Es wäre weiter zu fragen: nach den innigen Beziehungen zwischen Idylle und Terror. Im Phantasus treten sie offen hervor. Es wären nachzumessen die kurzen Entfernungen zwischen Provinz und Kosmos, zwischen Dachkammer und Welt. Holz hatte etwas vom dichtenden Kleinbürger, der sich aus seinem Gärtchen einen Urwald macht, aus seiner Schreibtischfläche eine Wüste Gobi. Zu untersuchen bliebe Holzens Dogma vom Naturalismus und seine Anwendungsweise im Phantasus. Das Fragen nach Arno Holz und seinem Werk wird nicht rasch zur Ruhe kommen. Kaum hat es begonnen. Zu lange ist er verschwiegen worden. Die Veröffentlichung seines Werks sollte die Aufforderung sein, nicht die neue Welle Holz zu kreieren, sondern mit ihm sich einzulassen. Arno Holz starb im Jahre 1929. Im nächsten Jahr feierte er seinen Hundertsten. Machen wir kein Festival draus. Holen wir ihn in die Gegenwart heim: er hat hier seinen Platz.
Gegen die Erhaltung des literarischen status quo (1964)
Kaum erscheint noch ein Roman von Rang, dem nicht anhaftet der Makel eines partiellen oder auch gründlichen Mißlingens. Dabei ist die Kritik, der solches Mißlingen ins Auge fällt, zumeist sich einig, daß die erzählerischen Talente des betroffenen Schreibers außer Frage stehen: er hätte bloß mehr Ökonomie walten lassen, seine Figuren kenntlicher modellieren, Grammatik und Zeichensetzung weniger vergewaltigen und besser auch die Handlung nicht so, sondern so herum führen sollen. Keinen Gedanken indessen verschwendet die Kritik daran, daß der objektive Stand der Gattung vielleicht nur ein Scheitern noch zuläßt; daß der Begriff vom Roman zwar in den Köpfen noch sitzt, seine Voraussetzungen dagegen mit dem Bürgertum, in dessen Epoche er sie fand und als dessen Ausdruck er gilt, verschwunden sind. Auch nicht fragt die Kritik, was dem Romanschreiber heute geboten sei: entweder aufs Fabulieren zu verzichten, oder Romantexte zu versuchen, welche die Fähigkeit der Gattung, sich fortwährend zu verändern und so die Verdikte der Geschichte zu widerrufen, demonstrieren. Aufmerksam und prompt verteilt die Kritik ihre Urteile; jedoch, indem sie immer ans Gegebene sich halten, sind sie sekundärer Art. Durchweg leistet Kritik heute keine theoretische Reflexion; so viele ästhetische Normen sie anzubieten hat, so wenig arbeitet sie an der theoretischen Bestimmung dessen, was literarisch geht oder gehen soll. Zeitgenössische Literatur jedoch verträgt solche Versäumnisse schlecht. Das Bewußtsein, das sie verbreitet, zeugt nicht von Selbstgewißheit und Naivität. Ihrer selbst unsicher, der Fragwürdigkeit ihrer Kategorien, ihrer Wirkungen und Chancen eingedenk, vermag sie nichts anderes als ihre Bedingungen, ihren Zustand und Fortschritt kritisch zu reflektieren. Dies leistet offensichtlich jeder Schreiber, dem an der Erkenntnis seiner literarischen Situation gelegen ist. Es werden heute nur wenige Äußerungen bekannt, die nicht entweder von einem Dilemma oder von den Versuchen zeugen, solchem Dilemma eine Wendung ins Offene, in den unbesetzten Bereich des literarisch Neuen zu geben. »Wir müssen«, erklärt uns Michel Butor, »über das reflektieren, was wir tun, müssen also bewußt, bei Strafe der Verdummung und von uns selbst gebilligter Erniedrigung, aus unserem Roman ein Instrument der Neuerung und der Befreiung machen.«
Soweit jedoch ist es noch nicht. Schon die Herrichtung des Romans zum Instrument führt ihn eher zurück als weiter. Denn seit der Romanschreiber die Übersicht über die Wirklichkeit, die er darstellen will, verloren hat, seit er nicht mehr repräsentativer Sprecher ist einer Gesellschaft, die von ihm Belehrung oder Aufklärung über sich selber verlangt, steht der instrumentale Charakter des Romans in Frage. Seine erzählerischen Fiktionen sind nicht mehr so handfest und glaubhaft, daß sie als schlüssige Argumente für oder gegen etwas einzusetzen wären. Auch vermittelt er nicht länger die rechte Unterhaltung, lassen sich seine Helden schwer benutzen als Modelle für ein Leben, das man nicht hat, aber wünscht. Die eingezogene Distanz zwischen Erzähler und Leser verhindert, daß der Leser bloß als Zuschauer teilhat an den Geschehnissen; statt dessen sieht er sich unvermittelt ins Geschehen einbezogen, zum selbständigen Denken gezwungen und vor Fragen gestellt, auf die der Autor auch nicht eine Antwort weiß. Immerhin erfährt der Leser, daß, so komplex der zeitgenössische Roman und so unterschiedlich seine Tendenzen erscheinen, seinen Autoren eine Art von Verstörung, ein Orientierungswille und die Einsicht ins notwendige Neue gemeinsam ist. Nur folgen solcher Einsicht noch selten die rechten Konsequenzen. Die Theorien etwa, die den neuen französischen Roman begleiten, erscheinen fortgeschrittener als die Romantexte selbst. Michel Butor nennt den regressiven Romancier den »Helfershelfer des tiefen Unbehagens und der finsteren Nacht, in der wir uns abmühen«; seine erzählerischen Methoden, wie Hans G Helms ausgeführt hat, gleichen indessen jenen der Gehirnwäsche. Der Kritiker B. vermag zwar dem Romancier A., nicht aber ihrem Schöpfer Walter Jens den Herrn Meister auszureden. Uwe Johnson findet es »unzweifelhaft mißlich, daß einer bloß wahrscheinliche Leute hinstellt, wo sie nicht gestanden haben, und sie reden läßt, was sie nicht sagen würden«; eine andere Praxis fällt ihm nicht ein.