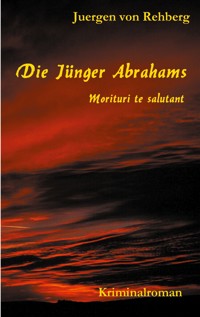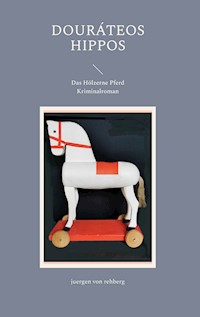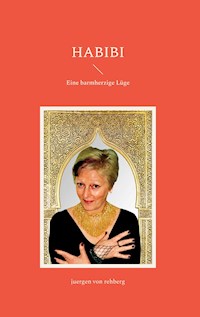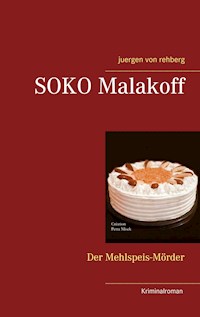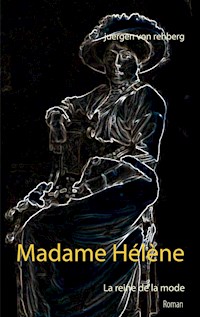3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Studienreferendarin Jolante Bach wirft ihrem älteren Kollegen, Oberstudienrat Dr. Georg Merlinger, den verbalen Fehdehandschuh hin, welchen dieser auch sofort aufnimmt. Es entsteht eine turbulente, humorige Geschichte über Liebe, Freud und Leid, die sich über mehrere Generationen hinzieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Pila-Virus hat seinen Namen der Form zu verdanken, in der es auftritt. Es ist kugelförmig und auch genauso gefährlich, wie die Kugel aus einem Gewehr.
Es war urplötzlich aufgetreten, praktisch aus dem Nichts, und es hatte eine unbeschreibliche Hysterie bei der Bevölkerung ausgelöst.
Im Gegensatz zu einer Influenza, wo man schnell einmal ein wirksames Mittel zur Hand hat, verhielt es sich bei dem Pila-Virus ganz anders.
Vielleicht war das auch der Auslöser dieser Hysterie. Die Medien taten ihr Übriges dazu, und die stark divergierenden Meinungen und Erklärungen seitens der Experten und der Regierungen vervollkommneten das Szenario.
Das alles führte dazu, dass Hamsterkäufe an der Tagesordnung waren, wie bei einer Vorhersage für eine bedrohende Hungersnot, oder noch viel schlimmer, wie bei einem bevorstehenden Krieg.
Georg und Jolante Merlinger betrachteten das Ganze mit der Gelassenheit des Alters. Nicht, dass sie die Bedrohung nicht ernst genommen hätten, aber eine gewisse stoische Lebenshaltung hatte schon vor etlichen Jahren bei ihnen Einzug gehalten.
„Sabine hat angerufen und gesagt, dass sie nicht kommen werden.“
Georg legte die Zeitung beiseite und blickte über seinen Brillenrand zu Jolante. Er lächelte.
„Und was sagt Klara dazu?“, fragte er.
Jetzt lächelte auch Jolante.
„Sie tobt“, antwortete Jolante, „was hast du denn geglaubt?“
Georg nahm die Zeitung wieder auf und las weiter.
„Findest du das richtig?“, fragte Jolante.
Georg legte wiederholt seine tägliche Morgenlektüre auf die Seite und nahm seine Brille ab.
„Was meinst du damit?“, fragte er.
Allein, dass Georg seine Brille abgenommen hatte, war Indiz dafür, dass nun eine längere Unterhaltung folgen würde.
„Nun, dass Sabine offenbar Angst hat, mit Klara zu uns zu kommen“, antwortete Jolante.
„Und weiter?“, erwiderte Georg.
„Nichts und weiter“, antwortete Jolante. „Ich meine ja nur.“
„Das ist typisch für euch Frauen“, murmelte Georg und wollte seine Zeitung wieder aufnehmen.
„Was soll das nun wieder heißen, Georg?“, fragte Jolante leicht gereizt. Sie hatte ihr Visier heruntergeklappt und war bereit für eine verbale Konfrontation.
Nun machte sich auch Georg dazu bereit.
„Du hast mir gerade mitgeteilt, dass Sabine mit ihrer revoluzerischen Tochter sich nicht traut, zu uns zu kommen. Ich habe das zur Kenntnis genommen und gedacht, dass die Sache damit erledigt sei.
Aber nein. Du hast mich dann gefragt, ob ich das richtig fände. Weil ich die Frage jedoch nicht einordnen konnte, habe ich mir erlaubt, um weitere Details zu bitten.
Die habe ich dann auch erhalten in der Form von <nichts weiter>, worauf ich dir geantwortet habe, dass ich dieses Verhalten deinerseits als <typisch weiblich> assoziiere.“
Das war zu viel für Jolante. Sie belegte den Blick ihres Gatten mit einem Bannstrahl und begann mit ihrem Plädoyer:
„Erstens nenne Klara nicht die <revoluzerische Tochter> von Sabine.
Zweitens, habe ich dir eine ganz einfache Frage gestellt, die jedes Schulkind hätte ohne Probleme beantworten können.
Und drittens, so etwas wie <typisch weiblich> oder <typisch männlich> existiert überhaupt nicht.“
„Ha, ha!“
Mit diesen zwei Worten übernahm Georg nun wieder das Wort:
„Dass ich nicht lache, natürlich gibt es das. Ich kann dir das gern in zwei Beispielen erklären.“
Georg wollte gerade damit beginnen, als es an der Haustür läutete.
„Wer kann das sein?“, fragte Jolante, und Georg konnte es sich nicht verkneifen, darauf zu antworten:
„Das werden wohl Sabine und Klara sein. Vermutlich hat sich der kleine Revoluzzer wieder einmal durchgesetzt.“
Jolante schluckte hinunter, was sich ihr gerade massiv aufdrängen wollte, atmete einmal tief durch und ging zur Tür.
„Hallo, Renate; komm doch bitte herein!“
Es war Renate Körner, die Nachbarin von Merlingers.
*****
„Wieso können wir nicht zu Oma und Opa?“
Clarissa hat sich vor ihrer Mutter in bedrohlicher Pose aufgebaut und suchte ein klärendes Gespräch.
Clarissa, auf deren Geburtsurkunde der Name Klara eingetragen war, und die unter dem selbigen Namen auch die Taufe erfahren hatte, stand breitbeinig da, mit in den Hüften gestützten Händen.
Sie war gerade einmal neun Jahre alt, als sie ihrem Umfeld klarmachte, dass man sie ab sofort mit dem Namen „Clarissa“ – mit „C“ und ja nicht mir „K“ geschrieben – anzusprechen habe.
Sie begründete ihren Beschluss damit, dass eine Schulkameradin ebenfalls Klara hieße, dass diese rothaarig und sommersprossig wäre, und dass sie auf keinen Fall mit dieser hässlichen Erscheinung verwechselt werden möchte.
Sabine war geschockt, als sie das Statement ihrer Tochter vernommen hatte. Sie lehnte dieses abstruse Ansinnen mit aller Macht ab, was jedoch nicht die gewünschte Wirkung erbrachte.
Als alleinerziehende Mutter einer frühpubertierenden Neunjährigen war sie de facto chancenlos.
Klaras, Verzeihung, Clarissas Vater hatte schon beizeiten das Weite gesucht. Er hatte sich in eine andere verliebt, eine jüngere Frau und aus sehr gut betuchtem Hause.
Das wiederum hatte dazu geführt, dass Clarissa noch einen draufsetzte, indem sie zu Sabine nicht mehr Mutter sagte, sondern sie einfach mit ihrem Vornamen ansprach.
Auch hierfür lieferte sie eine stimmige Begründung:
„Eine Familie muss aus Vater, Mutter und Kind bestehen. Sonst ist es keine richtige Familie. Und ergo verliert eine Mutter somit auch das Recht, auch so genannt zu werden, sollte kein Vater zur Verfügung stehen.“
Eben dieses Kriterium erfüllte Clarissas Vater. Er stand weder finanziell noch persönlich zur Verfügung. Es reichte noch nicht einmal für eine Geburtstagskarte, geschweige denn für ein Geschenk zu Weihnachten.
Nicht nur, dass Sabine unter der Trennung litt, wie ein Tier, musste sie sich auch noch die Vorwürfe ihres Großvaters anhören, der Sabines Ehemann zwar nicht besonders mochte, aber die Schuld für die Trennung zum größten Teil bei ihr suchte.
Es gab Tage, da drohte die Summe der Schicksalsschläge, welche im Laufe ihres Lebens auf sie herniedergegangen waren, sie zu erdrücken.
Begonnen hatte alles mit dem frühen Tod ihrer Mutter, die an Lungenkrebs gestorben war, was bei ihrem immensen Zigarettenkonsum nicht wirklich überraschend kam.
Sabine war damals fünf Jahre älter als Clarissa jetzt. Oma und Opa übernahmen damals die Vormundschaft und kümmerten sich liebevoll um Sabine.
Als Sabine dann Harald kennenlernte und als sie dann schwanger wurde, schien die Sonne nicht mehr untergehen zu wollen.
Auf Betreiben von Sabines Großvater wurde dann auch schnell geheiratet. Die Ehe war jedoch nicht von langer Dauer, und Opa Georg hatte wieder einmal recht behalten, denn er hielt nicht viel von Harald.
Das scheint zwar widersprüchlich auf den ersten Blick; aber die geforderte Eheschließung entsprach nun einmal Opa Georgs Weltbild von Ordnung und Moral.
„Bekomme ich jetzt endlich eine Antwort, Sabine?“
Mit dieser Aufforderung holte Clarissa ihre Mutter in die Wirklichkeit zurück.
Sabine sah ihre Tochter an. Sie fragte sich, warum sie sich vorkam wie ein Fußabtreter, auf dem jeder nach Lust und Laune herumtreten konnte.
Sie hatte sich schon oft gefragt, warum sie die Spielchen ihrer Tochter so willig mitspielte, obwohl sie das für falsch hielt, und die Antwort, die sie sich jedes Mal wieder gab, war immer dieselbe: sie hatte Angst, das Kind würde sich von ihr abwenden.
Clarissa hatte denselben, unbeugsamen Willen, wie Opa Georg.
Als Clarissa ihm die Änderung ihres Namens kundtat, lacht er sie mit den Worten „du spinnst ja“ aus. Anders als bei Sabine, akzeptierte Clarissa seine Entscheidung.
Es ist wie im Tierreich: Das Starke respektiert das Starke, knechtet jedoch das Schwache. Und Sabine war schwach. Und gerade stand ihre Tochter vor ihr und gab ihr das einmal mehr klar zu verstehen.
„Opa Georg und Oma Jolante wollen das so“, log Sabine, begleitet von der Angst, Clarissa könnte das überprüfen.
„Und warum wollen sie nicht, dass wir zu ihnen fahren?“
Sabine war erleichtert, dass Clarissa ihre Lüge geschluckt hatte.
„Sie haben Angst vor dem Pila-Virus“, antwortete Sabine, „weil ältere Menschen sehr gefährdet sind.“
„Und wieso gerade ältere Menschen?“, bohrte Clarissa weiter.
Sabine hasste die endlos vielen „W“- Fragen, denen sie sich von der Geburt Klaras an ausgesetzt sah.
„Weil ältere Menschen ein schwaches Immunsystem haben“, antwortete Sabine.
In Clarissas Gesicht konnte man ablesen, dass sie gerade um eine Entscheidung rang. Sie konnte mit dem Wort „Immunschwäche“ so überhaupt nichts anfangen. Einerseits hätte sie gern gewusst, was es bedeutet, aber andererseits wollte sie sich nicht die Blöße einer Unwissenheit geben. Sie beschloss, der Sache später mittels Google auf den Grund zu gehen.
„Verstehe“, sagte Clarissa, „dann ist es wohl besser, wir bleiben ihnen fern.“
„Ich habe gewusst, dass du das verstehen wirst, mein Schatz“, erwiderte Sabine, „du bist halt doch ein kluges Mädchen.“
Clarissa nahm das Kompliment ihrer Mutter beiläufig an und verschwand kurz darauf in ihrem Zimmer.
*****
„Hallo Georg!“
Renate Körner, die Nachbarin von Georg und Jolante ging auf Georg zu und wollte ihm die Hand reichen.
„Bleib mir ja vom Leib, Renate“, sagte Georg und machte eine abweisende Handbewegung.
„Entschuldige bitte“, sagte Renate, „das war dumm von mir.“
„Hoffentlich hast du das Virus nicht von draußen mit hereingebracht“, brummelte Georg vor sich hin.
„Aber Georg“, kam der mahnende Zwischenruf von Jolante.
„Lass mal“, sagte Renate, „ich weiß ja, wie er es meint.“
„So? Du weißt, wie ich das meine?“, feixte Georg, „was willst du überhaupt? In den Medien heißt es ständig, die Leute sollen zuhause bleiben.“
„Deswegen bin ich ja hier“, antwortete Renate.
Georg lachte laut heraus. Er wandte sich zu Jolante und sagte:
„Siehst du, da hast du ein wunderbares Beispiel für <typisch weiblich>, ist das nicht herrlich?“
Jolante sah ihren Mann nur verständnislos an.
„Verstehst du nicht?“, fuhr Georg fort, „man wird aufgefordert, zuhause zu bleiben, und was macht unsere liebe Renate? Sie geht aus dem Haus.“
„Jetzt mach aber einmal halblang“, meldete sich nun Renate wieder zu Wort, „ich wollte nur fragen, ob ich etwas für euch tun kann?“
„Du bist wirklich unmöglich, Georg“, versuchte Jolante ihren Gatten dezent zu maßregeln, „du solltest dich schämen.“
Die sich bündelnden Blicke der beiden Frauen veranlassten Georg dezent seinen Rückzug anzutreten. Er hielt sich seine Morgenlektüre vors Gesicht, in der großen Hoffnung, dahinter in Sicherheit zu sein.
Jolante und Renate verbuchten diese Handlung als Sieg und quittierten es mit einem Lächeln.
„Möchtest du einen Kaffee, liebe Renate?“
Renate bejahte die Frage und nahm dankend an. Wenig später machte Renate ihrer Nachbarin Jolante das Angebot, sie würde für die nächste Zeit die nötigen Besorgungen - wie Lebensmittel und Medikamente - machen, damit das Virus nicht zur Gefahr für die beiden älteren Herrschaften werden könne.
Jolante bedankte sich für die nachbarschaftliche Hilfe, nicht ohne zu vergessen, dem Gatten später die Leviten zu lesen, sollte Renate wieder gegangen sein.
*****
Als Georg Merlinger in den späten Sechzigern in die Fußstapfen seines Vaters trat, tat er das aus Tradition, nicht jedoch aus Überzeugung.
Seine Mutter war damals die treibende Kraft, welche ihn in diese Richtung gelenkt hatte. Ihr Vater war schon im Schulwesen tätig, und ihr Ehemann, Georgs Vater, war es auch.
Ein Mann mit einem anderen Beruf wäre als Ehemann niemals infrage gekommen. Seine Karriere war jedoch nur von kurzer Dauer. Oberleutnant Franz Merlinger blieb auf dem Feld der Ehre, und das sogar noch in den letzten Kriegstagen.
Georg war damals knappe zwei Jahre alt, als seiner Mutter die traurige Nachricht zukam. Ihre Liebe, welche sie bis dahin auf Mann und Kind gleichermaßen verteilt hatte, traf nun den kleinen Georg im vollen Umfang.
Opa Heinrich Merlinger, Oberstudiendirektor i. R. und der Vater von Georgs Mutter, unterstützte aus Leibeskräften seine Tochter in dem Bemühen, aus dem kleinen Georg einen tüchtigen Menschen zu machen.
Damit war das Schicksal des Knaben besiegelt und sein beruflicher Werdegang unabdingbar vorgezeichnet.
Georg legte die vorzügliche Reifeprüfung am Gymnasium ab, schloss sein Studium an der Universität und seine Promotion mit „summa cum laude“ ab, bestieg das Schifflein „Pädagogik“ und versah fortan, als Dr. Georg Merlinger, ungebildete Schüler mit dem geistigen Rüstzeug fürs Leben.
Seine Unterrichtsfächer beliefen sich auf Mathematik und Physik. Für diese Materie hatte er schon in früher Zeit ein Faible, wollte er doch ursprünglich sein Leben der Forschung widmen, was ihm jedoch aus den bekannten Gründen verwehrt geblieben worden war.
War er anfänglich noch dagegen, in den Schuldienst zu treten, begann er peu à peu Gefallen daran zu finden.
Es war wohl die Mischung aus Wissen und Macht, welche er den jungen Menschen, umgeben von Unwissenheit und der damit verbundenen Ohnmacht, gegenüberstellte.
Er tat dies mit einer mörderischen Autorität und einer unnachgiebigen Strenge, welche ihm alsbald den Spitznamen „Dr. Gnadenlos“ einbrachte.
Als er eines Tages im Lehrerzimmer von einem Kollegen darauf angesprochen wurde, antwortete er:
„Ich weiß, dass ich nicht der beliebteste Kollege bin. Sie sollen mich ruhig fürchten. Ich erwarte, dass sie etwas lernen, nicht dass sie mich lieben.“
„Was haben Sie gegen die Liebe, Herr Kollege?“
Oberstudienrat Dr. Georg Merlinger wendete seinen Kopf in die Richtung, aus welcher die Frage gekommen war. Es war das Fräulein Jolante Bach, ihres Zeichens Studienreferendarin, welche die Frage gestellt hatte.
„Und wer bitte sind Sie noch mal?“, fragte der Oberstudienrat in einem deutlich erkennbaren süffisanten Tonfall.
„Mein Name ist Jolante Bach“, antwortete die Studienreferendarin, und der mitanwesende Schulleiter, Oberstudiendirektor Dietrich Henlein, fügte noch hinzu:
„Frau Bach ist unsere neue Studienreferendarin.“
„Das Fräulein Bach also“, sagte der Oberstudienrat in leicht süffisantem Ton, „so, so…“
„Ich lege großen Wert auf die Anrede <Frau> und nicht <Fräulein>, verehrter Herr Kollege.“
Der innere Schweinehund des Herrn Oberstudienrates stellte ihm gerade heftige Anregungen zur Verfügung; allein schon wegen der Bezeichnung „Herr Kollege“ durch den Grünschnabel Bach.
„Ein interessanter Vorname und kaum noch gebräuchlich“, fuhr der Oberstudienrat fort, „ist das nicht auch der Name eines Rosses in der nordischen Sage?“
„Gleichwohl, Herr Kollege“, antwortete Jolante Bach, „es gibt aber auch eine schönere Bedeutung dieses Namens. Er kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet violette Blume.
Vielleicht verfügen Sie ja über genügend Fantasie, sich auszumalen, um welche Blume es sich hierbei handeln könnte.“
Im Lehrerzimmer gefror gerade die Luft. Das gesamte Kollegium sah sich bedeutungsvoll an. Noch niemals hatte sich jemand getraut, so mit dem Kollegen Merlinger zu sprechen.
Selbst der Herr Oberstudiendirektor Henlein schnappte förmlich nach Luft. Die Blicke der Anwesenden wechselten zwischen Oberstudienrat und Studienreferendarin hin und her, gespannt darauf, wer wohl zum nächsten Schlag ausholen würde.
Aber es geschah nichts dergleichen. Im Gegenteil. Über das Gesicht von Oberstudienrat Dr. Merlinger huschte ein kleines Lächeln, um sich darin zu manifestieren.
Die Studienreferendarin, Jolante Bach schloss sich dem an. Auch sie begann zu lächeln und sagte in versöhnlichem Ton:
„Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir die Geschichte mit dem Schwein Jolanthe, aus dem Lustspiel <Krach um Jolanthe> von August Hinrichs erspart haben, geschätzter Herr Kollege.
Und im Übrigen schreibe ich meinen Namen gänzlich ohne >h> im Gegensatz zu besagter Jolanthe.“
„Ich werde es mir merken, verehrte Frau Kollegin, und herzlich willkommen bei uns“, erwiderte Georg und fügte noch hinzu:
„Ich denke, Sie sind eine Bereicherung für uns alle.“
*****
Es war gerade einmal eine Woche her, dass die verbale Schlacht mit versöhnlichem Ausgang zwischen Oberstudienrat Merlinger und Studienreferendarin Bach stattgefunden, und sich die Aufregung darüber im Kollegium gelegt hatte, als Jolante eine Nachricht mit folgendem Wortlaut in ihrem Postfach vorfand:
„Verehrte Kollegin!
Ich werde von heute an eine Woche lang im <Corleone>, das ist das italienische Restaurant in der Rathausgasse, um 20:00 Uhr sitzen und auf Sie warten.
Ich möchte Sie auf einen Loup de Mer1 einladen; er ist eine wahre Offenbarung. Es gäbe aber auch Pizza und Pasta.
Mein Angebot gilt für eine Woche. Danach verfällt es und wird auch nicht wiederholt.
Diese Einladung hat den einzigen Zweck, mehr über Ihre Person in Erfahrung bringen zu können, und er sollte keinesfalls als Date oder als eine plumpe Anmache gesehen werden.
Ich habe meine Ausdrucksweise dem heutzutage gebräuchlichen Sprachduktus angepasst, und ich gehe davon aus, dass Sie damit umgehen können.
Dr. Georg Merlinger, Oberstudienrat“
Als Jolante Bach das gelesen hatte, musste sie erst einmal tief durchatmen. Sie blickte sich vorsichtig um, ob sich der Verfasser vielleicht in der Nähe befinden würde. Danach las sie sich den Brief noch einmal durch.
Ihre erste, spontane Eingebung hieß sie, diese abstruse Einladung abzulehnen. Aber unmittelbar danach gebot ihr die Neugier, sich darauf einzulassen.
*****
Oberstudienrat Dr. Georg Merlinger war gern gesehener Stammgast im „Corleone“. Er hatte sogar einen eigenen Tisch, der ständig für ihn reserviert war.