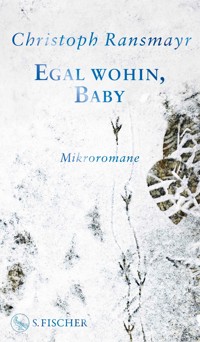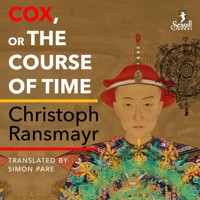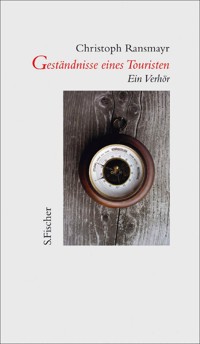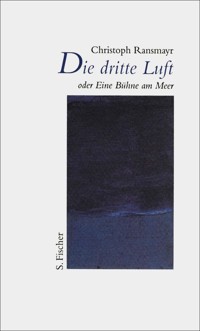9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der zehnte Band der »Spielformen des Erzählens« in edler Leinen-Ausstattung: Christoph Ransmayr rühmt und dankt, fragt und kämpft. »Die Verwandlung von etwas in Worte gehört zu den vielfältigsten und ungeheuerlichsten Verwandlungen, die in unserer Welt möglich sind.« Davon spricht Christoph Ransmayr in seinen Reden und erinnert uns, dass es oftmals gerade das Kindhafte, Gefährdete, Archaische oder traumatisch Verletzte an der Poesie ist, das Unbändige, Wahnsinnige an Prosa und Drama, das uns bewegt, fesselt oder überwältigt. Zu den vornehmsten Möglichkeiten der Literatur zählt Ransmayr dabei die Förderung der Vorstellungskraft durch das Erzählen vom tatsächlichen Leben des Einzelnen, um so gegen Dogma und Klischee, die Voraussetzungen aller Barbarei, zu immunisieren und darin vielleicht sogar eine Ahnung von Glück zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christoph Ransmayr
Gerede
Elf Ansprachen
FISCHER E-Books
Inhalt
Reden, Ansprachen, die nicht auch vom Leben der Menschen berichten, von ihren Hoffnungen, Ängsten, Sehnsüchten und katastrophalen oder verbrecherischen Irrtümern, könnten ebensogut als leere Thesen gedruckt, an Wände und Tore geschlagen und dort in Ruhe vergessen werden. Die Ansprache ist wohl jene Spielform des Erzählens, die der ältesten dieser Formen am nächsten kommt: dem Bericht am Feuer, den ein heimkehrender Jäger oder Sammler denen erstattete, die er bei seinem Aufbruch zurückließ und nun beteiligen wollte an allem, was er ohne sie erlebt oder erlitten hatte. Aber selbst der überzeugendste Redner wird in heiterer Gelassenheit nie vergessen, daß, was er vor seinen Zuhörern noch so leidenschaftlich und beschwörend zur Sprache zu bringen vermochte, gemessen an der ungeheuerlichen Vielfalt, Rätselhaftigkeit, Bedrohlichkeit oder auch Schönheit der Wirklichkeit, am Ende doch nur selten mehr sein konnte als: Gerede.
Picinguaba, im September 2013
CR
Weinte sonst niemand?
Zur Verleihung des Bertolt-Brecht-Preises
Wenn Sie Hilfe brauchen, einen guten Rat, moralische Unterstützung bei der Bewältigung Ihrer persönlichen Vergangenheit oder jener der gesamten Nation und Gesellschaft, aus der Sie kommen … Hilfe vielleicht auch bloß bei der Entscheidung, wer auf der Weltbühne gegenwärtig die Rolle eines mit Krieg, Hinrichtungen und Rachefeldzügen drohenden Schlagetots spielt und wer die des braven Schutzmannes oder die des noch braveren Soldaten … Wenn Sie sich nicht ganz im klaren darüber sind, ob Ihr Land einem Abgrund oder blühenden Gärten entgegendriftet, und deshalb und vorsichtshalber Erkundigungen über allfällige Fluchtwege einziehen wollen … Oder wenn Sie schlicht und einfach, Gott bewahre!, etwas knapp bei Kasse sind und die steinernen Gesichter der Passanten nach dem Mantra Ihrer gemurmelten Bitten um etwas Kleingeld nicht mehr ertragen – dann denken Sie gut nach, bevor Sie einen Dichter um Beistand fragen.
Um Schriftsteller und Dichter hat der Wind im Verlauf einer nur sehr selten triumphalen Literaturgeschichte ziemlich viel Laub angeweht, Lorbeerlaub, auch den weniger edlen, wildwüchsigen Vorschußlorbeer, einen ziemlich großen Haufen jedenfalls, der in den Stürmen besonders bewegter Zeiten an Säulen und Denkmälern hochschlägt wie eine Brandung aus dürren Blättern: Die Dichter, raschelt es, rauscht es manchmal in dieser Gischt, hätten schon immer, wenn nicht alles, so doch vieles besser gewußt – Gewissenserforscher, Mahner, beharrliche Erinnerer seien sie stets gewesen, ja Seher! unter dem Banner von Wahrheit und Gerechtigkeit … Du lieber Himmel, wie oft wurden diese armen Überforderten, nennen wir sie nun der Kürze halber einfach Dichter, nicht schon mit hochmoralischen geistigen Heroen verwechselt. Als ob die Ahnengalerie der Literaturgeschichte eine Heldengalerie wäre und nicht – was sie ja oft viel eher zu sein scheint – ein Armenhaus und Asyl voll liebes- und geltungssüchtiger Neurotiker.
Unglücklich das Land, antwortet Galileo Galilei seinem empörten Schüler Andrea Sarti in einem der größten, dem Leben des Galilei gewidmeten Dramen des Dichters Bertolt Brecht: Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.
Ach ja, vielleicht gab es tatsächlich einmal Zeiten, in denen Dichter von Festung zu Festung wanderten und unter Schießscharten und Balkonen, erst recht an offenen Feuern, nicht nur Liebeslieder, sondern auch Nachrichten aus der bewohnten Welt sangen, mehr oder weniger ferne Zeiten, in denen auch die Bewohner der Städte kaum lesen konnten und deshalb Vorleser, Vorsprecher brauchten, Meldeläufer, die ihnen von der Welt und ihren Möglichkeiten zuerst berichteten und diese Berichte dann auch noch kommentierten, während Lorbeerkranz, Leier oder Elektrogitarre bereits bei den geleerten Flaschen lagen.
Aber sind diese Zeiten – zumindest in unseren Breiten – nicht unwiderruflich vorbei? Haben wir nicht genug gesehen? Sehen und hören wir noch immer nicht genug von der Welt? Oder ist es bloß bequem, eine Haltung, die grundsätzlich nicht delegierbar ist, nämlich die eines einigermaßen aufgeklärten, friedlichen, humanen Individuums, abzugeben an Sänger und Dichter, um für sich selber nur einen Plüschsitz zu beanspruchen in einer Loge des großen Lehrstücks von der Moral. Nein, auch wenn die Zahl der Lesefähigen und Schreibkundigen trotz grotesker, gesetzlich erzwungener und wohlüberwachter Reformen der Rechtschreibung nicht zu-, sondern abnehmen sollte:
Wer bloß zuhören, zuschauen, ja!, hinschauen! muß – bloß auf die Bildschirme von Hunderten von Satellitensendern, auf die Schlagzeilen eines äquatorlangen Spruchbandes aus Titelseiten oder auf die Flüssigkristallfenster des sogenannten Internet –, der berufe sich nicht auf das Bedürfnis nach Meldeläufern. Denn selbst wenn sich in sämtlichen Fenstern und Bildschirmen nur Fragmente der Welt spiegeln – warum sollten in diesem irrlichternden Geflacker ausgerechnet die Dichter klarer sehen als, sagen wir: Maler, Musiker und allgegenwärtige Filmschauspieler?, klarer als Abteilungsleiter, lesende Handwerker oder die Mitglieder eines Senats? Und warum sollten die Dichter, wenn sie denn klärende Kommentare zum Lauf der Welt und Zeit schreiben, Pamphlete, Programme, Verhaltensempfehlungen, weniger oft irren als der Nächstbeste? Und warum schließlich sollten diese Dichter, erst einmal zum Gewissen ganzer Nationen erhoben und zu Beratern von Königen und Präsidenten oder selber zu Präsidenten gemacht, mit Orden behängt und kostümiert mit Schärpen und Fracks, weniger lächerlich erscheinen als staatlich bezahlte, überreich dekorierte Würdenträger?
Damit hier kein Mißverständnis aufkommt: Ich rede vom missionarischen, unter Umständen parlamentarischen und im Ausnahmefall prophetischen Auftritt des Dichters, von seinem Erscheinen auf Kanzeln oder Barrikaden, rede von Flugblättern, Transparenten und Mahnschreiben, nicht von Gedichten, nicht von Dramen, Romanen – Spielformen der Kunst, in denen die Welt ebenfalls zur Sprache kommt, in denen die Moral aber, wenn überhaupt, dann als Draufgabe, als das Beiläufige, ja Selbstverständliche eine Rolle spielt, nicht als mühsam zurechtgeschliffener Kern.
Ja, natürlich sei dem Dichter all das auch gestattet, jeder Auftritt, jedes Flugblatt, jedes Schlagwort, alles, alles, überall. Aber wer darf verlangen, daß Mut, Kühnheit, Heldentum, politische, ja historische Weitsicht berufliche Voraussetzungen sein müßten? Die pensionsberechtigten, mit Bausparverträgen ausgestatteten Verfasser von Leitartikeln und Kolumnen, die immer wieder und durchaus überzeugend Mut von der Stange beweisen?
Ist es oft nicht gerade das Kindhafte, das Gefährdete, Archaische oder traumatisch Verletzte an der Poesie, das Unbeherrschte, Unbändige, Wahnsinnige an Prosa und Drama, das uns bewegt, fesselt oder überwältigt? Wer sich aus Leidenschaft, aus Berufung vielleicht, der Sprache verschrieben hat, kann seine politischen Irrtümer bloß weniger gut kaschieren, wenn auch vielleicht besser formulieren als, sagen wir: ein Musiker, Maler oder eine weithin bekannte Televisionserscheinung – besser gefeit vor Irrtümern ist er nicht. Stellen wir uns etwa einen Heros wie Richard Wagner vor, der die gesamte Vehemenz seiner künstlerischen Kraft in den Dienst der Literatur gestellt und ausschließlich Romane, Balladen, Dramen geschrieben hätte, gelegentlich vielleicht auch einen opernhaften, auf vier- bis fünfhundert Seiten angelegten Essay über Menschentypen, Rassen und genetisch bedingte Intelligenz – Bayreuth wäre heute wohl kein Wallfahrtsort, sondern eher ein umzäuntes, weil weithin kontaminiertes Gelände.
Wenn der Lauf der Geschichte tatsächlich ein Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit sein soll – selbst ein über die Welt und ihre Kulturen so mangelhaft informierter Philosoph wie Georg Friedrich Hegel hat das ja behauptet –, dann kann zur Erhellung und zur Verfinsterung dieses Bewußtseins ein poetisches Werk, ja eine bloße Erzählung ein mindestens ebenso geeignetes Mittel sein wie Predigt, Mission oder einer dieser flammenden Aufrufe, die so oft überschlagen in das Gehämmere auf der Klaviatur ideologischer Phrasen.
Wenn von Rednerpulten, von Plakaten und Transparenten herab beispielsweise die Barbarei von Rassismus, autoritärer Herrschaft oder kolonialistischem Übermenschentum beklagt wird, dann kann die aufklärerische Wirkung eines Erzählers oder Dichters durchaus darin bestehen, diese Barbarei, ihre Schrecken wie ihre Dummheit, in ihren konkreten, individuellen Formen zu beschreiben – keine programmatische, sondern eine genaue, lakonische Darstellung. Denn wer sich die von autoritärer Barbarei verursachten inneren und äußeren Verwüstungen einmal vorzustellen versucht hat, bloß vorzustellen!, etwa als Leser oder Zuschauer der Tragödie einer Mutter Courage und ihrer Kinder, der wird vielleicht eine Spur weniger anfällig sein gegen die Versuchung, irgendeinem Gegröle, ob in Bierzelten, Kristallnächten oder Parteilokalen, zu applaudieren.
Die Poesie erfordert Vorstellungskraft, Mitgefühl, fordert das auch von ihren Lesern und Zuhörern – und Roheit, politische oder religiöse Dummheit, Dogmatismus sind zum Teil ja auch ein ungeheurer Mangel an Vorstellungskraft, ein Mangel nämlich an der Vorstellung vom tatsächlichen Leben, vom Glück und vom Leiden des einzelnen. Ein Dichter kann dazu beitragen, diesen Mangel zu lindern, kann so seinem Publikum zur Immunität verhelfen gegen das Gegröle oder kann es vielleicht sogar anstiften, über die Dummheit der Barbarei zu lachen. Barbaren sind ja nicht nur fürchterlich, sondern immer auch lächerlich. Und sie toben nicht bloß in Folterkammern oder auf Schlachtfeldern, sondern vor allem in den Zwischenräumen der Gewalt, an Bildschirmen, in Ämtern, Redaktionen und Büros, in denen sie den tatsächlichen oder vermeintlichen herrschaftlichen oder Willen des Volkes auslegen, festschreiben und in Schlagzeilen, Verordnungen und Paragraphen und alle legalen Voraussetzungen für das Massaker verwandeln …
Worte des Dichters Bertolt Brecht lassen sich unter bestimmten Umständen, in einem Demonstrationszug oder in einer Protestversammlung, recht wirkungsvoll auf Transparente oder Plakate pinseln, ja sogar über Parteiprogramme oder über eine dieser …, dieser Reden von Zukunft und Sicherheit und Verantwortung und vom Kreuz am nächsten Wahltag. Weitaus gründlicher und weitaus nachhaltiger wirken die Worte dieses Dichters aber bei der Behebung des Mangels an Vorstellungskraft. Denn schon von Brechts Fragen eines lesenden Arbeiters wie etwa:
Cäsar schlug die Gallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte
Untergegangen war. Weinte sonst niemand?
… schon von solchen Fragen und keineswegs von den Antworten ist es nicht weit zur Vorstellung, wie etwa ein pilum, der römische Wurfspeer, in den Brustkorb eines gallischen Feindes eindrang und sich dort verbog, weil nach dem Kalkül der Waffenschmiede und Strategen nur seine Spitze gehärtet worden war, damit der Speer nicht bloß zum tödlichen Widerhaken, sondern auch unbrauchbar wurde für einen Gegenangriff. Und unmittelbar hinter der Frage nach den Tränen des Königs Philipp von Spanien flimmert das Bild einer unübersehbaren, über Dörfer, Städte und Küstenstriche der iberischen Halbinsel versprengten Trauergesellschaft, die der Untergang von mehr als fünfzehntausend Seeleuten und Soldaten hinterließ, als von den einhundertdreißig zur Eroberung Englands befohlenen Schiffen der spanischen Armada nach Feuerstürmen und Orkanen kaum sechzig in ihre Heimathäfen zurückkehrten.
Vermutlich sah auch ein so wunderbarer, Denken und Herz erschütternder Dichter wie Bertolt Brecht nicht besonders heroisch aus, als er im Moskau des Jahres 1955 einen nach Stalin benannten Friedenspreis entgegennahm. Aber selbst von Bastionen der Macht, hießen sie nun Moskau, Mahagonny oder Metropolis, wußte der Dichter schon früh: