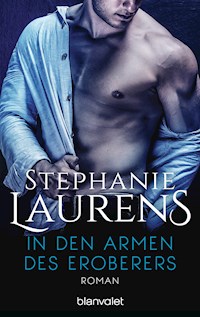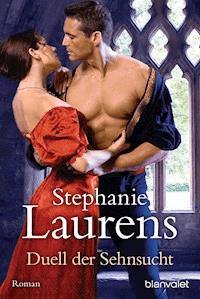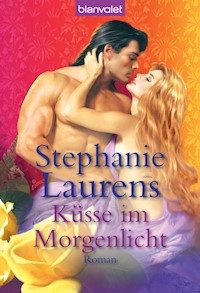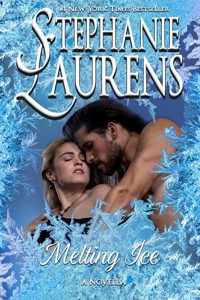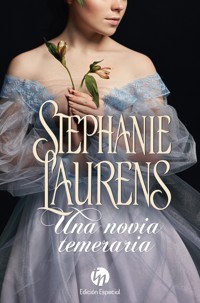6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Frobisher
- Sprache: Deutsch
Eine temperamentvolle Lady und ein unwiderstehlicher Gentleman bringen die Seiten zum Glühen ...
England 1824. Nach mehr als einem Jahrzehnt als Seefahrer in der Dynastie seiner Familie sieht Kapitän Robert Frobisher den Zeitpunkt gekommen, nach einer geeigneten Ehefrau Ausschau zu halten. Eine unerwartete Reise nach Westafrika durchkreuzt diesen Plan – doch ausgerechnet dort lernt er die junge Aileen Hopkins kennen, die ihm sofort gefällt. Die attraktive Engländerin ist auf der Suche nach ihrem verschwundenen Bruder, und so begeben sich die beiden auf eine gemeinsame Mission. Und obwohl Aileen kein Interesse an Robert als zukünftigen Ehemann zu haben scheint, treibt sie die Gefahr, in die beide geraten, immer näher zusammen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
England 1824. Nach mehr als einem Jahrzehnt als Seefahrer in der erfolgreichen Dynastie seiner Familie sieht Kapitän Robert Frobisher nun auch für sich den Zeitpunkt gekommen, nach einer geeigneten Ehefrau Ausschau zu halten. Eine unerwartete Reise nach Westafrika durchkreuzt diesen Plan allerdings – doch ausgerechnet dort lernt er die junge Aileen Hopkins kennen, die ihm sofort gefällt. Die attraktive Engländerin ist auf der Suche nach ihrem Bruder Will, einem Marineoffizier, der unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Robert bietet der attraktiven Frau seine Hilfe an, und so begeben sich die beiden auf eine gemeinsame Mission. Und obwohl Aileen kein Interesse an Robert als zukünftigen Ehemann zu haben scheint, treibt sie die Gefahr, in die beide geraten, immer näher zusammen …
Autorin
Stephanie Laurens begann mit dem Schreiben, um etwas Farbe in ihren wissenschaftlichen Alltag zu bringen. Ihre Bücher wurden bald so beliebt, dass sie ihr Hobby zum Beruf machte. Stephanie Laurens gehört zu den meistgelesenen und populärsten Liebesromanautorinnen der Welt und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einem Vorort von Melbourne, Australien.
Von Stephanie Laurens bereits erschienen
Ein feuriger Gentleman · In den Armen des Spions · Eine stürmische Braut · Ein süßes Versprechen · Ein widerspenstiges Herz · Stürmische Versuchung · Ein sinnliches Geheimnis · Triumph des Begehrens · Duell der Sehnsucht · Eine ungezähmte Lady
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Stephanie Laurens
Gespielin der Liebe
Roman
Deutsch von Christiane Meyer
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »A Buccaneer at Heart« bei MIRA Books, Canada.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Savdek Management Proprietary Limited
Published by Arrangement with Savdek Management Pty Ltd
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung- und motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von RomanceNovelCovers.com und Shutterstock.com (© sefoma; © Jearu)
JvN · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-20833-2V001www.blanvalet.de
Kapitel 1
London, Mai 1824
Kapitän Robert Frobisher schlenderte entspannt die Park Lane entlang und blickte in die Kronen der beeindruckenden Bäume des Hyde Parks hinauf, deren Blätter sich in der Brise leicht bewegten. Es war ein schöner Morgen, obwohl es etwas frisch war. Die Sonne wurde nur ab und zu von grauen Wolken verdeckt, die am blassblauen Himmel entlangjagten.
Robert hatte sein Schiff The Trident am Vortag mit der abendlichen Flut die Themse hinaufmanövriert. Sie hatten am Anleger von Frobisher und Söhne in den St. Katharine Docks festgemacht. Nachdem er noch einige unvermeidbare Gespräche geführt hatte, war es zu spät gewesen, um sich bei irgendjemandem zu melden. Am Morgen war er pflichtbewusst ins Reedereikontor seiner Familie gegangen, hatte die üblichen Formalitäten erledigt und dem Großteil der Crew für den Tag freigegeben. Dann war er in eine Kutsche gesprungen und hatte sich nach Mayfair bringen lassen. Doch statt direkt zum Haus seines Bruders Declan zu fahren, hatte er den Kutscher gebeten, ihn am Ende der Piccadilly aussteigen zu lassen, um noch ein paar Minuten zu haben, das satte Grün der Bäume in sich aufzunehmen. Er hatte so viel Zeit seines Lebens nur aufs Wasser hinausgeblickt, dass es keine schlechte Idee war, sich mal wieder an die Schönheit des Landes zu erinnern.
Ein selbstironisches Lächeln umspielte seine Lippen, als er nun in die Stanhope Street abbog. Es war noch nicht einmal zehn Uhr und damit eigentlich viel zu früh, um jemanden zu besuchen, aber er war sich sicher, dass sein Bruder und dessen frisch angetraute Frau, die reizende Edwina, ihn mit offenen Armen empfangen würden.
Robert blickte die Straße entlang und bemerkte eine schwarze Mietkutsche, die ein Stück entfernt am Straßenrand hielt – ungewöhnlich um diese Uhrzeit. Eine böse Vorahnung strich ihm wie mit kalten Fingern über den Nacken.
Scheinbar gelangweilt schwang er seinen Spazierstock, während er weiterging. Als er die Kutsche erreichte, erblickte ihn der Diener, der auf dem Bock hockte. Sofort sprang der Mann auf den Gehsteig und öffnete den Verschlag.
Neugierig beobachtete Robert, was vor sich ging. Der Herr, der nun mit lässiger Anmut aus der Kutsche stieg und die Schultern straffte, war so groß wie er selbst, breitschultrig und schlank. Schwarzes Haar umrahmte sein Gesicht. Dass er einen höheren gesellschaftlichen Rang bekleidete, sah man ihm sofort an.
Wolverstone. Um genauer zu sein – Seine Gnaden, der Duke of Wolverstone, früher auch bekannt als Dalziel.
Da Wolverstone offenbar auf ihn gewartet hatte, um mit ihm zu sprechen, vermutete Robert, dass der Status des Duke als Kommandant der britischen Geheimagenten außerhalb Englands wiederhergestellt worden war – zumindest vorübergehend.
Roberts zynische, der Welt überdrüssige Seite war nicht im Geringsten überrascht, den Mann zu sehen, doch mit dem etwas weniger eleganten Gentleman, der hinter Wolverstone aus der Kutsche kletterte, hatte er nicht gerechnet. Steif zupfte der korpulente, penibel gekleidete Mann seine Weste zurecht. Robert kannte diesen Schlag Menschen. Er hielt Wolverstones Begleiter für einen Politiker.
Der Duke nickte ihm zu. »Frobisher.« Er streckte die Hand aus. Robert nahm seinen Spazierstock in die Linke, reichte Wolverstone die Rechte und richtete seinen Blick auf dessen Begleiter. Der Duke machte eine elegante Handbewegung. »Erlauben Sie mir, Ihnen Viscount Melville, den Marineminister, vorzustellen.«
Robert musste sich zusammenreißen, um nicht erstaunt die Augenbrauen hochzuziehen. Er neigte den Kopf. »Melville.«
Was zum Teufel ist hier los?
Melville erwiderte das knappe Nicken und holte dann tief Luft. »Kapitän Frobisher …«
»Vielleicht«, ging Wolverstone dazwischen, »sollten wir die Vorstellung ins Haus verlegen.« Mit seinen dunklen Augen blickte er Robert eindringlich an. »Ihr Bruder wird nicht verwundert sein über unseren Besuch, aber mit Rücksicht auf Lady Edwina hielten wir es für besser, in der Kutsche auf Sie zu warten.«
Die Vorstellung, dass Edwinas mögliche Reaktion Wolverstone derart beeinflussen konnte … Robert musste sich ein Grinsen verkneifen. Seine Schwägerin war die Tochter eines Duke und stammte somit aus derselben gesellschaftlichen Schicht wie Wolverstone. Dennoch hätte Robert gedacht, dass es nur sehr wenige Menschen gab, auf die Wolverstone so viel Rücksicht nahm.
Roberts Neugier wurde immer größer. Auf Wolverstones Handzeichen hin ging er die Treppe zu der schmalen Veranda vor dem Haus hinauf. Er war noch nie hier gewesen, aber Humphrey, der Butler, der auf sein Klopfen hin die Tür öffnete, kannte ihn. Die Miene des Mannes hellte sich auf.
»Kapitän Frobisher.« Dann bemerkte der Butler die anderen beiden Gentlemen, und der Ausdruck auf seinem Gesicht war mit einem Mal unergründlich.
Robert fiel auf, dass der Mann weder Wolverstone noch Melville kannte, und er lächelte den Butler an. »Soweit ich weiß, sind diese Gentlemen Bekannte meines Bruders.«
Mehr musste er nicht sagen. Declan hatte offenbar die Stimme des Butlers gehört. Er trat aus einem Durchgang in die Eingangshalle.
Lächelnd ging Declan auf Robert zu. »Robert! Sei gegrüßt!«
Sie grinsten sich an und klopften einander auf die Schulter. Erst jetzt erblickte Declan Wolverstone und Melville. Declans Miene wirkte mit einem Mal verschlossen. Dann sah er Robert mit fragendem Blick an.
Robert zog eine Augenbraue hoch. »Sie haben draußen gewartet.«
»Ah. Ich verstehe.« Sein Bruder war ganz offenbar unsicher, ob Wolverstones und Melvilles Erscheinen positiv oder eher negativ zu deuten war, dennoch begrüßte Declan Wolverstone und Melville höflich und schüttelte ihnen die Hände. Während der Butler die Eingangstür schloss, sah Declan Wolverstone an. »Am besten ziehen wir uns in den Salon zurück.«
Wolverstone nickte, und der Butler öffnete eine Tür zu ihrer Linken. Declan bedeutete Wolverstone, Melville und Robert, ihm zu folgen.
»Soll ich Ihrer Ladyschaft Bescheid geben, Sir?«, fragte Humphrey.
Ohne zu zögern erwiderte Declan: »Ja, bitte.«
Robert ließ sich in einen der Sessel sinken, die in dem gemütlichen Raum standen. Er war erstaunt, dass Declan augenblicklich seine Frau zu diesem Treffen bitten ließ, das eindeutig geschäftlicher Natur war. Um welche Geschäfte es sich allerdings genau handelte, wusste Robert nicht.
Declan hatte kaum Zeit gehabt, seinen Gästen Getränke anzubieten – die sie alle ablehnten –, ehe die Tür auch schon wieder geöffnet wurde und Edwina ins Zimmer rauschte. Alle vier sprangen auf.
Edwina trug ein kornblumenblau-weiß gestreiftes Seidenkleid und wirkte glücklich und erfreut. Sie verströmte eine erfrischende Begeisterung für das Leben. Sie lächelte zuerst Declan an, wandte sich im nächsten Moment aber Robert zu und breitete die Arme aus. »Robert!«
Er konnte nicht anders, als ihr Strahlen zu erwidern und sie zu umarmen. »Edwina.«
Er war der Frau seines Bruders schon ein paarmal begegnet – sowohl bei seinen Eltern als auch bei ihrer Familie zu Hause –, und er mochte sie sehr. Vom ersten Moment an war er der festen Überzeugung gewesen, dass sie die Richtige für Declan war. Er umarmte sie herzlich und drückte ihr brav einen Kuss auf die zarte Wange, die sie ihm entgegenhielt.
Als Edwina sich von ihm löste, sah sie ihn an. »Ich freue mich so, dich zu sehen! Hat Declan dir erzählt, dass wir vorhaben, dieses Haus als unseren Standort in London auszubauen?«
Sie wartete seine Antwort – und seinen schnellen Blick in Richtung Declan – kaum ab, bevor sie sich schon nach The Trident und nach Roberts Plänen für den Tag erkundigte. Nachdem er ihr erzählt hatte, wo das Schiff lag und dass er noch keine Pläne gemacht hatte, informierte sie ihn darüber, dass er zum Mittagessen bleiben würde, dass sie keine Widerrede dulde.
Dann wandte sie sich Wolverstone und Melville zu, um sie zu begrüßen. Die Lockerheit, mit der sie mit den beiden Männern umging, zeigte, dass sie sie bereits kannte.
Auf Edwinas anmutige Handbewegung hin nahmen die Herren wieder auf den Sesseln und auf dem Sofa Platz. Die nächsten Minuten vergingen mit allgemeiner Konversation, bei der natürlich Edwina die Führung übernahm.
Die flüchtigen Blicke, die sie mit Declan wechselte, und die Reaktion seines Bruders auf diese zärtlichen Momente versetzten Robert einen Stich der Eifersucht. Nicht dass er Edwina begehrte – er mochte sie, sie war nur für seinen Geschmack ein viel zu energischer Mensch. Declan war ein verwegener, draufgängerischer Teufelskerl, der deshalb eine Frau wie Edwina brauchte, eine, die seinen Charakter im Gleichgewicht hielt. Er selbst war ganz anders, er war der Diplomat der Familie, war vorsichtig und handelte bedächtig.
»Also dann.« Edwina war offensichtlich zufrieden mit Wolverstones Bericht über die Gesundheit seiner Familie und verschränkte die Hände im Schoß. »Da Sie nun alle hier versammelt sind, vermute ich, dass Declan und ich Robert davon berichten sollen, wie wir die vergangenen fünf Wochen verbracht haben, von der Mission und von unseren Beobachtungen und Entdeckungen in Freetown.«
Mission? Freetown? Sprach sie von der Siedlung in Westafrika?
Robert hatte geglaubt, dass Declan und Edwina in London gewesen waren, während er sich auf der anderen Seite des Atlantiks aufgehalten hatte. Offenbar irrte er sich. Sie waren in Westafrika gewesen.
Edwina sah Wolverstone mit einer hochgezogenen Augenbraue an, mit ungerührter Miene neigte er den Kopf. »Ich denke, dass das am besten wäre.«
Die Resignation in Wolverstones Stimme entging Robert nicht.
Er war sich sicher, dass Edwina es auch bemerkt hatte, doch sie lächelte Wolverstone nur zustimmend zu und sah dann mit leuchtenden Augen Declan an. »Vielleicht beginnst du.«
Abwechselnd erzählten Declan und Edwina eine Geschichte, die Robert in ihren Bann zog. Dass Edwina als blinder Passagier mit an Bord von Declans Segelschiff The Cormorant gegangen war und ihren Mann auf seiner Reise gen Süden begleitet hatte, war keine echte Überraschung. Aber die rätselhafte Situation in Freetown und die daraus resultierende Gefahr, in die Edwina und Declan geraten waren und die ganz unvorhersehbar vor allem Edwina betroffen hatte, war eine Geschichte, die seine Aufmerksamkeit zweifelsohne fesselte.
Als Edwina abschließend erklärte, dass sie durch die Ereignisse der letzten Nacht in Freetown keinen Schaden genommen habe, hatte Robert keinen Zweifel mehr daran, warum Wolverstone und Melville vor der Tür gewartet hatten, um ihn abzufangen.
Melville schnaubte und bestätigte prompt Roberts Vermutung. »Wie Sie selbst sehen können, Kapitän Frobisher, suchen wir händeringend jemanden, der ähnliche Fähigkeiten wie Ihr Bruder besitzt und der so schnell wie möglich nach Freetown segeln kann, um die Ermittlungen vor Ort fortzuführen.«
Robert sah zu Declan. »Ich vermute, dass diese Sache unter unser … altes Bündnis mit der Regierung fällt?«
Wolverstone rührte sich. »In der Tat.« Er sah Robert an. »Es gibt nur wenige, die diesen Auftrag erledigen könnten, und niemanden, der ein so schnelles Schiff im Hafen liegen hat.«
Nachdem er Wolverstones ernsten Blick einen Moment lang erwidert hatte, nickte Robert. »Also gut.« Dieser Auftrag war vollkommen anders als seine üblichen Aufgaben, bei denen er Diplomaten oder auch diplomatische Geheimnisse von einem Ort zum anderen beförderte. Aber er sah ein, wie wichtig die Angelegenheit war, und er verstand die Dringlichkeit. Und er war schon einmal nach Freetown gesegelt. »Ist das der Grund, warum im Kontor kein Folgeauftrag für mich hinterlegt war?«, fragte er seinen Bruder. Diese Tatsache hatte ihn überrascht. Die Nachfrage nach seinen Diensten war für gewöhnlich so groß, dass The Trident selten länger als ein paar Tage im Hafen lag. Oft mussten sein ältester Bruder Royd und sein Segler The Corsair ihn noch unterstützen und Aufträge für ihn übernehmen.
Declan nickte. »Wolverstone hat Royd darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Regierung sich wieder an einen von uns wenden werde, sobald The Cormorant zurück sei, und zufällig wurdest du erwartet. Ich habe eine Nachricht von Royd erhalten, und auch für dich liegt eine Mitteilung in der Bibliothek – wir sind von unseren üblichen Aufgaben entbunden und sollen unsere Dienste der Krone widmen.«
Robert neigte zustimmend den Kopf. Er trommelte mit den Fingerspitzen auf die Armlehne seines Stuhls, während er über das nachdachte, was Declan und Edwina erzählt hatten. Er berücksichtigte auch Wolverstones trockene Kommentare und Melvilles gelegentliche Äußerungen. Im Kopf ging er das puzzleartige Bild durch, das er sich aus den Tatsachen zusammengesetzt hatte. »Also gut. Mal schauen, ob ich alles richtig verstanden habe. Im Laufe einiger Monate sind vier aktive Offiziere verschwunden, einer nach dem anderen. Dazu noch mindestens vier junge Frauen und eine unbekannte Anzahl weiterer Männer. Die wenigen Fälle, die Gouverneur Holbrook vor Ort vorgetragen worden sind, wurden von ihm abgetan – er behauptet, die Leute seien freiwillig gegangen, um im Dschungel oder sonst wo ihr Glück und großen Reichtum zu finden. Auch siebzehn Kinder aus den Armenvierteln sind verschollen, offenbar im gleichen Zeitraum. Holbrook hat ihr Verschwinden damit begründet, dass Kinder nun einmal manchmal weglaufen. Seiner Meinung nach steckt nichts Böses dahinter. Derzeit kann man nicht sagen, ob der Gouverneur das Interesse an dieser Flut verschollener Menschen ignoriert, weil er selbst in die Sache verstrickt ist, oder ob seine Einstellung auf einem naiven Glauben beruht. Unabhängig davon hat Lady Holbrook bewiesen, dass sie definitiv involviert ist, und es darf bezweifelt werden, dass sie sich noch in der Siedlung aufhält. Aber ich soll bestimmt überprüfen, ob Holbrook selbst noch auf seinem Posten ist. Falls er es ist, gehen wir davon aus, dass er unschuldig oder sich zumindest nicht bewusst ist, was hinter diesen Entführungen steckt.« Robert sah Wolverstone mit einer hochgezogenen Augenbraue an. »Richtig?«
Wolverstone nickte. »Ich habe Holbrook zwar noch nicht persönlich kennengelernt, doch er scheint nicht der Typ Mensch zu sein, der sich in eine solche Sache verstricken lässt. Allerdings könnte er der Typ Amtsträger sein, der sich weigert, etwas zu tun, bis die widerwärtige Wahrheit ihm ins Gesicht springt – also bis die Umstände ihn dazu zwingen zu handeln.«
Robert fügte diese neue Information in sein Puzzle ein. »Um fortzufahren … Im Fall der vermissten Erwachsenen gibt es Grund zu der Annahme, dass sie irgendwie ausgewählt worden sind und dass ein Besuch bei einer Messe des einheimischen Priesters Obo Undoto damit zusammenhängt. Wir wissen nichts darüber, wie die Kinder entführt wurden, allerdings scheint es in diesen Fällen keine Verbindung zu Undotos Messen zu geben.«
Declan beugte sich vor. »Wir können nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob die Kinder von denselben Menschen oder aus denselben Gründen wie die verschollenen Erwachsenen mitgenommen worden sind.«
»Angesichts der Tatsache, dass sowohl Kinder und junge Frauen als auch Männer entführt worden sind«, warf Edwina ein, »besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Vermissten für dieselbe Sache benutzt werden.« Sie presste die Kiefer aufeinander. »Von denselben Tätern.«
Robert dachte kurz nach, ehe er weitersprach. »Unabhängig davon, ob alle an denselben Ort gebracht wurden, scheinen Undotos Messen der Punkt zu sein, an dem wir ansetzen sollten. Der Ausgangspunkt. Du sagst, Edwina, dass dies die Voodoo-Priesterin Lashoria vermutet, mit der ihr gesprochen habt. Und da sich diese Vermutung bisher nicht als falsch erwiesen hat, sollten wir davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagt.« Niemand widersprach ihm. Robert dachte kurz über das Bild in seinem Kopf nach, das sich allmählich immer deutlicher herauskristallisierte, dann redete er weiter. »Wenn ich es richtig verstanden habe, gelten einige Leute vor Ort als sichere Informanten. Außer der Priesterin sind das Reverend Hardwicke, seine Frau, ein alter Seemann namens Sampson und Charles Babington.« Er warf Declan und Edwina einen Blick zu. Beide nickten.
»Sie sind potenzielle Verbündete und vielleicht sogar bereit dazu, sich aktiv an den Ermittlungen zu beteiligen«, erklärte Declan. »Vor allem Babington. Ich glaube, er hat ein persönliches Interesse an einer der jungen Frauen, die entführt worden sind, aber ich hatte nicht die Gelegenheit, diese Vermutung oder ihn selbst näher unter die Lupe zu nehmen. Er verfügt allerdings über Quellen, die sich für uns möglicherweise noch mal als nützlich erweisen könnten.«
Melville räusperte sich. »Außerdem gibt es Vizeadmiral Decker. Es besteht im Moment kein Grund anzunehmen, dass er in die schrecklichen Verbrechen, die sich in Freetown zutragen, verstrickt ist.« Er blickte Declan finster an. »Ich hatte Ihnen ein Schreiben gegeben, das Ihnen erlaubte, Deckers Unterstützung einzufordern. Ich glaube, ich habe es allgemein gehalten, also würde es für Sie genauso gelten wie für Ihren Bruder.«
Declan bejahte. »Decker war nicht im Hafen, als ich in Freetown war«, sagte er dann und wandte sich an Robert. »Ich habe das Schreiben noch, ich werde es dir geben.«
Robert ließ sich durch Declans unverbindlichen Tonfall nicht täuschen. Er würde sich nicht überschlagen, Decker um einen Gefallen zu bitten. Tatsächlich hoffte er, dass der Vizeadmiral während seines Aufenthalts in Freetown auf See bleiben würde.
»Trotzdem«, sagte Wolverstone, »kann ich nicht genug unterstreichen, wie entscheidend es ist, dass Sie unter keinen Umständen den vermeintlichen Tätern gegenüber durchblicken lassen, dass irgendein öffentliches Interesse besteht, und sie damit eventuell warnen – egal, was Ihnen während Ihrer Mission passiert. Wir müssen das Leben der Entführten schützen. Ein Rettungsteam zu schicken, das am Ende nur Leichen findet, wollen wir uns lieber erst gar nicht vorstellen. Da wir nicht sicher sein können, welches Mitglied der Behörden in die Sache verwickelt ist und wem wir noch trauen können, muss alles, was Sie tun, unter höchster Geheimhaltung geschehen.«
Robert nickte. Je mehr er hörte und je mehr er über das nachdachte, was er erfuhr, schien es ihm das Klügste zu sein, sich unauffällig zu verhalten und im Verborgenen zu agieren.
»Also, Kapitän«, fasste Melville noch einmal zusammen. »Wir möchten Sie bitten, nach Freetown zu segeln, der Spur zu folgen, die Ihr Bruder entdeckt hat, und alles über dieses abscheuliche Verbrechen herauszufinden.«
Melvilles Miene spiegelte eine Mischung aus Streitlust und etwas wider, das an Flehen erinnerte. Robert erkannte, dass hier ein Politiker saß, der sich einer Bedrohung gegenübersah, über die er keinerlei Kontrolle hatte.
Bevor er antworten konnte, sagte Wolverstone leise: »Eigentlich stimmt das so nicht.« Er fing Roberts Blick auf. »Wir können Sie nicht bitten, alles darüber herauszufinden.« Aus den Augenwinkeln bemerkte Robert, dass Melville Wolverstone, der in dieser Angelegenheit sein Berater war, erschrocken anblickte. Als wäre er sich der Angst nicht bewusst, die er ausgelöst hatte, fuhr Wolverstone fort: »Nach dem, was Ihr Bruder gesagt hat, nach allem, was ich in den vergangenen Tagen durch andere erfahren habe, vermuten wir, dass es sich bei den Tätern um Sklavenhändler handelt, die aus einem festen Camp heraus agieren. Sie halten ihre Gefangenen wahrscheinlich in diesem Camp fest und bringen sie von dort zu ihrem Auftraggeber. Das Camp wird sich außerhalb der Siedlungsgrenzen befinden, irgendwo im Dschungel.« Wolverstone blickte Robert an. »Demzufolge ist es unwahrscheinlich, dass die gesamte Mission in nur zwei Schritten erfüllt werden kann. Es wird vieler Schritte bedürfen, um herauszufinden, was wir wissen müssen. Die Beteiligten dürfen auf keinen Fall Verdacht schöpfen. Ihr Bruder und Ihre Schwägerin« – er neigte den Kopf in Richtung Declan und Edwina – »haben uns die ersten wichtigen Hinweise geliefert. Sie haben herausbekommen, dass Undotos Messen Teil eines großen Plans sind und uns darauf gebracht, dass Sklavenhändler involviert sein könnten. Sie haben bestätigt, dass einige hochrangige Persönlichkeiten in Freetown in die Angelegenheit verstrickt sind. Wenn Lady Holbrook dazu angestiftet wurde mitzumachen, ist es durchaus denkbar, dass auch andere beteiligt sind.« Wolverstones Blick fiel auf Melville, doch obwohl der Marineminister abweisend und verärgert wirkte, machte er keine Anstalten, Wolverstone zu unterbrechen. »Deshalb wird es Ihre Aufgabe sein«, schloss der Kommandant, »die Verbindung zwischen den Sklavenhändlern und Undoto zu bestätigen und das Camp ausfindig zu machen. Sie werden der Spur anschließend nicht weiter folgen, auch wenn die Versuchung noch so groß sein mag.« Wolverstone hielt kurz inne.
»Ich soll ihr nicht weiter folgen?«, fragte Robert.
»Ich weiß, dass diese Anweisung nicht leicht zu befolgen sein wird«, erwiderte Wolverstone. »Ich gebe sie auch nur ungern. Aber um die Rettung aller zu organisieren, die entführt worden sind, ist es unerlässlich zu wissen, wo sich das Camp der Sklavenhändler befindet. Wenn Sie weitergehen und dann möglicherweise selbst entführt werden, erfahren wir erst davon, wenn Ihre Crew hierher zurückkehrt, um Sie vermisst zu melden. Und wenn es so kommt, werden wir nicht weiter sein, als wir es jetzt sind.« Wolverstone sah zu Melville. Als er den Blick wieder auf Robert richtete, wirkte seine Miene unerbittlich. »Eine Mission in mehrere Schritte zu unterteilen, die nacheinander abgearbeitet werden, mag nach außen hin erst mal wie ein sehr langwieriger Weg wirken, aber es ist auf jeden Fall ein sicherer Weg. Diejenigen, die entführt worden sind, haben es verdient, dass wir unser Bestes tun, um sie aus den Fängen der Sklavenhändler zu befreien.«
Robert nickte wieder. »Ich werde das Camp finden und mit der Information zurückkehren.«
Ganz einfach. Ganz unkompliziert. Er hatte keinen Grund, zu widersprechen oder zu diskutieren. Er empfand es als durchaus positiv, dass dieser Auftrag ein ganz genau bestimmtes Ziel hatte.
Wolverstone neigte den Kopf. »Danke. Wir werden Sie dann allein lassen, damit Sie die nötigen Vorbereitungen treffen können.«
Alle erhoben sich. Melville reichte Robert die Hand. »Wie lange wird es ungefähr dauern, bis Sie und Ihr Schiff bereit sind, in See zu stechen?«
Robert ergriff Melvilles Hand und dachte kurz über die Logistik nach. »Ich werde The Trident nach Southampton schicken und dort Vorräte an Bord nehmen lassen. Ich denke, ich werde in drei Tagen lossegeln können.«
Melville schnaubte, sagte jedoch nichts weiter. Robert vermutete, dass dem Marineminister die Lage in Freetown noch wesentlich mehr Sorgen bereitete als Wolverstone. Wenn er es richtig verstanden hatte, musste Melville in dieser Sache praktisch den Kopf hinhalten, politisch und vielleicht auch gesellschaftlich gesehen.
Nachdem er sich auch von Wolverstone verabschiedet hatte, nahm Robert in dem Sessel, der dem Sofa gegenüberstand, Platz. Während Declan und Edwina ihren unerwarteten Besuch zur Tür brachten, ging er in Gedanken noch einmal alles durch, was er soeben erfahren hatte.
Als Declan und Edwina in den Salon zurückkamen und sich wieder setzten, sah er zwischen den beiden hin und her. »Also gut. Jetzt erzählt mir alles.«
Wie er schon vermutet hatte, konnte das Paar ihm noch viel mehr über die Gesellschaft in Freetown erzählen, über die einzelnen Personen, die eine Rolle in ihrem persönlichen Drama gespielt hatten, über die Armenviertel und darüber, wie es dort aussah, welche Gefahren dort lauerten. Er wusste, dass sich dieses Wissen als nützlich, vielleicht sogar als überlebenswichtig erweisen könnte, sobald er sich in der Siedlung befand.
Keinem von ihnen fiel auf, wie die Zeit verging.
Als die Uhr eins schlug, begaben sie sich ins Speisezimmer und führten ihre Unterhaltung bei einem üppigen Essen weiter. Robert grinste, als er die Platten mit den Speisen sah, die hereingetragen wurden.
»Danke«, sagte er zu Edwina. »Das Essen an Bord ist gut, aber dieses köstliches Mahl ist natürlich kein Vergleich.«
Irgendwann kehrten sie in den gemütlichen Salon zurück. Nachdem sie alle Fakten und die meisten Spekulationen bis zur Erschöpfung diskutiert hatten, wandten sie sich schließlich der Frage zu, welchen Grund diese seltsamen Entführungen haben könnten.
Robert saß zusammengesunken in seinem Sessel, hatte die langen Beine übereinandergelegt und tippte sich nun mit den aneinandergelegten Fingerspitzen ans Kinn. »Ihr habt erzählt, dass Dixon der Erste war, der verschwunden ist. Da er ein namhafter Ingenieur ist mit weitläufigen Fähigkeiten den Tunnelbau betreffend, vermutet ihr, dass die Verdächtigen eine Mine betreiben. Habe ich das richtig verstanden?«
Declan, der neben Edwina auf dem Sofa saß, nickte zustimmend. »Das ist durchaus denkbar.«
»Was, glaubst du, wollen sie in der Mine abbauen?« Robert sah seinem Bruder in die blauen Augen. »Du kennst die Gegend besser als ich.«
Declan verschlang seine Finger mit Edwinas. »Gold oder Diamanten.«
»Was ist wahrscheinlicher?«
»Ich denke, Diamanten.«
Robert hatte Respekt vor Declan und seinen Kenntnissen im Bereich Forschung und Expedition. »Warum?«
Declan verzog den Mund. »Ich habe darüber nachgedacht, warum die Leute, die hinter der Sache stecken, sich entschlossen haben, junge Frauen und Kinder zu entführen. Welchen Nutzen könnten Frauen und Kinder für sie haben? Kinder werden in Goldminen oft eingesetzt, um den Bruchstein durchzusehen. In einer Diamantenmine könnten sie genauso nützlich sein, zumindest in diesem Bereich. Und junge Frauen … Diamanten finden sich in mineralischen Körpern innerhalb von Gestein, das meistens mit Erzen verklumpt ist. Die Erze von den Steinen zu trennen ist eine diffizile Arbeit, bei der mit großer Präzision vorgegangen werden muss. Junge Frauen haben gute Augen. Sie können die rauen Gesteinsbrocken so bearbeiten, dass nur noch das Endprodukt bleibt. Die Diamanten können dann leicht geschmuggelt werden, sogar per Post.« Declan sah Robert eindringlich an. »Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass unsere Entführer auf ein Diamantenvorkommen gestoßen und nun damit beschäftigt sind, so viele Steine wie möglich zu bergen, bevor irgendjemand von dem Fund Wind bekommt.«
Ein Mann, der besser gekleidet war als die meisten anderen Gäste der Taverne, die in Freetown am westlichen Ende der Water Street in einer schmalen Seitenstraße lag, saß mit einem Becher Ale an einem Tisch in der hintersten Ecke des schummrig beleuchteten Gastraumes.
Die Tür ging auf, und ein weiterer Mann kam herein. Er war ebenfalls gut gekleidet. Nachdem er sich am Tresen ein Ale geholt hatte, durchquerte er den Gastraum, kam an den Tisch in der Ecke, nickte dem dort Sitzenden zu und zog sich einen Hocker heran. Er setzte sich, ehe er einen großen Schluck von seinem Ale nahm.
Erneut wurde die Tür geöffnet. Der zweite Mann saß mit dem Rücken zur Tür am Tisch. Mit hochgezogenen Augenbrauen sah er den ersten Mann an. »Ist er das?«
Der nickte.
Beide warteten schweigend darauf, bis der Neuankömmling sich ebenfalls ein Ale geholt hatte und sich dem Tisch näherte.
Der dritte Mann stellte seinen Becher auf der zerkratzten Tischplatte ab, sah sich dann noch einmal aufmerksam im Gastraum um, zog sich ebenfalls einen Hocker heran und nahm Platz.
»Hören Sie auf, so schuldbewusst aus der Wäsche zu gucken.« Der zweite Mann hob seinen Becher und nahm noch einen Schluck.
»Sie haben leicht reden.« Der dritte Mann, der jünger war als die anderen beiden, griff nach seinem Becher. »Sie haben keinen Onkel, der Ihr direkter Vorgesetzter ist.«
»Tja, hier wird er uns ja wohl kaum entdecken, oder?«, entgegnete der zweite Mann. »Er wird im Fort und zweifelsohne mit seiner Bestandsaufnahme beschäftigt sein.«
»Gott … Ich hoffe, nicht.« Der jüngere Mann erschauderte. »Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist, dass er herausfindet, wie viel fehlt.«
Der erste Mann, der den Wortwechsel stumm verfolgt hatte, zog eine Augenbraue hoch. »Das ist doch eher unwahrscheinlich, oder?«
Der jüngere Mann seufzte. »Ja … Das nehme ich auch an.« Er starrte in seinen Becher. »Ich habe darauf geachtet, dass nichts von dem, was wir genommen haben, in den Büchern auftaucht. Niemand wird jemals darauf kommen, dass etwas fehlt, wenn es laut der Bücher nie existiert hat.«
Der erste Mann verzog belustigt die Lippen. »Gut zu wissen.«
»Vergessen wir das.« Der zweite Mann wandte sich dem ersten Mann zu. »Was hat es mit Lady H auf sich? Ich habe im Kontor gehört, dass sie sich aus dem Staub gemacht hat.«
Der erste Mann wurde rot. Er umklammerte seinen Becher ein bisschen fester. »Man hat mir erzählt, Lady H sei aufgebrochen, um ihre Familie zu besuchen. Soweit ich weiß, könnte das durchaus möglich sein. Also, ja, sie ist weg. Aber da sie nichts über meine Verbindung zu unserer Operation weiß, hielt sie es nicht für angebracht, mir ihre Gründe zu nennen. Ich habe mich unauffällig umgehört – anscheinend weiß Holbrook nicht, wann sie zurückkehren wird.«
»Also haben wir die Möglichkeit verloren, die Entführungsopfer vorher zu prüfen?« Der zweite Mann runzelte die Stirn.
»Ja«, erwiderte der erste Mann. »Aber das ist es nicht, was mir Sorgen bereitet.« Er nippte an seinem Bier, ließ dann den Becher sinken und fuhr fort: »Gestern habe ich von Dubois gehört, dass Kale zwei seiner Männer verloren hat. Er hatte drei Leute zum Haus des Gouverneurs geschickt, weil Lady H ihm eine Nachricht geschickt hatte, dass sie eine junge Frau abholen könnten.«
Der Jüngere wirkte verdutzt. »Wann war das?«
»Soweit ich weiß, vor gut zwei Wochen. Drei Tage bevor Lady H abgereist ist. Ich habe den fraglichen Abend damit verbracht, Meldungen zu sichten, also habe ich nichts davon mitbekommen.« Der erste Mann hielt kurz inne und sprach dann etwas zurückhaltender weiter. »Wenn ich richtig schlussfolgere, dann war es Frobishers Frau Lady Edwina, die Lady H an jenem Abend besucht hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es Lady Edwina war, die Lady H meinte, als sie Kale benachrichtigte. Und beim Personal des Gouverneurs zu viele Fragen zu stellen ist bestimmt nicht die beste Idee. Laut Dubois ist die junge Frau, die Kales Männer bei Lady H abgeholt haben, betäubt gewesen. Alles, was der einzige überlebende Mann ihm sagen konnte, war, dass sie goldblondes Haar hatte. Wie immer waren sie zu dritt. Sie haben ihr Opfer in ein dunkles Tuch gewickelt und es durch das Armenviertel getragen. Dann wurden sie unvermittelt von vier Männern angegriffen – laut des Überlebenden waren es Seeleute. Die Seeleute haben zwei von Kales Männern getötet und das Opfer mitgenommen. Der dritte Mann ist geflüchtet, hat dann jedoch kehrtgemacht und die Seeleute bis in den Hafen verfolgt. Er sah, wie sie in ein Beiboot stiegen und davonruderten. Im Dunkeln konnte er nicht erkennen, an Bord welchen Schiffes sie schließlich gingen.«
Der zweite Mann kniff die Augen zusammen. »Wenn ich mich recht entsinne, lag Frobishers Schiff an dem Abend im Hafen. Am nächsten Tag war es nicht mehr da. Sie müssen mit der morgendlichen Flut losgesegelt sein.«
Der erste Mann schnaubte. »Man erzählt sich, dass Frobisher und Lady Edwina auf Hochzeitsreise gewesen seien und ihre Familie in Kapstadt hätten besuchen wollen. Wenn es so gewesen ist und wenn es Lady Edwina war, die von Lady H betäubt wurde – wobei Gott allein weiß, warum die Alte das hätte tun sollen –, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir noch irgendetwas davon hören werden.«
Der Jüngere starrte den ersten Mann an. »Aber … Sicherlich wird Frobisher sich in irgendeiner Art und Weise bei Holbrook beschweren, oder?«
Der grinste. »Ich bezweifle das. Lady Edwina ist die Tochter eines Duke und in der Londoner Gesellschaft hochgeschätzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frobisher die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken will, dass seine Frau in den Händen von Kales Männern war – nachts, im Armenviertel, ganz allein. Das ist nichts, was andere Leute über seine Frau wissen sollten.«
»Das sehe ich genauso.« Der zweite Mann nickte. »Er hat sie zurückbekommen, und wie man hört, ist ihr nichts passiert. Er wird es dabei belassen.« Er hielt kurz inne und sagte dann: »Wenn Frobisher vorgehabt hätte, das Thema weiterzuverfolgen, wäre er nicht einfach abgereist, ohne bei Holbrook vorzusprechen. Und das hat er nicht getan. Also stimme ich zu: Das war’s.« Er warf dem Jüngeren einen Blick zu. »Kein Grund, sich in der Hinsicht Sorgen zu machen.«
Der erste Mann stützte sein Kinn in der Hand ab. »Und ich glaube nicht, dass wir befürchten müssen, dass Lady H mit irgendjemandem über uns sprechen wird. Sie hat viel mehr zu verlieren als wir. Der einzige Grund, warum sie auf Undotos Vorschlag eingegangen ist, war Geld – das liegt ihr wirklich am Herzen. Und wenn es Lady Edwina war, die sie betäubt und an Kale übergeben hat, kann ich mir durchaus vorstellen, warum sie, als sie von Lady Edwinas Rettung hörte, das Bedürfnis verspürte, sich davonzumachen. Das hätte ich an ihrer Stelle auch getan. Gut, dass sie freiwillig gegangen ist – wir würden nicht wollen, dass sie hier wartet, bis man ihr irgendwelche verfänglichen Fragen stellt, die möglicherweise auf uns verweisen.«
Der zweite Mann knurrte. » Sie weiß nicht genug, um mit dem Finger auf uns zeigen zu können.«
Der erste Mann neigte zustimmend den Kopf. »Das stimmt. Aber sie könnte mit dem Finger auf Undoto zeigen oder ihren Kontakt Kale preisgeben, und damit würde die Lawine vielleicht ins Rollen gebracht … Nein. Alles in allem sollten wir froh sein, dass sie weg ist. Wir müssen uns nur Gedanken machen, wie wir sie und ihr Wissen ersetzen können.« Der erste Mann blickte die beiden anderen an und zog die Augenbrauen hoch. »Gibt es irgendeine Idee, wie wir an neue Entführungsopfer kommen, ohne dass ihr Verschwinden auffällt oder irgendjemanden alarmiert?«
Es herrschte Schweigen.
Schließlich fuhr sich der zweite Mann mit den Fingern durch sein dichtes schwarzes Haar. »Lassen wir es für den Moment gut sein. Aber bleiben wir wachsam. Im Augenblick hat Dubois ja genug Leute.«
»Er sagt, dass er noch weitere braucht, wenn wir unsere Produktion ausweiten wollen. Und das wollen wir, da wir es unseren Geldgebern versprochen haben«, entgegnete der erste Mann. »Er meinte, Dixon stünde kurz davor, den zweiten Tunnel zu eröffnen.«
Der zweite Mann nickte. »Kein Grund zur Panik. Wir werden schon einen Weg finden.«
»Was ist mit den Frauen und Kindern?«, wollte der Jüngere wissen.
»Dubois sagte, er hätte im Moment genügend.« Der erste Mann drehte den Becher in seinen Händen. »Er wird erst Nachschub brauchen, wenn sie anfangen, Steine aus dem zweiten Tunnel zu befördern.«
Die drei Männer schwiegen eine Weile. Irgendwann schnaubte der zweite Mann. »Ich hoffe, wir können Dixon vertrauen, dass er tut, was nötig ist.«
Der erste Mann verzog die Lippen. »Dubois war davon überzeugt, dass Dixon alles tun wird, was wir verlangen, damit den jungen Frauen keine körperliche Gewalt angetan wird.«
Der zweite Mann grinste. »Ich muss sagen, dass Dubois’ Idee, die Männer mit dem Versprechen unter Kontrolle zu bringen, dass den Frauen nichts passieren wird, wenn die Männer kooperieren, sich als wirklich klug herausgestellt hat.«
Der erste Mann knurrte und schob seinen leeren Becher zur Seite. »Solange die Männer nicht weiterdenken und erkennen, worauf die Geschichte hinauslaufen wird …«
Es dämmerte, als Robert The Trident durch das letzte Stück des Solents, den Seitenarm des Ärmelkanals, führte. Es war bewölkt und stürmisch, und die wogenden Wellen waren graugrün, doch der Wind wehte aus Nordost – perfektes Segelwetter.
Er war schon in aller Herrgottsfrühe aufgestanden und hatte das Schiff in die richtige Position manövriert, damit sie als Erste mit der Flut hinaussegeln konnten. Nachdem sie freie Fahrt gehabt hatten, hatte er in rascher Folge die Segel setzen lassen. Schiffe wie The Trident mussten hart gesegelt werden – mit so vielen Segeln wie möglich. Sie waren dazu geschaffen, über die Wellen zu jagen.
Die Bojen an der Einmündung zum Solent waren nun zu sehen. Sie tanzten auf den hohen Wellen. Robert korrigierte den Kurs. Als die erste Welle des Ärmelkanals das Schiff traf, drehte er das Steuer. Er rief seiner Crew die Änderungen für die Segel zu, als das Schiff krängte, sich gefährlich zur Seite neigte. Die Männer hasteten über Deck, riefen einander Anweisungen zu und richteten die Segel. Dann schoss The Trident in die dunkleren Gewässer des Kanals. Auf dem südlichsten Kurs segelten sie in Richtung Atlantik.
Sobald das Schiff sich wieder gefangen hatte, prüfte Robert noch einmal die Segel. Zufrieden übergab er das Steuerrad an seinen Lieutenant, Jordan Latimer. »Achten Sie darauf, dass das Schiff immer am Limit fährt. Ich komme wieder, wenn der nächste Kurswechsel ansteht.«
Latimer grinste und salutierte. »Aye, aye, Sir. Dann sind wir also in Eile?«
Robert nickte. »Ob Sie es glauben oder nicht, The Cormorant hat den Rückweg in zwölf Tagen geschafft.«
»Zwölf?« Latimer konnte seine Ungläubigkeit nicht verhehlen.
»Royd hat am Schiffsrumpf einen neuen Lack ausprobiert und das Ruder neu eingestellt. Offenbar spart man durch die Veränderungen ein Sechstel der Reisezeit ein, wenn man mit voller Besegelung fährt. Declans Navigator hat berichtet, dass The Cormorant deutlich schneller unterwegs war – selbst auf der Fahrt von Aberdeen nach Southampton.«
Latimer schüttelte verwundert den Kopf. »Ein Jammer, dass wir keine Zeit mehr hatten, um Royd und seine Leute zu bitten, sich um The Trident zu kümmern, bevor wir in See gestochen sind. Wir werden es auf keinen Fall in zwölf Tagen schaffen.«
»Das stimmt.« Robert drehte sich zur Treppe, die auf das Hauptdeck führte, um. »Aber es gibt keinen Grund, es nicht in fünfzehn Tagen zu schaffen, solange wir die Segel nicht einholen.«
Wenn der Wind stabil blieb, würde es ihnen gelingen. Er stieg die Treppe hinunter, lief an der Steuerbordseite entlang, prüfte Knoten, Taljen und Spiere und lauschte dem Knarren der Segel – die kleinen Dinge, die ihn sicher machten, dass mit dem Schiff alles in Ordnung war.
Er blieb am Bug stehen, warf einen Blick zurück und betrachtete das Kielwasser. Unbewusst registrierte er, wie die Wellen sich brachen und welche Neigung der Rumpf hatte. Er konnte nichts bemerken, was ihm Sorgen bereitet hätte, und so drehte er sich um und sah in die Ferne, wo die grauen Wolken aufbrachen und einen blauen Himmel sehen ließen.
Mit etwas Glück würde das Wetter besser sein, wenn sie den Atlantik erreichten. Dann könnte er noch weitere Segel setzen lassen.
Das Schiff hob sich aus dem Wasser, und er hielt sich an der Reling fest. Als das Deck sich wieder senkte, betrachtete er das Meer. Zu seiner Überraschung spürte er eine wachsende Ungeduld. Er wollte, dass diese Mission möglichst schnell erledigt sein würde.
Der Grund dafür war schwer in Worte zu fassen, doch in der vergangenen Nacht, als er in seiner Koje in der großen Kabine im Heck des Schiffes gelegen hatte – einem kalten, einsamen, wenig reizvollen Ort –, hatte er endlich einen kurzen gedanklichen Blick darauf erhaschen können, was die für ihn so untypischen verwirrenden Gefühle befeuerte. Er wollte auch das, was Declan bei Edwina gefunden hatte – das Glück, das Zuhause.
Bis er es mit eigenen Augen gesehen hatte, bis er mitbekommen hatte, wie Declan jetzt lebte, hatte er sich nicht eingestehen können, wie tief das Bedürfnis nach einem eigenen Heim in ihm verankert war. Kurz gesagt, war er neidisch auf das, was Declan besaß, er wünschte sich das Gleiche für sein eigenes Leben.
Schön und gut: Er wusste, was dazu nötig war. Eine Frau. Und die richtige Frau für ihn war definitiv kein funkelnder quirliger Diamant wie Edwina. Er war sich nicht sicher, wie seine Frau sein sollte – er musste sich darüber noch eingehende Gedanken machen –, aber er sah sich selbst als Diplomat, als Mann, der ruhig und zurückhaltend war, und seine Frau sollte das widerspiegeln. Zumindest stellte er sich das so vor.
Leider waren alle Pläne, etwas in dieser Hinsicht zu unternehmen, jetzt erst einmal auf Eis gelegt. Die Mission hatte nun Vorrang.
Und das war der Grund, warum er diesen Auftrag so schnell wie möglich hinter sich bringen wollte.
Robert stieß sich von der Reling ab und ging zum Niedergang. Kurz darauf war er auf dem Unterdeck und machte sich auf den Weg in seine Kabine. Sie war geräumig und sorgfältig mit allem ausgestattet, was für ein angenehmes Leben an Bord nötig war. Der Raum nahm die gesamte Breite des Hecks ein.
Robert nahm auf dem Stuhl an seinem großen Schreibtisch Platz, öffnete eine der Schubladen und zog sein aktuelles Tagebuch hervor.
Tagebuch zu führen war eine Angewohnheit, die er von seiner Mutter übernommen hatte. Zu der Zeit, als sie mit seinem Vater zur See gefahren war, hatte sie jeden Tag notiert, was alles passiert war. Es hatte immer etwas gegeben, das aufzuschreiben sich gelohnt hatte. Als er ein Junge gewesen war, hatte er ihre Tagebücher gefunden und Monate damit zugebracht, sie zu lesen. Die Einblicke, die ihm diese Bücher über das alltägliche Leben an Bord geboten hatten, beeinflussten ihn noch bis heute. Die Wirkung, die sie auf seine Meinung gehabt hatten, dass das Segeln eine Art war, sein Leben zu leben, war einfach unschätzbar, unersetzlich.
Vielleicht würden eines Tages seine Söhne seine Bücher lesen und ebenfalls die Freude erkennen, die dieses Leben bedeutete.
Heute schrieb er in sein Tagebuch, wie dunkel es gewesen war, als sie die Leinen gelöst und den Anlegeplatz hinter sich gelassen hatten, und von der großen Möwe mit dem schwarzen Rücken, die er auf einer der Bojen direkt vor der Mündung in den Hafen hatte hocken sehen. Er hielt kurz inne, ehe er den Federhalter erneut in das Tintenfass steckte und weiter über das Papier gleiten ließ. Er schrieb von seiner Ungeduld, endlich mit der Mission beginnen zu können. Er schilderte auch seine Auffassung davon, was es erfordern würde, sie zu erfüllen. Mit einer schwungvollen Bewegung setzte er den letzten Punkt.
Er legte den Federhalter beiseite und las noch einmal den Eintrag, den er verfasst hatte. Die Tinte war inzwischen getrocknet. Abwesend blätterte er durch die eng beschriebenen Seiten und hielt ab und an inne, um einen alten Eintrag zu lesen.
Irgendwann starrte er ins Nichts. Ihm wurde bewusst, was vor ihm lag. Unwillkürlich fuhr sein Blick zu dem Schrank mit den Glastüren, der in die Wand eingebaut war. Darin standen die früheren Tagebücher, ordentlich aufgereiht.
Die Geschichte seines Lebens.
Sie bedeutete nicht viel.
Jedenfalls nicht im Großen und Ganzen, auf einer breiteren Ebene des Lebens betrachtet.
Ja, er hatte aktiv bei vielen Missionen mitgewirkt, bei denen auch seinem Land geholfen worden war. Meistens waren es diplomatische Vorstöße gewesen. Seitdem er Kapitän eines eigenen Schiffes war, hatte er diplomatische Missionen meistens für sich beansprucht – seine Art, um sich von Royd und Declan abzugrenzen. Royd war zwei Jahre älter als er, Declan ein Jahr jünger. Die beiden waren jedoch Abenteurer durch und durch, Freibeuter mit Leib und Seele. Keiner der beiden würde gegen diese Beschreibung Einspruch erheben. Wenn überhaupt genossen sie es, so angesehen zu werden.
Doch als zweitältester Bruder hatte er schon früh beschlossen, einen anderen Weg einzuschlagen – einen, der genauso gefährlich war, allerdings auf eine andere Art und Weise.
Er würde vermutlich eher ins Gefängnis gesperrt werden, weil er irgendjemanden während eines Essens unabsichtlich beleidigt hatte, seine Brüder würden eines Tages wahrscheinlich wegen einer körperlichen Auseinandersetzung in irgendeiner Seitenstraße verhaftet werden.
Er war schnell mit Worten, seine Brüder waren schnell mit Schwertern und Fäusten.
Nicht dass er nicht mit Schwert und Faust umzugehen wüsste. Er hatte sich gegen drei Brüder durchsetzen müssen – Royd, Declan und Caleb. Das hatte das Überleben unter den Geschwistern gesichert.
Bei dem Gedanken an die Vergangenheit musste Robert unwillkürlich lächeln. Aber er riss sich davon los, kam in der Gegenwart an.
Nach einer kurzen Weile schlug er das Tagebuch zu und legte es zurück in die Schublade. Er erhob sich und machte sich auf den Weg an Deck.
Wenn er bedachte, wie langweilig sein Leben in letzter Zeit gewesen war – er hatte sich eher darum gekümmert zu überleben, als darum, irgendetwas zu erreichen –, war es vielleicht nicht das Schlechteste, dass bei dieser Mission nicht nur seine diplomatischen Fähigkeiten gefordert waren. Es war mal etwas anderes, er würde aus seiner alltäglichen Routine gelockt. Danach konnte er sich dann Gedanken darüber machen, wie er den Rest seines Lebens gestalten wollte.
Dieser Auftrag war eine ganz neue Herausforderung für ihn, ehe er sich einer noch größeren Herausforderung stellen würde.
Er stieg die Treppe zum Deck hinauf. Oben angekommen, spürte er den Wind und hob das Gesicht in die belebende Brise. Er atmete tief durch und blickte auf das aufgewühlte Meer hinaus. Es schien sich endlos vor ihm zu erstrecken – sein Weg in die Zukunft.
Und dieses Mal lag der Weg ganz klar vor ihm.
Er würde nach Freetown reisen, herausfinden, was nötig war, nach London zurückkehren und einen Bericht abliefern. Dann würde er sich eine Frau suchen.
Kapitel 2
»Guten Morgen.«
Miss Aileen Hopkins richtete ihren freundlichen, aber entschlossenen Blick auf das Gesicht des gelangweilt wirkenden schlaksigen Angestellten. Der Mann war an den hölzernen Tresen getreten, der die Grenze zwischen der Öffentlichkeit und den Vorgängen innerhalb des Büros des Marineattachés bildete. Das Büro befand sich in der Nähe der Government Wharf im Hafen von Freetown. Für die Männer an Bord der Schiffe der Kompanie Westafrika war es die Hauptanlaufstelle und die dortigen Mitarbeiter die ersten Ansprechpartner bei Fragen. Die Kompanie hielt sich vor allem in den Gewässern westlich von Freetown auf und war damit beauftragt, das Verbot der Sklaverei, das die britische Regierung verhängt hatte, durchzusetzen.
»Ja bitte, Miss?« Trotz der Frage konnte man dem Angestellten ansehen, dass es ihn im Grunde genommen überhaupt nicht interessierte, was sein Gegenüber von ihm wollte. Seine Miene wirkte unpersönlich, ja sogar ein bisschen mürrisch.
Aileen war es gewohnt, mit bürokratischen Lakaien umzugehen und ließ sich von diesem Verhalten nicht abschrecken. »Ich würde mich gern nach meinem Bruder, Lieutenant William Hopkins, erkundigen.«
Sie stellte ihre schwarze Reisehandtasche auf dem Tresen ab, faltete die Hände und tat ihr Bestes, um dem Mann zu zeigen, dass sie sich nicht so einfach mit irgendeiner Ausrede abspeisen und wegschicken lassen würde.
Der Mann runzelte die Stirn. »Hopkins?« Er sah zu den beiden Kollegen, die an ihren Schreibtischen sitzen geblieben waren und so taten, als wären sie taub, auch wenn sie die Frage in diesem winzigen Büro einfach gehört haben mussten. »Edgar, hör mal her!«, sagte er zu einem von ihnen. Und als der Angesprochene zögerlich den Kopf hob, fragte er: »Hopkins … Ist das nicht der junge Mann, der Gott weiß wohin verschwunden ist?«
Der Kollege warf Aileen einen flüchtigen Blick zu und nickte. »Aye. Seit ungefähr drei Monaten.«
»Ich weiß sehr wohl, dass mein Bruder verschwunden ist.« Es gelang Aileen nicht zu verhindern, dass ihr Tonfall schärfer wurde. »Was ich wissen möchte, ist, warum er an Land war und nicht an Bord der H. M. S. Winchester.«
»Was das betrifft, Miss« – der Angestellte am Tresen klang nun etwas förmlicher –, »dürfen wir Ihnen keine Auskunft geben.«
Sie hielt inne, versuchte zu begreifen, was der Mann soeben gesagt hatte, und erwiderte dann: »Kann ich Ihren Worten entnehmen, dass Sie den Grund kennen, aus dem William, ich meine, Lieutenant Hopkins, an Land war? An Land, obwohl er auf hoher See hätte sein sollen?«
Der Mann straffte die Schultern. »Ich fürchte, Miss, dass wir hier nicht befugt sind, über Details der Aufenthaltsorte von Offizieren im Dienst zu sprechen.«
Aileen konnte ihre Ungläubigkeit nicht verhehlen, sie bemühte sich auch erst gar nicht darum. »Selbst wenn besagte Offiziere verschollen sind?«
Ohne sich umzudrehen sagte einer der Männer, die an ihren Schreibtischen saßen: »Alle Anfragen zu operativen Angelegenheiten sollten an das Marineamt gerichtet werden.«
Aileen verengte die Augen und starrte den Rücken des Mannes an, der gesprochen hatte. Als der Angestellte sich auch jetzt noch nicht umdrehte, erklärte sie in ungerührtem Tonfall: »Bei meinem letzten Besuch dort befand sich das Marineamt noch in London.«
»Korrekt, Miss.« Der Mann hinter dem Tresen erwiderte ihren Blick mit einem harten Ausdruck in den Augen. »Sie werden sich schon dort erkundigen müssen.«
Sie gab sich noch nicht geschlagen. »Ich würde gern mit Ihrem Vorgesetzten sprechen.«
Der Mann antwortete ihr, ohne mit der Wimper zu zucken. »Es tut mir leid, Miss. Er ist nicht im Hause.«
»Wann kommt er zurück?«
»Ich fürchte, das kann ich nicht sagen, Miss.«
»Dürfen Sie auch nicht über seinen Aufenthaltsort sprechen?«
»Das ist es nicht, Miss. Wir wissen es nur einfach nicht.« Nachdem er sie einen Moment lang angeblickt und sicher ihren wachsenden Zorn bemerkt hatte, schlug der Mann vor: »Er ist irgendwo in der Siedlung unterwegs, Miss. Wenn Sie die Augen offen halten, werden Sie ihm vielleicht zufällig begegnen.«
Einige Sekunden lang lag ihr auf der Zunge, was sie dem Mann nur allzu gern an den Kopf geworfen hätte – ihm, seinen Kollegen und auch dem Marineattaché. Sie sollte sich beim Marineamt erkundigen? Das Amt befand sich am anderen Ende der Welt!
Sich bei den Männern für ihre Hilfe zu bedanken, auch wenn es nur sarkastisch gemeint gewesen wäre, erschien Aileen nicht angebracht. Sie konnte die Worte schlicht nicht über die Lippen bringen.
Sie spürte die Wut, die sich mit echter Angst vermischt hatte, in ihrem Innersten hochkochen und warf dem Angestellten, der sie immer noch ansah, einen eisigen Blick zu. Dann nahm sie ihr Handtäschchen vom Tresen, machte auf dem Absatz kehrt und verließ das Büro.
Die Absätze ihrer halbhohen Stiefel klackerten auf den dicken, verwitterten Bohlen des Anlegers. Ihre Schritte trugen sie vom Anleger die Stufen zur staubigen Straße hinauf. Mit wehenden Röcken lief sie ins Gewühl der Water Street.
Kurz bevor sie die Straße erreichte, blieb sie stehen und zwang sich dazu, den Kopf zu heben und einmal tief durchzuatmen. Die Hitze machte das kaum möglich. Aileen spürte, wie ihr Kopf langsam anfing zu schmerzen.
Und jetzt?
Sie war den ganzen Weg von London hierhergekommen, um herauszufinden, wo Will steckte. Sie war fest entschlossen gewesen. Ganz offensichtlich würde die Marine vor Ort ihr nicht helfen … Doch der Angestellte hatte sich irgendwie seltsam verhalten, als sie ihre Vermutung geäußert hatte, dass es einen bestimmten Grund dafür gegeben haben müsse, warum Will an Land und nicht auf See gewesen sei.
Ihre älteren Brüder David und Henry waren ebenfalls bei der Marine. Und beide hatten, wie sie wusste, einige Male an Land gedient – sie waren von ihren Vorgesetzten entsandt worden, um geheime Missionen zu erledigen.
Nicht dass sie oder ihre Eltern damals etwas davon geahnt hätten.
War Will ebenfalls auf eine geheime Mission geschickt worden? War das der Grund dafür, dass er an Land gewesen war?
Und zwar lange genug, um gefangen und vom Feind entführt zu werden?
Aileen runzelte die Stirn. Im nächsten Moment packte sie ihre Röcke und ging weiter. Die Water Street war die Hauptverkehrsstraße von Freetown. Sie musste noch einiges in den Geschäften erledigen, bevor sie sich eine Kutsche nehmen würde, die sie den Tower Hill hinauf und zurück zu ihrer Unterkunft bringen würde.
Während sie einkaufte, gingen ihr unzählige Fragen durch den Kopf.
Wer um alles in der Welt war hier der Feind?
Und wie konnte sie das herausfinden?
»Guten Morgen, Miss Hopkins – Sie waren aber schon früh unterwegs!«
Aileen, die gerade die Haustür zu Mrs. Hoyt’s Gasthaus, einer Unterkunft für vornehme Damen, geschlossen hatte, wandte sich zur Wirtin des Hauses um.
Mrs. Hoyt war eine rundliche, freundliche Witwe und eine schreckliche Klatschbase, die enormen Anteil am Leben ihrer Pensionsgäste nahm. Sie hielt einen Stapel frisch gewaschener Bettwäsche in den Armen und strahlte Aileen an. Mit ihren krausen roten Haaren und ihrem runden Gesicht stand sie im Durchgang zu den Zimmern zur Linken der Eingangshalle, dem gemeinschaftlich genutzten Salon gegenüber.
Aileen konnte Mrs. Hoyt schon recht gut einschätzen und hielt nun ein in braunes Papier eingeschlagenes Päckchen in die Höhe. »Ich musste nur etwas Briefpapier kaufen, um nach Hause zu schreiben.«
Mrs. Hoyt nickte zustimmend. »Gewiss, meine Liebe. Wenn Sie einen Jungen brauchen, der Ihre Briefe zum Postamt bringt, sagen Sie einfach Bescheid.«
»Danke.« Mit einem unverbindlichen Kopfnicken ging Aileen weiter und stieg die Treppe hinauf.
Ihr Zimmer befand sich im ersten Stock. Es war ein reizendes Eckzimmer, das zur Straße hinausging. Spitzengardinen hingen am Fenster und verliehen dem Raum ein bisschen Privatsphäre. Vor dem Fenster stand ein schlichter kleiner Sekretär mit einem Stuhl. Aileen legte ihre Einkäufe und ihr Handtäschchen darauf, zog sich dann die Handschuhe aus, knöpfte ihre Jacke auf und streifte sie ab. Obwohl das Fenster geöffnet war, wehte kaum ein Lüftchen.
Sie zog den Stuhl heran und setzte sich an den Sekretär, packte Papier und Tinte aus und steckte eine Schreibfeder in den Federhalter. Dann machte sie sich direkt an die Arbeit. Sie informierte ihre Eltern, die in Bedfordshire lebten, darüber, wo sie sich aufhielt, und erklärte ihnen, warum sie in Freetown war.
Sie hatte in London eine alte Freundin besucht und einfach die Zeit genossen, als sie eines Tages einen Brief von ihren Eltern erhalten hatte – mit einem offiziellen Schreiben vom Marineamt. In dem Brief hatte gestanden, dass ihr Sohn Lieutenant William Hopkins verschwunden sei und dass man annehme, er sei freiwillig fortgegangen, um im Dschungel nach seinem Glück zu suchen und reich zu werden.
Ihre Eltern waren nach dieser Nachricht verständlicherweise erschüttert gewesen. Aileen selbst hatte die Mitteilung für grotesk gehalten. Zu behaupten, dass ein Hopkins sich heimlich aus dem Staub gemacht hätte, ohne irgendjemandem Bescheid zu geben, war einfach lächerlich! Seit vier Generationen gehörten die männlichen Mitglieder der Familie der Marine an – und zwar mit Leib und Seele. Sie waren Offiziere, und sie betrachteten die Verantwortung, die ihre Stellung mit sich brachte, als eine Berufung.
Aileen wusste genau, wie ernst ihre drei Brüder ihren Dienst nahmen. Zu unterstellen, dass Will sich klammheimlich verdrückt hätte, um sich in ein leichtfertiges Abenteuer zu stürzen, war der reinste Unsinn. Da ihre anderen beiden Geschwister derzeit mit ihren jeweiligen Flotten auf See waren – einer auf dem Südatlantik, einer im Mittelmeer – und Aileen sich in London aufgehalten hatte, hatten ihre Eltern sie gebeten, ein paar Nachforschungen anzustellen und vielleicht herauszufinden, was passiert war.
Sie hatte sich ordnungsgemäß im Marineamt gemeldet. Trotz der langen Verbundenheit der Familie mit der Marine hatte sie dort keine Unterstützung erfahren. Verärgert und außer sich vor Sorge um Will war sie zu einer der Schifffahrtsgesellschaften gegangen und hatte die erstbeste Fahrt nach Freetown gebucht. Sie fühlte sich ihrem jüngeren Bruder verpflichtet, hatte ihn schon als Kind immer beschützen wollen – ein Bedürfnis, an dem sich bis jetzt nichts geändert hatte. Die Reisekosten hatten ihr kein Kopfzerbrechen bereitet, da sie genügend Geld mit nach London gebracht hatte.
Zwei Tage zuvor war sie also in der westafrikanischen Kolonie angekommen. Auf der Überfahrt hatte sie viel Zeit gehabt, um sich einen Plan zurechtzulegen. Obwohl ihr gesellschaftlicher Rang und die Verbindungen ihrer Familie bedeuteten, dass sich mit Sicherheit jemand in Freetown gefunden hätte, der sie während ihrer Suche nach Will unterstützt und ihr eine Unterkunft geboten hätte, hatte sie sich für mehr Zurückhaltung entschieden. Deshalb war sie in Mrs. Hoyt’s Gasthaus gezogen, das auf dem Tower Hill stand. Es befand sich in einer Gegend, in der viele Angehörige der britischen Gesellschaft lebten, lag aber unterhalb des Pfarrhauses. Die Häuser derjenigen, die sich in der einheimischen Gesellschaft bewegten, befanden sich weiter oben auf dem Hügel.
Aileen hatte keine Zeit für gesellschaftliche Besuche. Der einzige Grund, aus dem sie nach Freetown gekommen war, bestand darin herauszufinden, was Will zugestoßen war und ihn wenn nötig zu retten. Sie war von Natur aus neugierig und gewohnt zu kontrollieren, mit ihren immerhin siebenundzwanzig Jahren zudem genauso tüchtig und fähig wie ihre Brüder.
Unterschwellig quälte sie nur das Wissen, dass ihre Eltern sie niemals um Hilfe gebeten hätten, wenn sie nicht als Einzige der Geschwister Zeit gehabt hätte.
Niemand erwartete von den weiblichen Wesen einer Familie, sich irgendwie einzubringen. Ihre Aufgabe war es, dekorativ zu sein, nicht effektiv, eines Tages zu heiraten und sich dann für ihren Mann – vermutlich einen Marineoffizier – um den Haushalt zu kümmern und zu allem Ja und Amen zu sagen. Tief in ihrem Herzen wusste Aileen jedoch, dass es niemals so weit kommen würde. Abgesehen von vielem anderen standen ihr die Lust auf Abenteuer und ihr Temperament im Weg.
Noch während die Feder über das Papier kratzte, spürte Aileen, wie sie die Lippen zu einem kleinen Lächeln verzog. Zu allem Ja und Amen zu sagen war kein Wesenszug, der irgendjemandem als Erstes an ihr einfiel.
Nachdem sie ihre Absicht erklärt hatte herauszufinden, wo Will steckte, widmete sie einige Absätze der Beschreibung der Siedlung und ihrer Unterkunft – damit wollte sie ihre Eltern beruhigen. Schließlich umriss sie kurz, was sie durch ein paar erste Gespräche erfahren hatte.
Am vergangenen Tag, dem ersten, den sie in Freetown verbracht hatte, war sie in einige Tavernen im Hafen gegangen. Sie hatte gehofft, schon ein paar erste Eindrücke sammeln zu können, da sie angenommen hatte, dass sich Marineoffiziere dort zu treffen pflegten. Es gab immer gewisse Etablissements, die bestimmte Gäste anlockten. Für gewöhnlich wäre sie nicht allein in eine Taverne gegangen, aber in Wirtshäusern, in denen sich hauptsächlich Marineoffiziere trafen, gaben ihr die Verbundenheit ihrer Familie mit der Marine und die Tatsache, dass der Name Hopkins in diesen Kreisen durchaus bekannt war, eine gewisse Sicherheit.
Tatsächlich hatte sie einige alte Seeleute getroffen, die ihren Bruder gekannt, die mit ihm zusammen getrunken und sich unterhalten hatten. Sie hatte sich überlegt, dass ihr Bruder sich genau an diese Leute gewandt hätte, um Informationen einzuholen, wenn er auf eine Mission geschickt worden war, die die Siedlung betraf.
Und sie hatte sich nicht geirrt. Laut der alten Seebären hatte Will kurz vor seinem Verschwinden Fragen gestellt, die sich vor allem um zwei Dinge gedreht hatten. Zum einen hatte er sich nach einem Armeeoffizier namens Dixon erkundigt, der in Fort Thornton stationiert gewesen war, auf dem Tower Hill. Das war im Grunde schon überraschend genug, doch Will hatte sich darüber hinaus auch noch für einen einheimischen Priester interessiert, der in der Siedlung Messen abhielt. Offenbar hatte ihr Bruder an einigen dieser Messen teilgenommen.
Von all ihren Brüdern kannte Aileen Will am besten. Dass er freiwillig eine Messe besucht hatte, bedeutete, dass er aus einem bestimmten Grund gegangen war, der nichts mit Religion zu tun hatte.
Sie hob den Federhalter und las noch einmal alles durch, was sie geschrieben hatte, entschied sich dann gegen ihre ursprüngliche Absicht, auch zu schreiben, dass sie vorhatte, Will zu retten. Es gab keinen Grund, die Ängste ihrer Eltern noch weiter zu schüren. Sie beendete den Brief mit dem Versprechen, sich bald wieder zu melden.
Während sie Sand auf die feuchte Tinte schüttete und ihr Schreiben schließlich versiegelte, grübelte sie über ihre Optionen nach. Sie legte den Brief zur Seite und warf einen Blick auf die Uhr, die auf dem Kaminsims stand. Dann erhob sie sich und ging zu der niedrigen Kommode, die als Frisiertisch diente. In dem Spiegel, der darüber angebracht war, betrachtete sie sich und löste gedankenversunken ihr hochgestecktes Haar.
Was für ein Bild die Angestellten im Büro des Marineattachés von ihr bekommen haben mussten, als sie sie aufgesucht hatte: eine behütet aufgezogene englische Lady mit blassem Teint und rosigen Wangen. Ihr Gesicht war oval, ihre Nase unauffällig. Ihre strahlenden braunen Augen waren das Schönste an ihr. Sie waren groß und von langen braunen Wimpern umrahmt. Ihre Augenbrauen waren wundervoll geschwungen. Andere Damen hätten diese Vorzüge bestimmt bewusster eingesetzt, doch sie dachte oft nicht einmal daran. Ihre Lippen waren ganz annehmbar – rosa und voll –, aber sie presste sie viel zu oft energisch zusammen. Ihr Haar hatte eine angenehme, jedoch ungewöhnliche Farbe – es war kupferbraun. Für gewöhnlich fiel es in glänzenden Wellen über ihren Rücken, doch im Moment kräuselte es sich aufgrund der unbarmherzigen Luftfeuchtigkeit fast so schlimm wie das von Mrs. Hoyt.
Nachdem sie die Haarnadeln herausgezogen hatte, bürstete Aileen ihr Haar mit grimmiger Entschlossenheit. Schließlich steckte sie es zu einem ganz passablen Knoten hoch. Sie legte die Bürste zur Seite, drehte den Kopf und betrachtete ihr Werk im Spiegel. Dann nickte sie sich zu. Das würde schon gehen, um dem Reverend und seiner Gattin im Pfarrhaus einen Besuch abzustatten.
Sie strich ihren Rock aus elfenbeinfarbener Baumwolle glatt und zog ein passendes Jäckchen an. Da es allerdings noch immer fürchterlich heiß war, ließ sie es offen, sodass man ihre adrette weiße Bluse darunter sehen konnte. Rasch nahm sie ihr Handtäschchen und den Brief und ging zur Tür.