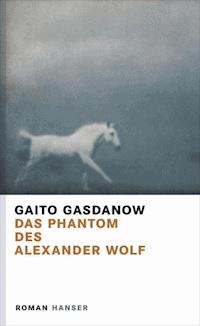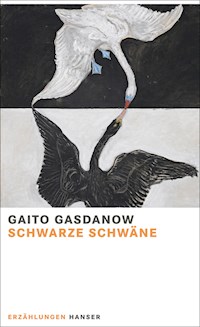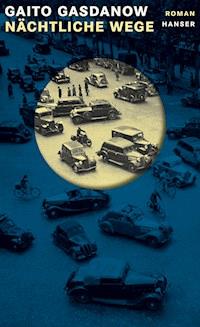Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
„Henri Dorin, mein Vater, wurde geboren, um glücklich zu sein“, schreibt der fünfzehnjährige André in sein Tagebuch. Er selbst, der die Mutter bei der Geburt verlor, scheint weniger begabt für das Glück. Aber was wird aus dem besonderen Talent seines Vaters, wenn ihn ein schwerer Schicksalsschlag, Krankheit oder ein Treuebruch, trifft? Während der noch nicht dreißigjährige Gasdanow, aus Russland emigriert, in Paris sein Geld als Taxifahrer verdiente, schrieb er diese Meisternovelle, die 1932 erstmals erschien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gaito Gasdanow
Glück
Deutsch von Rosemarie Tietze
André Dorin, ein blasser Junge von fünfzehn Jahren, saß allein im Haus seiner Eltern in Sainte-Sophie, vierzig Werst vor Paris. Seine Stiefmutter befand sich, wie immer zu dieser Jahreszeit, in Cannes; sein Vater war morgens nach Paris gefahren und hatte gleich gesagt, mit dem Abendessen solle nicht auf ihn gewartet werden, und das bedeutete, dass er nachts zurückkehren, André aufwecken und mit seiner ruhigen und glücklichen Stimme, die André so liebte, zu ihm sagen würde:
»Oh, du schläfst? Steh auf, setz dich ein wenig zu mir. Erst frönen wir dem Alkohol, dann erzähle ich dir ein paar hochinteressante Geschichten.«
Er würde André nötigen, den Pyjama überzuziehen und ins Esszimmer zu kommen, würde Kaffee kochen, vorsichtig ein paar Tropfen Rum in die Tassen träufeln und André eine Unmenge unwichtiger Dinge erzählen, die ihm albern und komisch erschienen; dann würde er aus seiner braunen Mappe ein in Leder gebundenes Buch hervorholen, würde es André geben und dazu bemerken:
»Dieses Buch habe ich ganz zufällig gefunden. Weißt du noch, du sprachst davon, dass du es haben möchtest? Stell dir vor, ich gehe die Champs-Élysées hinunter, da sehe ich ein leeres Automobil stehen, und darin liegt dieses Buch. Mein Gott, denke ich mir, gerade davon hat doch mein Sohn gesprochen, so ein glücklicher Zufall. Ich öffne den Schlag des Automobils, greife nach dem Buch, stecke es in die Mappe und entferne mich unbemerkt. Verstehst du, was für ein Glücksfall? Bloß darfst du es, bitte, niemandem zeigen. Es enthält sogar eine Art Widmung.«
Und im Buch würde in der gleichmäßigen väterlichen Handschrift geschrieben stehen: »À ne pas lire la nuit, s.v.p.«1
Henri Dorin, Andrés Vater, hielt seinen Sohn aus Gewohnheit noch für einen kleinen Jungen und redete mit ihm meistens, als wäre er neun oder zehn Jahre alt. Im übrigen wusste er, dass André viel zu reif war für sein Alter, er sah es an den Büchern, die André las, an Andrés Fragen und Bemerkungen, die ihm ungewöhnlich vorkamen im Mund seines kleinen Sohnes, den er ja vor kurzem noch auf den Schultern getragen, dem er Märchen erzählt, für den er stundenlang bereitwillig Grimassen geschnitten und sich ungeheuer angestrengt hatte, nur damit André einmal lachte. Aber André lachte außerordentlich selten. Immer häufiger dachte Henri Dorin, dass André, je älter er wurde, desto mehr seiner verstorbenen Mutter glich, Dorins erster Frau, die er nicht vergessen konnte. Als Dorin sie kennenlernte, war sie neunzehn gewesen, obwohl sie eher aussah wie fünfzehn. Sie trug stets weiße Kleider, ging leicht und lautlos, und Dorin sagte zu ihr, sie ähnele einem jener Tagesgespenster, die auf der Welt ebenso selten seien wie weiße Amseln. Sie kränkelte häufig; und obwohl sie nie über etwas klagte, außer über erhöhte Empfindsamkeit, brachte Dorin sie zu einem bekannten Professor, der ihm eröffnete, seine Frau sollte ein Kind haben, danach wäre ihr gesamter Organismus wie neu geboren. »Hättest du gerne einen Sohn?«, fragte Dorin sie einige Tage danach. Sie kniff die Augen zusammen und nickte bestätigend. Dorin wusste damals nicht, dass es für sie das Todesurteil sein sollte.
In der Nacht der Entbindung, als ein anderer Arzt mit strengem Blick auf Dorin sagte, man müsse geistesgestört sein, um auf einen günstigen Ausgang zu hoffen, schließlich sei sie noch ein kleines Mädchen, da war Dorin völlig von Sinnen. Von dem Augenblick an, als sie, es war spätabends, in die Klinik gebracht wurde, schritt er bis in die ersten Stunden des Sommermorgens vor dem Gebäude in Saint-Cloud, wo sie lag, auf engem Raum auf und ab – er fürchtete sich hineinzugehen und konnte doch nicht fortgehen; gleichmäßig brannte im Vorraum hinter der Glastür das Licht, das Haus war still, ringsum war alles unbeweglich und verstörend – und sein endloses Warten dauerte bis zum Morgen, als man ihm sagte, seine Frau sei gestorben. Er nickte, steckte die Hände in die Taschen und ging, vergaß sogar zu fragen, ob das Kind am Leben sei; wieder zu sich kam er erst drei Tage später, als im Stadtteil Ménilmontant ein Polizist ihn aufweckte und aufs Revier brachte. Der Polizist sagte, er habe diesen Mann schlafend auf einer Bank angetroffen, und da er kein Geld bei sich hatte, nicht einmal Papiere, habe er ihn wegen Herumtreiberei festgenommen.
»Wie ist dein Name?«, fragte der Kommissar und musterte Dorins verdreckten, zerknitterten Anzug und die aufgeplatzten Schuhe. Erst in diesem Moment begriff Dorin, dass seine Frau tot war, und brach zum ersten Mal in Tränen aus.
»Du willst deinen Namen nicht sagen?«, fuhr der Kommissar fort. »Offenbar hast du genügend Gründe, ihn zu verheimlichen, das verstehe ich sehr gut.«
»Sie verstehen überhaupt nichts«, entgegnete Dorin. »Mein Name ist Dorin, ich bin kein Herumtreiber und kein Verbrecher. Rufen Sie in meinem Pariser Büro an und verlangen Sie den Geschäftsführer.«
»Merken Sie sich, falls das ein Scherz ist«, erwiderte der Kommissar misstrauisch, »werden Sie mir noch bedauern, dass Sie gescherzt haben.«
Im Büro rief er allerdings an.
»Monsieur Dorin ist bei Ihnen?«, schrie eine bestürzte Stimme im Telefon.
»Er wird gleich mit Ihnen sprechen«, antwortete der Kommissar und reichte Dorin den Hörer. Dorin ordnete an, man solle ihm das Automobil schicken; und zwanzig Minuten später riss der Chauffeur vor dem unrasierten Mann in der schmutzigen Kleidung den Schlag des schweren sechssitzigen Wagens auf, nahm die Mütze ab, verbeugte sich und sagte wie immer:
»Bonjour, monsieur.« Mit verwirrter und zugleich befriedigter Miene winkte der Kommissar zum Abschied.
Zu Hause nahm Dorin ein Bad, rasierte sich und zog sich frisch an, dann ließ er die Haushälterin kommen, die ihm berichtete, man habe Madame auf dem Père-Lachaise beerdigt und der Sohn befinde sich in dem Zimmer, das der Amme zugeteilt worden war. Nun erblickte Henri Dorin zum ersten Mal André. Der Junge war klein und wog knapp drei Kilo. ›Alles, was sie konnte‹, dachte Dorin, ›alle ihre zarten Kräfte hat sie diesem Kind gegeben, und das kostete sie das Leben.‹
Damals hatte er die Vorstellung, er würde seine Zeit gänzlich dem Sohn widmen; der Gedanke, er könnte ein zweites Mal heiraten, kam ihm nicht in den Sinn, obwohl er erst sechsundzwanzig war. Viele Jahre lebte er tatsächlich allein im Gedanken an den Sohn. Doch in dem Maße, wie André heranwuchs, spürte Dorin, dass die elementare, körperlich empfundene Liebe zum Sohn von einem anderen, nicht weniger starken Gefühl abgelöst wurde, das nicht mehr die Heftigkeit jener ersten Zeit besaß, als jede Bewegung von Andrés kleinem Körper sein Herz rührte. Und obwohl er den Sohn weiterhin so zu lieben schien wie eh und je, öffnete er sich in den kommenden Jahren erneut für andere Gefühle – und zum ersten Mal während dieser ganzen Zeit fiel ihm auf, dass er noch nicht alt, dass er reich und im Grunde fast glücklich war. André war ein kluger Junge, ein guter Schüler und derart aufs Lesen versessen, dass Dorin, der ungewöhnlich fest schlief, sich extra einen Wecker kaufte und ihn auf zwei Uhr nachts stellte, um aufzuwachen und in Andrés Zimmer zu gehen; er fand den Sohn im Bett mit einem Buch in der Hand. »So, so, Monsieur«, sagte er, »Monsieur lesen noch?« Er nahm ihm das Buch aus der Hand, küsste ihn auf die Stirn und ging – und erst dann schlief André ein.