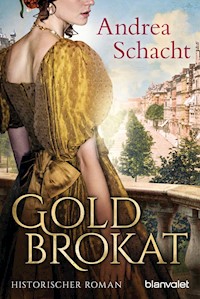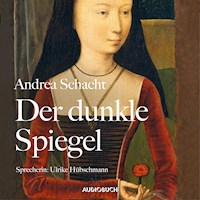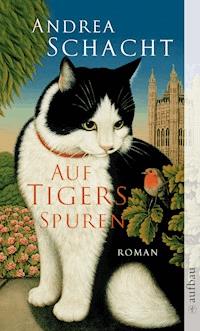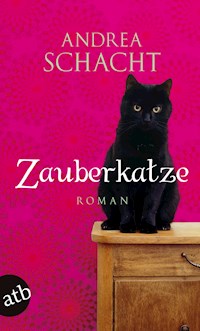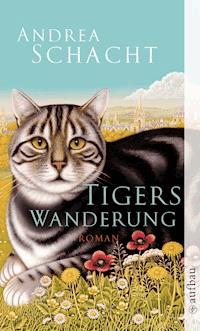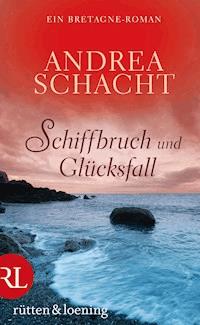Inhaltsverzeichnis
Widmung
Die Raupe
Rückkehr aus dem Nirwana
Zerrissene Seide
Schmerz und Belohnung
Ein Wink mit dem Fächer
Hundertfaches Begehren
Auf hoher See
Copyright
Für Dr. Rainer Schöttle,der aus meinem Wortgewebefürsorglich die Webfehler entfernt.
Ein seidenes Kleid, von Raupen gesponnen Schmetterlingsopfer.
Die Raupe
Träg und matt, auf abgezehrten Sträuchen,Sah ein Schmetterling die Raupe schleichen;Und erhob sich fröhlich, argwohnfrei,Daß er Raupe selbst gewesen sei.
Johann Gottfried Herder, Die Raupe und der Schmetterling
Als der linde Frühlingswind durch die austreibenden Maulbeerbäume strich, schlüpfte die winzige, schwärzliche Seidenraupe aus ihrem Ei. Sie folgte gleich darauf ihrem untrüglichen Instinkt und begann, die saftigen Blätter zu fressen, die in ihrer Nähe ausgebreitet lagen. Nicht die goldenen Sonnenstrahlen, die durch die Ritzen der hölzernen Wand fielen, beachtete sie, nicht die leisen Stimmen der geschäftigen Frauen, die ihnen die klein geschnittene Nahrung darboten, nicht das zarte Rascheln, mit denen ihre Artgenossen durch das junge Grün krochen. Fünf Tage fraß sie und fraß und fraß, bis sie schließlich in Erstarrung verfiel. Sie hatte so viel an Gewicht zugenommen, dass sie ein neues Gewand benötigte, und so legte sie nach einem Tag völliger Ruhe die alte Haut ab - und fraß weiter.
Nun war sie hellgrau geworden und noch viel hungriger. Nicht nur Blätter, auch die jungen Reiser der Maulbeerbäume schmeckten ihr. Bis sie wieder müde wurde und eine neue Haut benötigte. Mit frischem Mut fiel sie nach dem Erwachen über immer größere Portionen her, gefräßig, gierig, rastlos Blätter zermalmend, verdauend, wachsend.
Noch zweimal legte sie die beengende Haut ab, bis ihr Körper fast durchscheinend weiß war. Seit sie vor einem Monat geschlüpft war, hatte sie um das Zehntausendfache an Gewicht zugenommen und nun das Stadium erreicht, in dem sie nach einer weit größeren Ruhe als nur der kurzen Starre der Häutung verlangte.
Sie verlor das Interesse an der Nahrung und kroch über die hölzernen Hürden, um sich einen gemütlichen Platz zu suchen. Als sie ihn zwischen den dünnen Ästchen gefunden hatte, erzeugte sie mit der klebrigen Flüssigkeit, die nun aus ihrem Maul austrat, zwei Fäden und befestigte sie an den Reisern, um Halt für die nächste Stufe ihrer Entwicklung zu finden. Dann spann sie mit gleichmäßigen Drehungen den schier endlosen Faden um sich herum.Vier Tage arbeitete sie unermüdlich, dann versank sie erschöpft in den Schlaf, um das Wunder zu vollziehen.
So begann die Wandlung vom erdgebundenen, kriechenden Geschöpf in einen Falter, und als er schließlich den seidenen Kokon verließ, breitete der Schmetterling seine Flügel aus. Unbeschwert schwang er sich in die lichten Höhen, tanzte im Sonnenlicht über den blühenden Bäumen und begab sich auf die Suche nach seiner Partnerin.
Rückkehr aus dem Nirwana
Ein Opfer zu bringen bringt Heil.Wird die Schale umgekehrt,wird sie von Unrat entleert.
Demütiges Empfangen führt zu Erfolg. I Ging,Ting - die Opferschale
Als er aus der unendlichen Schwärze auftauchte, webten die Klänge der Bronzeglocken einen Kokon aus sanften Tönen um ihn. Mit einem warmen Wind schwebte Kiefernduft durch den Raum, wo er sich mit einem Hauch von süßem Weihrauch mischte. Wunderbar körperlos fühlte er sich, losgelöst von Vergangenheit und Zukunft, eingebettet in das vollkommene Sein.
Er wäre gewiss zufrieden auf immer hier geblieben. Doch da begann sein Wille einen Faden zu spinnen, und an diesem dünnen Fädchen entlang entstand das Begehren. Es erwachte damit auch das Verlangen und mit ihm der Wunsch zu wissen, wo er sich befand.
Der Wille erstarkte und befähigte ihn, die schweren Lider zu heben, um die Welt durch das Tor seiner Augen in sein Bewusstsein eintreten zu lassen.
Ein heller Raum, lichtdurchflutet. Ein Mann in einer groben, braunen Robe neben ihm. Sein haarloser Schädel glänzte wie eine polierte Haselnuss, sein breitflächiges Gesicht trug den Ausdruck unendlicher Ruhe. Regungslos saß er an seinem Lager, nur seine Augen waren beharrlich auf ihn gerichtet. Schwarze, unergründliche Augen, hinter denen er Wissen und Stille erahnte.
Der Wille reichte nicht aus, um Worte zu formen, doch der Mann schien seine Gedanken lesen zu können.
»Ihr seid im Hanshan-Kloster, baixi long. Seit drei Tagen. Ihr habt zu viel Opium gegessen und seid krank geworden.«
So genau hatte er es nicht wissen wollen, denn es erinnerte ihn an vergangene Schmerzen. Er schloss die Lider wieder, doch der Mönch erhob sich mit leise wispernden Gewändern und richtete ihn an den Schultern auf.
»Trinkt, baixi long. Der Saft der Maulbeeren wird Euch reinigen.«
Schlucken war anstrengend, ein Teil des Saftes floss ihm aus den Mundwinkeln, doch die süßsaure Flüssigkeit schwemmte das Moos aus seinem Mund. Dann durfte er wieder liegen, ruhen und dem Klanggewebe der Glocken lauschen. Gefangen in den hallenden Tönen zog sich nach und nach sein Geist zurück aus dem hellen Raum der Gegenwart in die dunklen Gefilde seines Bewusstseins. Es war nicht Schlaf, es war nicht Traum, es war nicht mehr das körperlose Treiben im Sein. Es war das Versinken im bitteren Meer der Erinnerung.
Die waren die Schreie, mit denen seine Pein begann. Die entsetzlichen Schreie, die das Krachen und Knastern des brennenden Holzes übertönten. Die Schreie, aus unglaublicher Qual geboren, stachen wie Dolche in seine Sinne. Wieder spürte er die Hitze der Flammen, die gierig an dem Balken emporleckten, der vom Dach der Lagerhalle gestürzt war. Ein weiterer Stoffballen entzündete sich neben ihm mit einem Puffen, und das ihn verzehrende Feuer erhellte mit seinem gespenstisch zuckenden Licht die Umgebung. Er war gelähmt, hilflos, seine Augen tränten vom Rauch, das Luftholen ging nur keuchend schwer. Der Geruch von brennender Seide und verbranntem Fleisch breitete sich aus.
Erst die lauten Befehle seines Paten weckten ihn aus der Erstarrung. Mit bloßen Händen versuchte er, ihm zu helfen, den glosenden Balken anzuheben, unter dem sein Bruder gefangen lag. Er war zu schwer, viel schwerer, als dass ein Erwachsener und ein Junge ihn hätten bewegen können.
Vielleicht, vielleicht aber hätten sie es doch schaffen können. Die Angst um den Verletzten, dessen qualvolles Schreien, die wüsten Flüche seines Paten setzten ungeheure Kräfte in ihm frei. Er spürte die Brandwunden an seinen Händen nicht, hörte den eigenen röchelnden Atem nicht, ignorierte das Brennen in der Lunge. Er kämpfte um das Leben seines Bruders.
Aber plötzlich wurde ein Tor geöffnet, und das Feuer atmete die einströmende Luft mit einem gewalttätigen Aufbrausen ein.
Die Schreie erstickten.
Er wurde an den Schultern gepackt und aus der Halle gezerrt.
Kühle Nachtluft umfing ihn, er wollte zusammenbrechen. Doch unbarmherzig wurde er gestoßen und gedrängt, bis er in einer Türnische niederfiel.
Donnernd stürzte das hölzerne Gebäude hinter ihm ein, ein Funkenregen ging nieder. Stichflammen zuckten gen Himmel. Über das Bersten und Krachen hinweg aber ertönten Schüsse. Jäger und Gejagte hetzten durch die Straßen, fielen, schrien, bluteten, starben vor seinen entsetzten Blicken auf dem Pflaster. Schwarzer, öliger Rauch hüllte die Gasse ein, hustend, würgend schwankte er auf den Knien, schloss verzweifelt die brennenden Augen, doch hinter den Lidern sah er nur wieder das Gesicht seines Bruders, von Schmerz entstellt.
Sein Pate versuchte, ihn mit seinem eigenen Körper vor der Gewalt auf der Straße abzuschirmen, und verfluchte dabei mit rauer, geschundener Stimme seinen Geschäftspartner, der feige geflohen war, statt ihnen zu helfen.
»Er wird dafür bezahlen, dafür werde ich sorgen. Dafür wird er selbst im schreienden Wahnsinn sterben, das schwöre ich. Und wenn es die letzte Tat in meinem Leben ist«, hörte er ihn heiser flüstern.
Und noch immer sah er das Gesicht seines sterbenden Bruders.
Er erblickte es jetzt wieder, doch allmählich verschwand die Pein daraus, und die Züge glätteten sich. Ignaz lächelte ihn unbeschwert an, so, wie er es oft getan hatte, wenn sie gemeinsam die Abenteuer ihrer Zukunft planten. Dann aber entfernte er sich mehr und mehr, schien sich in einen Nebel zu hüllen und verschwand in der Dunkelheit.
»Ja, ich komme zu dir, bald«, versprach der Mann im Kloster dem sich entfernenden Geist. »Ich bin bereit, Ignaz. Ich komme zu dir. Doch für mich wird es leichter sein, über die Schwelle zu treten, als für dich.«
In diesem Moment begannen die Krämpfe wieder, die seine Eingeweide zu verknoten, mit ihren Klauen zu zerfetzen und in Stücke zu reißen drohten, und er erkannte, dass er sich getäuscht hatte.
Das Schicksal hatte keinen leichten Tod für ihn vorgesehen.
Zerrissene Seide
Mädchen! Schlingt die wildesten Tänze,reißt nur euren Kranz entzwei!Ohne Furcht, denn solche KränzeFlicht man immer wieder neu.
Eduard Mörike
Wir hatten uns heimlich davongemacht, Madame Mira, Philipp, Laura und ich. Weil Tante Caro den Besuch des Mülheimer Sommertheaters auf gar keinen Fall gebilligt hätte. Das war nämlich keine kulturell hochstehende Veranstaltung, auf der sich die gelangweilten Mitglieder der haute volée bei getragenen Klängen eines Kammerorchesters oder den pathetisch deklamierten Werken unserer Dichterfürsten amüsierten. Nein, es war Unterhaltung für Dienstmädchen und Arbeiter, für fesche Soldaten und stramme Wäscherinnen. Und für Kinder. Hier spielte in einem Pavillon am Rheinufer das preußische Musikkorps mitreißende Märsche, recht derbe Schwänke entlockten dem Publikum begeistertes Johlen, leicht bekleidete Tänzerinnen brachten die männlichen Zuschauer zum Schwitzen. Oder zum Pfeifen. Je nachdem, in welcher Begleitung sie sich befanden.
Madame Mira begutachtete die beweglichen Damen auf der Bühne fachmännisch, meine siebenjährige Tochter hingerissen, der achtjährige Philipp hingegen schenkte seine Aufmerksamkeit lieber dem taumelnden Kreisel eines anderen Jungen. Mir kam das Gehüpfe ein wenig dilettantisch vor, aber es war vermutlich weniger die Kunstfertigkeit des Tanzes als die possierliche Darstellung halb entblößter, in der guten Gesellschaft nicht erwähnbarer Körperteile, die den Reiz dieser Vorführung ausmachte.
Dennoch, der Ausflug war ein Gewinn für uns alle. Er war Madame Miras Wunsch zu ihrem zweiundsiebzigsten Geburtstag, den ich ihr nur zu gerne erfüllt hatte. Sie genoss das bunte, laute Treiben, die klebrig süße Limonade und den Streuselkuchen genau wie meine Kinder. Die beiden aber betrachteten die Fahrt mit dem Dampfschiff von Köln nach Mülheim als den Höhepunkt des Genusses, und die Rückfahrt stand nun noch bevor. Ganz konnte ich dieses Vergnügen nicht teilen, Dampfmaschinen weckten in mir ein vages Unbehagen. Auch wenn Philipp mir die Arbeitsweise präzise erklärt hatte. Mochte der Himmel wissen, woher er seine Kenntnisse hatte. Aus der Elementarschule sicher nicht. Selbst Laura hatte er schon mit seiner Begeisterung für rußende Schlote, rotierende Schwungräder und dampfende Kessel angesteckt. Sehr zu Tante Caros Missfallen, die dieses Sujet als ein für Mädchen höchst ungeeignetes ansah.
Ich hingegen verbat es Laura nicht, sich über die Dampfkraft kundig zu machen. Mir hatte man als Kind auch nie untersagt, mich mit all den Themen zu beschäftigen, die mein Interesse weckten.Vermutlich war das die Ursache allen Übels, das dann später über mich hereinbrechen sollte.
Aber darüber nachzudenken verbot der heutige Tag. Der strahlend schöne Julinachmittag neigte sich dem Abend zu, und es war an der Zeit, die Heimreise anzutreten. Madame Mira erklärte sich bereit, mit den Kindern zur Anlegestelle zu gehen, während ich - je nun, die Limonade verlangte ihr Recht. Zu diesem Behufe jedoch gab es keine passenden Räumlichkeiten, aber ich hatte die Dienstmädchen auch schon mal heimlich in die Büsche verschwinden sehen. Da ich für diesen Ausflug selbstredend auf die Krinoline verzichtet hatte, tat ich es ihnen nach und suchte den schmalen Pfad in das dichtbelaubte Uferdickicht.
Auf meinem Rückweg stolperte ich über ein rotes Seidenkleid im grünen Laub.
In dem von weiten Reifen ausgebreiteten Rock kauerte eine Dame, die sich bemühte, ihr Mieder mit den Händen zusammenzuhalten, wobei sie leise, aber unmissverständlich undamenhafte Worte murmelte. Sie blickte auf, als sie mich bemerkte, und ein hoffnungsvoller Blick lag in ihren Augen.
»Sie haben nicht zufällig eine Sicherheitsnadel dabei, die Sie mir leihen könnten?«
»Nein, eine Sicherheitsnadel nicht, aber Nadel und Faden sind meine ständigen Begleiter.Wenn Sie mir ein paar Schritte weiter aus diesem - ähm - stillen Örtchen folgen wollten, könnte ich das Problem rasch beheben.«
Nähzeug hatte ich immer im Retikül, ich kannte ja meine Kinder. Ich reichte der Dame meinen Schal, sodass sie ihr zerrissenes Dekolleté bedecken konnte, und führte sie hinter den nahegelegenen Kuchenstand, wo wir einigermaßen ungestört das Flickwerk vollbringen konnten.
Das Kleid war nicht von feinster Seide und auch nicht besonders sorgfältig genäht, aber selbst eines von besserer Qualität hätte wohl dem brutalen Angriff nicht standgehalten. Das Mieder war vorne bis zur Taille aufgerissen, und da die Besitzerin über eine nicht unbeträchtliche Oberweite verfügte, würde es schwierig werden, es zu reparieren. Mein gelber Organzaschal, schon reichlich geschlissen, mochte jedoch helfen, wenngleich die Farbkombination zu dem leuchtenden Rot recht grell wirkte. Mit einigen Handgriffen drapierte ich ihn so, dass er den Ausschnitt umgab und das klaffende Mieder verdeckte. Die Stiche, die ich machte, um ihn zu befestigen, waren flüchtig, aber für die Ewigkeit sollte dieses Provisorium ja auch nicht halten.
»Meine Güte, was sind Sie geschickt, Fräulein. Sind Sie Näherin?«
»So ähnlich. Halten Sie bitte still, gnädige Frau, sonst pieke ich Sie.«
»Die Gnädige können Sie sich sparen.Wäre ich eine, wäre mir das hier nicht passiert.«
»Mhm.«
»Diskret auch noch? Sie sind ein erstaunliches Geschöpf. Und Sie haben mir Ihren hübschen Schal geopfert. Geben Sie mir bitte Ihre Adresse, damit ich ihn Ihnen ersetzen kann.«
»Das ist nicht der Rede wert, Madame.«
»Doch, ist es, und Madame passt auch nicht so ganz.Wie heißen Sie, Fräulein?«
»Ariane Kusan«, stellte ich mich vor und bemerkte ein kurzes Zucken ihrer Lider. Sie sagte jedoch nichts, sondern wühlte in ihrem Täschchen und förderte eine Visitenkarte hervor.
Ich nahm sie entgegen, warf einen Blick darauf und vernähte dann den Faden. Mit der kleinen Verblüffung in ihrer Miene hatte ich mich wohl getäuscht. Woher sollte sie mich kennen? Ich hatte sie zumindest noch nie gesehen, und auch ihr Name sagte mir nichts. Darum schnitt ich den Faden ab und sagte: »Eh voilà, Frau Wever, fertig. Und jetzt muss ich mich beeilen, denn sonst schaffe ich es nicht mehr, auf das Mülheimer Bötchen zu kommen.«
Was keine faule Ausrede war. Ich musste tatsächlich die Röcke raffen und den Weg zur Anlegestelle in höchst unschicklicher Geschwindigkeit zurücklegen.
Madame Mira und die Kinder waren schon an Bord, als ich mich leise schnaufend zu ihnen gesellte.
»Was ist passiert, Ariane?«
»Eine Jungfer in Nöten. Oder so ähnlich.«
Ich reichte Madame Mira die Karte und berichtete von dem zerrissenen Seidenkleid.
»Ein allzu animierter Begleiter offensichtlich, den die Glut alle Schicklichkeit vergessen ließ.«
»Der jedoch seine Angebetete in einer unangenehmen Lage verlassen hat. Nun, LouLou Wever wird mit dergleichen Aufmerksamkeiten umzugehen wissen.«
»Sie kennen die Frau?«
»Vom Hörensagen. Sie ist eine stadtbekannte Kokette und nicht der Umgang, den Sie Ihrer Tante gegenüber erwähnen sollten, Liebelein. Aber es war sehr freundlich von Ihnen, ihr zu helfen.«
Manchmal verwendete Madame Mira recht eigenwillige Bezeichnungen, und ich grübelte, was wohl in ihren Augen eine Kokette war. Die Möglichkeiten konnten sich zwischen etablierter Bordellbesitzerin und einer geschiedenen Frau bewegen. Die Adresse auf der Visitenkarte war gutbeleumundet, in der Schildergasse waren die Wohnungen nicht billig.
»Nun ja, mich hielt sie für eine Näherin«, sagte ich und steckte die Karte sorgsam weg.
»So sehen Sie heute ja auch aus. Dieses Kleid ist scheußlich.«
»Ich weiß, aber nützlich. Man sieht die Marmeladen- und Limonadenflecken nicht so deutlich. Ich hoffe nur, Tante Caro hält sich bis in die Abendstunden bei ihrer lieben Freundin Belderbusch auf, damit ich ungesehen in mein Zimmer schlüpfen kann.«
Das verwaschene Barchentkleid hatte im Laufe der Jahre den größten Teil seiner blauen Farbe eingebüßt, und selbst die rotbraunen Satinbänder, die ich an Ausschnitt und Ärmel genäht hatte, konnten nicht über den fadenscheinigen Saum und manche Flecken im Rock hinwegtäuschen.
»Sie wird zum Essen bleiben, keine Sorge.«
Madame Mira grinste mich an, und ich nickte. Ein exquisites Essen schlug meine Tante nie aus. Warum auch, wir konnten uns schließlich nur schlichte Mahlzeiten leisten. Nicht, dass wir Hunger leiden mussten, aber für Lendenbraten oder Entenbrust reichte das Haushaltsgeld nicht.
Ein Umstand, den wir tunlichst zu verbergen trachteten.
Denn Tante Caro legte Wert darauf, in den höchsten Kreisen der Kölner Gesellschaft zu verkehren. Und darum galt es, eine makellose Fassade aufrechtzuerhalten.
Schmerz und Belohnung
Sein Mund wird blau, sein Antlitz fahl,In Stücke reißt er seinen Schal.
Ferdinand Freiligrath, Die seidne Schnur
Guillaume de Charnay bemühte sich gar nicht erst, das wilde Zucken in seiner linken Wange zu verdecken. Es setzte, wie er in seinen fünfundfünfzig Lebensjahren gelernt hatte, immer dann ein, wenn große Gemütsbewegungen in seinem Inneren tobten. Sie waren das einzige äußere Zeichen seiner Wut, das er sich gestattete.
Diese Schlampe hatte es gewagt, sich ihm zu widersetzen. Ja, tatsächlich hatte sie ihm sogar mit bösartiger Gemeinheit das Knie zwischen die Beine gerammt. Darum hatte er sich auf eine schattige Bank setzen müssen, bis er wieder in der Lage war, aufrecht zu gehen. Hier am Rheinufer ebbte der Schmerz allmählich ab, und er schenkte den Flaneuren seine beiläufige Aufmerksamkeit. Das Dampfschiff von Köln hatte angelegt, und die Fahrgäste, die sich von ihm auf die andere Rheinseite zurücktragen lassen wollten, tröpfelten nach und nach ein. Ein schäbiges Völkchen war es, das sich hier bei dem Sommertheater vergnügte. Aber dann und wann, wenn er es sich verdient hatte, erlaubte Charnay sich die Zerstreuung, unter den billigen Flittchen Ausschau nach einem schnellen Vergnügen zu halten. Und verdient hatte er sich diese Belohnung. Hatte er nicht tagelang zäh und verbissen verhandelt und die besten Konditionen herausgeschlagen? Seine gesamte Seidenproduktion hatte er verkauft, ohne nur einmal die Contenance gegenüber dem knauserigen Fabrikanten zu verlieren. Herrgott, war das ein Erbsenzähler gewesen und von einer puritanischen Tugendhaftigkeit, die einem Schauder über den Rücken jagen konnte.
Heute hatte er die Hure in roter Seide ausgewählt, die leichtherzig tändelnd zunächst seine Annäherung erwiderte. Doch als er seine ihm zustehende Befriedigung einforderte, hatte sie sich ihm entzogen. Wieder wallte die Wut in ihm auf, und unter seinen Fingern spürte er noch einmal das Reißen der Seide. Ruckartig zerrte er sich seinen weißen Schal vom Hals und fuhr hektisch mit den Händen über den glatten Stoff. Es kostete ihn beinahe unmenschliche Anstrengung, ihn nicht auch in Fetzen zu reißen, aber er beherrschte sich.
Der rote Wutnebel legte sich, und sein Augenmerk wurde auf eine junge Frau gelenkt, die mit hochgezogenen Röcken und wehenden Unterröcken den Weg zur Anlegestelle entlang lief. Ganz nahe kam sie an ihm vorbei, bemerkte ihn aber nicht.
Charnay aber durchzuckte ihr Name in einer plötzlichen Erinnerung.
»Ariane von Werhahn?«, flüsterte er. Und dann noch mal: »Ariane Kusan!«
Vergessen der Schmerz in den Lenden, vergessen das Zucken in der Wange, vergessen der seidene Schal. Er beugte sich vor, um sie weiter zu beobachten. Tatsächlich, die Frau in dem schäbigen Kleid, die jetzt neben der gekrümmt gehenden Alten und den beiden schmuddeligen Kindern an Deck des Raddampfers stand, war die einstmals so schnippische junge Adlige aus dem Münsterland, die es gewagt hatte, seinen Antrag abzulehnen. Stattdessen hatte sie diesen Taugenichts von Kusan geheiratet. Nun ja, der Verbindung schien kein Glück oder keine Dauer beschieden gewesen zu sein. Heruntergekommen und ärmlich sah sie aus. Geschah ihr recht. Sie könnte in einem weitläufigen Herrenhaus im Süden Frankreichs leben, die köstlichsten Lyoner Seiden tragen, sich in der vornehmen Gesellschaft von Paris bewegen und sich zwischen Laken aus Satin seiner Aufmerksamkeiten erfreuen.
Sie hatte anders gewählt.
Charnays Lippen verzogen sich zu einem befriedigten Lächeln. Es war sogar noch nachträglich eine Genugtuung, dass sein Eingreifen vor Jahren solch lang anhaltende Wirkung zeigte. Er beschloss, sich an diesem Tag doch noch eine Belohnung zu gönnen. Einerseits, weil er sich vorbildlich beherrscht und seiner Wut nicht stattgegeben hatte, zum anderen, weil ihm der Anblick der verarmten Hochnäsigen das Recht dazu gab. Er würde auf seine üblichen asketischen Essgewohnheiten an diesem Tag verzichten und sich ein üppiges Mahl mit den besten Weinen, Cognac und Zigarren gönnen.
Ein Wink mit dem Fächer
Das Wort ist ein Fächer!Zwischen den Stäbenblicken ein Paar schöne Augen hervor.Der Fächer ist nur ein lieblicher Flor …
Johann Wolfgang von Goethe
Tante Caro hatte große Ähnlichkeit mit einem aufgeplusterten Sperling. Ihr weit ausladendes braunes Seidenkleid umwogte mit unzähligen Volants ihre mollige kleine Gestalt. Flauschige braune Locken rahmten ihr rundes Gesicht ein, sie hatte ihre Frisur mit dem falschen Fifi ergänzt und mit einer wunderlichen Federkreation geschmückt. Wie bei besagtem Vögelchen huschten ihre dunklen Augen eilig hin und her, und ihr ständig gespitztes Mündchen - zu ihrer Jugendzeit galten kleine, herzförmige Lippen als begehrenswert - erinnerte an den Spatzenschnabel.
Als sie mich ausreichend auf gesellschaftstaugliches Aussehen hin gemustert hatte, nickte sie anerkennend.
»Das Kleid habe ich ja noch nie an dir gesehen, Ariane.Wirklich hübsch. Wie das Himmelblau deinen Augen schmeichelt. Die Herren werden zu seufzen haben.«
Ich ignorierte die Anspielung auf romantische Männerreaktionen und berichtigte sie mit einem Lächeln: »Du hast das Kleid sehr wohl schon mal gesehen,Tante Caro. Ich trug es vor neun Jahren zu meiner Hochzeit. Allerdings haben wir es …«
»Ach Kind, wie schrecklich.«
»Daran ist doch nichts Schreckliches. Madame Mira hatte den hervorragenden Einfall, über den Rock diese dunkelblaue Gaze zu drapieren, damit es nicht mehr gar so jungmädchenhaft wirkt.«
»Aber es muss dich doch unsagbar schmerzen, die Erinnerung an deinen Gatten selig.«
»Es ist ein Kleid, Tante Caro, mehr nicht. Warum sollte ich kostbaren Taft im Schrank den Motten überlassen, wenn er mir doch so gut steht?«
»Du bist so tapfer, Liebes. Dieses hübsche Perlenhalsband ist neu, nicht wahr? Aber du trägst gar nicht mehr die Perlen deiner lieben Mama.«
Die doppelreihige Schnur hatte für die Aufnahmegebühren der privaten Elementarschule herhalten müssen, das Samtband, das ich stattdessen trug, war mit Wachsperlen bestickt, die einer kritischen Prüfung auf Echtheit nie standhalten konnten. Mich störte dieser Umstand allerdings nicht.
»Ich finde dies passender«, beschied ich Tante Caro daher kurz, doch sie hatte einen ihrer Momente der Hellsichtigkeit und schluchzte auf: »Du hast sie verkauft. Lieber Gott, du hast deine Perlen verkauft. Ich habe uns alle ins Unglück gestürzt.«
»Wein doch nicht,Tante Caro. Du kannst nicht mit roten Augen zu Oppenheims kommen. Bedenke doch, wie sehr du dich um diese Einladung bemüht hast.«
Tapfer kam das Spitzentüchlein zum Einsatz, und mit bebender Stimme erklärte sie: »Aber Ariane, doch nur für dich!«
»Für mich?« Damit verblüffte sie mich. Ich dachte, ihr gesellschaftlicher Ehrgeiz, mit den Angehörigen der haute volée auf vertraulichem Fuß zu stehen, sei ihr stärkster Antrieb.
»Der junge Albert hat sich neulich für zwei Tänze hintereinander auf deiner Ballkarte eingetragen. Du musst ihm nur einen zarten Wink geben, Liebes. Ich vermute, er wäre sehr interessiert. Ach, was das für uns alle für eine glückliche Lösung wäre. Deine Kinder hätten wieder einen Vater, und du wärst aller Geldsorgen ledig. Diese Bankiers sollen ja wahre Krösusse sein.«
»Krösus würde sich geschmeichelt fühlen, mit Salomon Oppenheim verglichen zu werden«, murmelte ich und erkannte das hinterlistige Streben meiner Tante.
Jetzt kam sie auf mich zugeflattert und nahm meine Hände in die ihren. Sie musste ein wenig zu mir aufschauen, denn ich überragte sie um Kopfeshöhe. Eindringlich flehte sie: »Du versprichst mir doch, freundlich und zuvorkommend zu ihm zu sein, Ariane?«
»Ich werde es an Anstand und Höflichkeit nicht fehlen lassen, Tante.«
»Ein bisschen mehr Entgegenkommen könntest du zeigen, Liebes. Du behandelst die Herren manchmal so … so … so schroff. Das mögen sie gar nicht. Sie möchten von uns Damen doch bewundert werden. Und - vielleicht solltest du das Medaillon doch abnehmen.«
»Was?« Ich löste meine Hand aus der ihren und fuhr mir an das Dekolleté, wo der ovale goldene Anhänger warm in meiner Halsbeuge lag.
»Nun, ich weiß, wie schwer es dir fällt, dich davon zu trennen. Aber es könnte einem geneigten Herrn doch signalisieren, dass du noch ein wenig zu sehr an deinem Gatten selig hängst.«
»Das Medaillon bleibt, wo es ist,Tante Caro. Und nun lass uns endlich aufbrechen, damit wir uns nicht noch der Ungehörigkeit schuldig machen, zu spät zu dieser Soiree zu kommen.«
Dieser Hinweis dämmte ihren Wortschwall ein, und mit spatzenhaftem Wedeln und Flattern raffte sie ihre Shawls, Retikül, Tüchlein, Handschuhe und Fächer zusammen.
Der Weg von der Obermarspforte zum Platz am Domkloster war zwar nicht weit, aber unsere Abendgarderobe gestattete es selbstredend nicht, die zierlich beschuhten Füße zu nutzen. Eine Mietdroschke brachte uns zu dem prachtvollen Gebäude, wo uns diskrete Lakaien in den großen Salon führten. Simon Oppenheim, der zusammen mit seinem Bruder Abraham das höchst respektable und äußerst erfolgreiche Kölner Bankhaus leitete, führte ein aufwändiges Haus. Den gesamten Boden bedeckte ein roter Teppich, in dem man beinahe versank, im geschliffenen Kristallgehänge des prachtvollen Lüsters glitzerte das Licht. Die rosa Seidentapeten und weißen Stuckornamente, die roten Samtportieren, ein barock geformter Marmorkamin, zu den Portieren passende Polstermöbel und die in breiten vergoldeten Rahmen gefassten Porträts der Patriarchen hätten jeden anderen Raum erdrückt, doch die luftige Höhe und die schiere Größe dieses Zimmers machten die Üppigkeit beinahe erträglich.
Es waren bereits etliche Gäste versammelt, und wir begrüßten, stellten vor, plauderten, bis der angekündigte Programmteil begann. Sessel wurden gerückt, Stühle herbeigeschafft, Sofas für die Damen gerichtet. Dank der ausladenden Reifen unter unseren Röcken gelang es mir, Distanz zu meiner Nachbarin zu wahren. Helene von Schnorr zu Schrottenberg war nicht meine beste Freundin, wenngleich Tante Caro große Bewunderung für sie hegte. Eine Konversation wurde nun auch nicht mehr verlangt, denn das kleine Kammerorchester und eine aufstrebende junge Sängerin beglückten uns mit den Liedern des Herrn Schubert.
Je nun.
Ich hatte bereits einen langen Tag hinter mir, denn ich ließ es mir nicht nehmen, Laura und Philipp jeden Morgen zu wecken, mit ihnen zu frühstücken und sie zu ihrer Schule zu begleiten. Da wir wenig Personal hatten, widmete ich mich danach den fälligen Hausarbeiten, anschließend kümmerte ich mich um Madame Mira - oder, wenn man es anders sehen wollte - sie kümmerte sich um mich. Ich schloss also mit der Miene äußerster Verzückung die Augen und ließ meine Gedanken müßig wandern.
Vor sechs Jahren hatte mich Tante Caro aufgenommen und mir und meinen vaterlosen Kindern ein so komfortables Heim gegeben, wie ich es ihnen in der Form nicht hätte bieten können. Dafür war ich ihr dankbar, und diese Tatsache rief ich mir immer dann wieder in den Sinn zurück, wenn mir ihre oberflächliche und naivromantische Art an den Nerven zerrte.
Tante Caro war genau genommen meine Großtante, die jüngste Schwester meiner Großmutter mütterlicherseits. Sie hatte recht spät einen würdigen Professor der Philologie geheiratet, und nach ihren Worten war die Ehe glücklich, wenn auch kinderlos geblieben. Zu kurz war sie auch gewesen, denn schon nach sechs Jahren verstarb Dr. Ferdinand Elenz an einer nicht näher erläuterten Krankheit und hinterließ der trauernden Witwe ein auskömmliches Vermögen sowie das Haus an der Obermarspforte, in dem wir jetzt wohnten. Es hätte für uns alle ein sorgenfreies Leben sein können, wäre Tante Caro nicht ein so leichtgläubiges Huhn gewesen.Vor einigen Jahren wurde es modern, unter den Damen in den Salons auch über Geschäfte zu sprechen, weniger aus Sachverstand als vielmehr aus der Tatsache, dass viele Gatten mit den wie durch Zauberhand sich vermehrenden Fabriken schnelles Geld verdienten. Insbesondere Aktien bargen eine verführerische Magie. Und Tante Caro steckte sich an dem Investitionsfieber an. Sie beauftragte ihren Justiziar, Dr. Bratvogel, der ihr Vermögen verwaltete, den Großteil ihrer Gelder in diesen Papieren anzulegen. Der senile und beschränkte Trottel machte dann auch eine wahre Okkasion ausfindig und kaufte Stammaktien des Augsburger Unternehmers Franz Gustav Wolff. Stolz zeigte mir damals Tante Caro die geschmackvoll aufgemachten Papiere, die mit einem roten Lacksiegel versehen waren, das den Aktionär mit den Worten »Patienta vincit omnia«, Geduld besiegt alles - ein Wahlspruch, der nicht der meine ist - aufmunterte. Daher studierte ich die aufgedruckten Angaben gründlich. Die Aktie1 versprach die Teilnahme an der höchst wichtigen und nützlichen Erfindung des ersten sich selbst bewegenden Kraft-Maschinen-Wagens oder des Perpetuum mobile. Diese »Fahrmaschine« sollte ohne Brennmaterialien eine Leistung von sechzig Pferdestärken haben. Und die Leistung sollte bis auf zweitausend Pferdestärken gesteigert werden können.
1 Diese Aktie wurde tatsächlich 1847 herausgegeben und begründete den ersten belegten Aktienschwindel Deutschlands.
Diese horrenden Angaben machten mich stutzig. Ich bemühte Brockhaus’ Enzyklopädie, die Ferdinand selig uns hinterlassen hatte, und fand sehr schnell heraus, dass es sich bei dem Perpetuum mobile um eine technische Unmöglichkeit handelte. Mein Versuch, diese Problematik Tante Caro zu verdeutlichen, scheiterten an ihrem standfesten Glauben an die Vertrauenswürdigkeit und männliche Fachkenntnis des alten Bratvogel. Also suchte ich den würdigen Herrn selbst auf und machte ihn auf den Umstand eines möglichen Aktienschwindels aufmerksam. Er behandelte mich wie ein schwachsinniges Kind, pochte auf seine Autorität und Seriosität, und ich entzog ihm flugs die Vollmacht über meine Wertpapiere, die ich ihm zuvor auf den Rat meiner Tante erteilt hatte. Zum Glück hatte er mit denen noch nicht herumgespielt. Die Tatsache, dass ich überhaupt noch Geld besaß, verdankte ich meinem Gatten selig. Nicht, weil er so großzügig gewesen war, der Taugenichts, sondern weil ich durch ihn einen gewissen Geldverstand erworben hatte. Denn Geld war das Thema gewesen, über das wir uns am leidenschaftlichsten gestritten hatten. Kurzum, ich hatte eine einigermaßen anständige Summe, die für die Ausbildung von Laura und Philipp in soliden Wertpapieren festgelegt war, und das, was mir nach dem Verkauf des Hausrats und der Möbel, die ich aus meiner Mitgift finanziert hatte, übrig geblieben war. Das war das Kapital, von dem ich derzeit zehrte. Es reichte für die Haushaltskosten, Kleider und Bücher für die Kinder, aber große Sprünge waren damit nicht zu machen.Tante Caro indes machte gar keine Sprünge mehr, denn der Schwindel war vor einem Jahr aufgeflogen, und der trottelige Bratvogel hatte einige seiner schäbigen Federn eingebüßt, als er ihr die entsetzliche Nachricht überbringen musste, dass das Vermögen perdu war.
Eine Lösung für das finanzielle Desaster hatte er nicht.
Mich hatte mein eigenmächtiges Verhalten in Vermögensdingen mit dem jungen Albert Oppenheim bekannt gemacht, der im väterlichen Bankhaus bereits tatkräftig mitarbeitete und meine Konten betreute. Wir schätzten einander, denn er beriet mich gut und ohne die bei so vielen Männern übliche Herablassung. Tante Caro deutete das in ihrem Sinne um, aber mir lag nichts ferner, als einen vier Jahre jüngeren Herrn zur Ehe zu verleiten.
Andererseits wollte ich an diesem Abend die Gelegenheit nutzen, ein weiteres Gespräch mit ihm zu führen. Da weder meine Tante noch ihr vertrottelter Justiziar in der Lage waren, die finanzielle Misere in den Griff zu bekommen, würde ich die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen.
Die Musiker erhielten ihren verdienten Applaus, und als ich Albert Oppenheim zufällig zu mir blicken sah, öffnete ich meinen Fächer demonstrativ mit der linken Hand. Als wohlerzogener Kavalier verstand er die Botschaft und näherte sich mir.
Helene von Schnorr zu Schrottenberg stand mit einem missbilligenden Blick auf. Auch sie hatte den kleinen Wink mit dem Fächer verstanden und hätte sich sicher liebend gerne eingemischt, hätte nicht ein weiterer Herr ihre Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, als mich Albert begrüßte.
»Verehrte Frau Kusan, ich bin entzückt, Sie in unserem Heim willkommen heißen zu dürfen«, sagte der Bankierssohn mit einer höflichen Verbeugung und einem herzlichen Lächeln.
»Ich bin meinerseits entzückt, an dieser charmanten Veranstaltung teilnehmen zu können. Sehr talentierte Musiker und eine begabte Sängerin.«
»Meine Schwester.«
»Richten Sie ihr mein Kompliment aus.«
»Gerne, Frau Kusan.« Und dann zwinkerte er mir zu. »Aber Sie wollten mich sicher nicht nur wegen unserer Künstler sprechen?«
»Tatsächlich ging mir etwas anderes durch den Sinn.«
»Dann wollen wir uns mit einem Getränk versorgen und plaudern.Was darf ich Ihnen bringen lassen?«
Ich entschied mich für ein kleines Glas Champagner, und wir fanden einen ungestörten Platz in einer Fensternische, wo ich ihm mein Anliegen in kurzen Worten vortrug. Er hörte geduldig zu, aber seiner Miene sah ich schon an, dass er mir wenig Hoffnung machen konnte.
»Es tut mir unsagbar leid, liebe Frau Kusan«, erklärte er dann auch, als ich geendet hatte. »Ein Kredit ist nicht die Lösung des Problems Ihrer Tante. Zum einen - gestatten Sie mir, ganz ehrlich zu sein - glaube ich nicht, dass sie das Wesen des Darlehens erfasst. Sie wird das Geld als das ihre ansehen und ausgeben, und wenn der Rückzahlungstermin kommt, entsetzt darüber sein, dass sie den Betrag nebst Zinsen aufzubringen hat. Außerdem hat sie keinerlei Sicherheiten zu bieten, abgesehen von dem Haus, in dem sie wohnt. Das aber könnte sie durch eine solche Transaktion auch noch verlieren.«
Ich musste ihm in der Beurteilung meiner Tante leider recht geben. Aber meine Idee gab ich noch nicht auf.
»Würden Sie es eventuell in Erwägung ziehen, mir einen Kredit zu gewähren?«
»Frau Kusan - verstehen Sie mich nicht falsch; ich kann darüber noch nicht entscheiden. Das Kreditgeschäft liegt in den Händen meines Onkels.«
»Dann sollte ich die Frage so formulieren: Unter welchen Umständen würde das Bankhaus Oppenheim einer Person wie mir einen Kredit gewähren?«
»Und ich will es so formulieren, Frau Kusan: Wir gewähren Kredite dann, wenn erkennbar ist, dass der Betrag mit Zinseszins an uns zurückfließen wird. Das ist das Geschäft einer Bank.«
»Ich weiß, Herr Oppenheim.«
»Wenn Sie beispielsweise die Aussicht auf eine größere zukünftige Zahlung hätten und nur die Zeit bis dahin überbrücken wollen, könnte man es in Erwägung ziehen.«
»Ich erwarte keine Erbschaft.«
»Dann bliebe noch die Möglichkeit, dass Sie ein Unternehmen gründen, das auf lange Sicht Gewinn erwirtschaftet.«
Ich schnaubte leise.
»Nein, Frau Kusan, tun Sie das nicht so einfach ab. Ich habe Sie als pragmatische Dame kennengelernt.Was würde Sie daran stören, zu arbeiten?«
»Nichts, Herr Oppenheim, außer dem Fehlen einer Möglichkeit. Uns Damen stehen da nicht viele Chancen offen.«
»Das ist nicht richtig. Sehen Sie dort Frau Masters, die Gattin des Schokoladenfabrikanten? Sie hat vor ihrer Ehe eine exquisite Chocolaterie betrieben. Sebastienne Waldegg dort führt ein fotografisches Atelier, und bei wem kaufen Sie Ihre Hüte und Hauben? Putzmacherinnen, Modistinnen, Schneiderinnen sind Unternehmerinnen. Ich kenne eine Uhrmacherin, eine Goldschmiedin, eine ganze Reihe Damen, die Mädchenpensionate führen, kleine Hotels, Pensionen, Cafés, Konditoreien. Und meine Großmutter Therese hat nach dem Tod ihres Gatten jahrelang selbst das Bankhaus geführt. Höchst effizient, wie man sagt.«
Er machte mich nachdenklich. Sehr nachdenklich.
»Sie haben recht, Herr Oppenheim. Ich muss mir zuerst überlegen, auf welche Weise ich Geld verdienen kann, und dann um ein Darlehen ansuchen.«
»Ich bin mir sicher, Ihnen fällt dazu etwas ein, Frau Kusan. Dann werde ich selbstverständlich bei meinem Onkel für Sie bürgen.«
Ich lächelte ihn an und bemerkte Tante Caro, die uns mit ihren hurtigen Spatzenaugen begeistert musterte. Sie malte sich vermutlich schon den kniefälligen Heiratsantrag aus. Und ein Teufelchen gab mir den verwegenen Gedanken ein, ihre Hoffnungen auszusprechen.
»Natürlich könnte ich auch einen vermögenden Herrn heiraten.«
Albert Oppenheim wurde dunkelrot, und ich klappte eiligst meinen Fächer auf, um ihn sofort wieder geräuschvoll zuzuklappen.
»Verzeihen Sie, Herr Oppenheim, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen.«
»Es ist ja nicht so …«
Er stammelte doch tatsächlich, der arme Junge, und mir wurde wieder bewusst, dass er bei all seiner Geschäftstüchtigkeit noch sehr jung war.
»Herr Oppenheim, ich glaube, Fräulein Paula Engels würde es sehr begrüßen, wenn Sie sie aus den Fängen unserer Dichterfürstin erlösen würden.«
Ich wies mit dem Fächer unauffällig auf die hübsche junge Dame mit dem gequälten Lächeln im Gesicht hin, die von Helene von Schnorr zu Schrottenberg in Beschlag genommen wurde. Vermutlich musste sie einen der literarischen Ergüsse dieser Künstlerin über sich ergehen lassen.
Albert Oppenheim hatte sich wieder gefangen und erlaubte sich ein leises Lachen.
»Sie verfügen offensichtlich über geradezu hellsichtige Fähigkeiten, Frau Kusan. Oder habe ich mich so leicht verraten?«
»Mademoiselles Fächer und Ihre Kenntnis der geheimen Sprache hat Sie verraten.«
»Oh.«
Er verbeugte sich geschmeidig vor mir und machte sich dann auf den Weg, seine Angebetete zu erlösen.
Den ganzen Heimweg über versuchte Tante Caro aus mir herauszubekommen, worüber ich mich denn so eingehend mit dem Bankierssohn unterhalten hatte, und meine ehrliche Auskunft, dass wir ausschließlich über finanzielle Fragen gesprochen hatten, wollte sie nicht hinnehmen. Ich ließ sie ihre sentimentalen Gedanken spinnen und bot ihr, sowie wir das Haus betreten hatten, eine gute Nacht. Anschließend eilte ich nach oben, um zu schauen, ob Laura und Philipp ruhig schliefen. Sie teilten sich den großen Raum unter dem Dach, der mir tagsüber als Nähzimmer diente. Ich versuchte zwar, ganz leise zu sein, aber das Rascheln meines voluminösen Taftrocks weckte die beiden wohl auf.
»Mama, gibt es auf dem Rhein Piraten?«
Schlaftrunken war Philipp nie, das musste man ihm lassen. Im Licht meiner kleinen Handlampe blitzten seine Augen wissbegierig auf, und er wühlte sich unter dem dicken Plumeau in eine sitzende Stellung.
»Ich habe noch von keinen gehört. Wie kommst du darauf, dass es welche geben könnte?«
»Madame Mira hat uns von den Flusspiraten vorgelesen.«
Er deutete auf das Buch, das auf dem Schreibpult lag. Es trug die Aufschrift »Flusspiraten auf dem Mississippi« und stammte aus der Leihbücherei. Friedrich Gerstäcker hatte ganz bestimmt nicht zu den bevorzugten Autoren von Tante Caros Ferdinand selig gehört, aber Madame Mira trug in ihrem vom Alter gekrümmten Körper die Seele eines wilden Abenteurers und begeisterte sich hemmungslos für derartige Geschichten. Die Kinder liebten sie deswegen bedingungslos.
»Sie haben einen Bären erlegt, Mama!«, mischte sich jetzt auch meine zerzauselte Tochter ein. »Und sie haben seine Rippen gebraten. Hast du schon mal Bärenrippen gegessen, Mama?«
»Nein, dieser Genuss ist mir bisher verwehrt geblieben. Das mag aber daran liegen, dass es bei uns weder Piraten noch Bären in ausreichender Menge gibt.«
»Schade. Können wir nicht mal eine lange Schiffsfahrt machen?«, fragte mein hoffnungsvoller Sprössling nach, dem ich die Erwartung ansah, dass nur wenige Meilen von Köln entfernt die wahre Wildnis begann.
»Ich werde darüber nachdenken, aber jetzt, meine Mäuse, wird weitergeschlafen.«
»Ich träum aber von Piraten!«
»Tu das, mein Sohn«, sagte ich und zog die Decke wieder über ihn. Dann gab ich ihm einen Kuss, den er erst mit einer Grimasse, dann mit einem breiten Grinsen akzeptierte. Dabei zeigte sich sein schiefer Schneidezahn, der ihm ein eigenartig verwegenes Aussehen verlieh und mir einen schmerzhaften Stich verursachte. Genau dieser Ausdruck hatte mich vor zehn Jahren dazu gebracht, mich in seinen unnützen Vater zu verlieben.
Ich schob das Angedenken an meinen Gatten selig resolut beiseite und half Laura, sich wieder in die Kissen zu kuscheln. Dabei stieß ich auf Captain Mio, der sich am Fußende eingegraben hatte und mich wegen der Störung seiner heiligen Nachtruhe einmal kräftig anfauchte.
»Du riechst so gut, Mama. Hast du getanzt?«
»Nein, nur Musik gehört. Ich erzähle euch morgen früh davon. Und nun träumt schön. Meinetwegen von toten Bären und blutrünstigen Flusspiraten.«
Hundertfaches Begehren
Wer hundertfach begehrt,hat hundertfaches Leid.Wer eines begehrt, hat ein Leid.Wer keines begehrt, hat kein Leid.
Buddha
An manchen Tagen zitterte er so stark, dass keine Decke ihn wärmen konnte, an anderen war sein Schlaf so tief, dass kein Laut ihn weckte. Manchmal hatte er Fieber, fast immer Durchfall, gelegentlich konnte er einen Becher Saft bei sich behalten. Aber weit schlimmer als die Krämpfe empfand er die Unfähigkeit, seine Gedanken zu kontrollieren. Sie wanderten durch dunkle Gefilde, machten niemals Halt, ließen ihn nicht zur Ruhe kommen.
Die Mönche sorgten schweigend für seinen immer schwächer werdenden Leib, doch seiner Seele konnten sie nicht helfen. Er rang mit den Ungeheuern seiner eigenen Erinnerungen.
Und dennoch, die Zeit verging, die Ruhe und Abgeschiedenheit wirkten auf ihre Weise.
So erwachte er dann auch eines Morgens und erkannte, dass er in der Lage war, die Geräusche richtig zuzuordnen. Sturm umtoste das Kloster auf dem Berg, der Regen, fast wie ein Wasserfall schien er niederzugehen, trommelte hart auf das Ziegeldach, und die hohen Kiefern knarrten unter den Peitschenhieben des Windes.
Mühsam drehte er den Kopf und erkannte, dass er alleine war. Die Läden an den Fenstern waren geschlossen, eine kleine Öllampe spendete wenig Helligkeit. Der Krug mit dem Saft stand nahe an seinem Lager, aber er war nicht kräftig genug, um nach dem Becher zu langen.
Immerhin quälten ihn für den Moment keine Krämpfe, und auch die Kälteschauer schienen vorbei zu sein.
Er schloss wieder die Augen und lauschte dem strömenden Regen. Irgendwo in der Ecke des Zimmers war eine undichte Stelle, und rhythmisch klatschten Tropfen auf den Boden.
Das Geräusch wirkte einlullend, und wieder kamen die Gesichte zu ihm. Doch diesmal fand er die Kraft, die Bilder festzuhalten.
Servatius, mit schwarzgrauem Bart, die dunkle Mähne windzerzaust, das wettergegerbte Gesicht von Falten durchzogen, grinste ihn an. So hatte er seinen Paten in Erinnerung. Eine gute Erinnerung. Aber dann änderte sich die Erscheinung, und plötzlich war das Gesicht unter Wasser, schwebten seine Haare wie Tang um sein stilles Antlitz, seine Lider waren geschlossen, die Falten geglättet.Wellen kräuselten die Oberfläche, und schlammiger Schaum wollte sich über ihn schieben.
»Nicht!« Mit einer unsäglichen Anstrengung gelang es ihm, das Bild zu klären, und das Wasser wurde wieder ruhig und rein. Unter der gläsernen Hülle öffnete Servatius die Augen und blickte ihn an.
»Du musst beenden, was ich begann. Du bist mein Erbe.«
Sagte er es, oder war es der Nachhall seiner Worte, die in seinem Testament gestanden hatten? Er wusste es nicht, aber noch immer lag eindringlich der Blick seines Paten auf ihm.
»Ja, Servatius. Ich bin dein Erbe. Ich bringe zu Ende, was du geschworen hast.«
Das Gesicht löste sich auf und verschwand.
Doch irgendwie hatten sich diese Gedanken in ihm geformt, und sie gaben ihm die Energie, bei Bewusstsein zu bleiben und über seine Lage nachzudenken.
Sie war unbeschreiblich. Er wusste nicht, wie lange er sich schon in diesem Zustand der Schwäche befand.Vermutlich seit Wochen. Seine Arme, erkannte er, waren steckendünn geworden, sie zu heben bedurfte äußerster Anstrengung. Die Beine zu bewegen wollte er erst gar nicht versuchen.
Mit einem Windstoß öffnete sich die Tür, und der stille Mönch trat in den Raum. Seine Robe triefte, sein kahler Schädel glänzte von Nässe.
»Ihr seid wach, baixi long?«
Diesmal gelang ihm tatsächlich ein gekrächztes »Shi«.
»Dann wird es nun besser.Trinkt.«
Auch das Schlucken gelang wieder. Aber es erschöpfte ihn. Und als er wieder alleine war, übermannte ihn die schwärzeste Trauer, die er je in seinem Leben verspürt hatte. Ignaz war tot, verbrannt in einem Lagerhaus. Servatius war tot, ertrunken in den Fluten eines tropischen Sturms.
Wie sollte er nur je mit diesem Verlust leben?
Hätte er doch nur eine Opiumpfeife. Sie hatte ihm in den vergangenen Jahren über die unerträglichen Gefühle hinweggeholfen. Die Wärme, das Wohlgefühl, die geistige Klarheit, die die Droge ihm verschafft hatte, brauchte er, um zu überleben.
Aber sosehr er auch den heilenden Rauch begehrte, hier im Kloster würde er ihn nicht bekommen.
Darum musste er, nachdem sein Körper das Gift besiegt hatte, mit seinem Geist gegen die nie gelebte Trauer, die Trostlosigkeit und nun, da er leben wollte, die sich anschleichende Todesangst kämpfen.
Es war die zweite Hölle, die er durchschritt.
Auf hoher See
Die Wolke steigt, zur MittagsstundeDas Schiff ächzt auf der Wellen Höhn,Gezisch, Geheul aus wüstem Grunde,Die Bohlen weichen mit Gestöhn.»Jesus, Marie! wir sind verloren!«Vom Mast geschleudert der Matros’,Ein dumpfer Krach in Aller Ohren,Und langsam löst der Bau sich los.
Annette von Droste-Hülshoff, Die Vergeltung
»Hart backbord!«, donnerte der Kapitän, und das Schiff krängte gefährlich über. Tosend krachten die Wellen auf das Deck und spülten alles über die Reling, was nicht festgemacht worden war.
»Mann über Bord«, piepste der Steuermann. Eine Dame im rosa Rüschenkleid versank wortlos in den Fluten.
»Weiter hart backbord.« Kaltblütig hielt der Kapitän an seinem Kurs fest, denn die Rettung der Unseligen hätte bedeutet, dass sie auf die gefährlichen Klippen der Dracheninsel aufgelaufen wären. Dem grausamen Ungeheuer, das hier hauste, galt es um jeden Preis zu entgehen. Doch weitere Gefahren lauerten auf dem sturmgepeitschten Meer.
»Piraten von steuerbord!«, quiekte es vom Ausguck atemlos.
»Backbord, du dumme Nuss«, korrigierte der brummige Seebär und musterte die Brigg, die sich unaufhaltsam näherte. Schon konnte er in die grünen Augen des Freibeuters blicken. Eines davon zierte eine schwarze Klappe, sein Kinn ein ebenso schwarzer Bart, und die Flagge an seinem Heck stieg jetzt ebenso bedrohlich schwarz in die Höhe. Er reckte seinen weißen Leib und maunzte herausfordernd.
Die Besatzung machte sich bereit, ihr Schiff gegen den Korsaren bis aufs Blut zu verteidigen. Doch der verließ bereits sein korbähnliches Boot, und schon fuhren die Enterhaken aus, und der Anführer der feindlichen Meute erklomm schnurrend den schnittigen Klipper.
»Kappt die Taue, werft mit Ankern, holt über!«, heulte der Erste Offizier.
»Quatsch, doch nicht mit Ankern werfen. Refft die Segel, beidrehen!«, donnerte der Kapitän, und das Schiff schwankte erbärmlich. Brecher spülten über das Deck, Masten barsten. Leinwand ging nieder. »Beim wilden Nick, wir werden das Schiff verlieren!«
Die Not war groß, das Steuer gebrochen, in der Bilge stieg das Wasser. Hier drohten die scharfen Klippen und der feuerspeiende Drache, dort die Piraten, die halbe Besatzung schon über Bord, und der Wind heulte erbarmungslos in den Wanten.
Doch da - ein Ruf durch das Brausen und Toben.
»Ahoi, Kameraden! Haltet durch, haltet durch, das rettende Mutterschiff naht!«
»Nicht, Mama! Nicht. Du kannst nicht einfach auf das Meer treten!«
»Ah, stimmt, ich würde auf der Stelle ersaufen.«
Philipp beobachtete mit zusammengekniffenen Augen, wie Mama das Tablett mit Kakao und Kuchen auf dem Tisch abstellte, geistesgegenwärtig ein Polsterkissen vom Sessel riss und es als Floß in die Fluten warf. Mit beiden Händen ruderte sie herbei, um die Mannschaft des havarierten Schiffs zu bergen.
Sie war schon eine Richtige. Ganz genau hatte sie erkannt, um was es bei dem derzeitigen Abenteuer ging.
Der Pirat jedoch hatte sie ebenfalls gesichtet, drehte ab, nahm Kurs auf das Mutterschiff, enterte den Schoß und rollte sich schnurrend darauf zusammen.
»Captain Mio, du bist ein Spielverderber«, murrte Mama und streichelte den Kater. Laura, Steuermann und Ausguck, empfand diesen Verstoß gegen die Regeln jedoch als Signal, ihren Posten zwischen den beiden umgedrehten Stühlen verlassen zu dürfen, den er, der Kapitän, ihr aufgetragen hatte. Sie näherte sich auf eigene Faust der hoch aufragenden Enteninsel, einem wahren Schlaraffenland.
»Meuterei! Nehmt sie fest! Legt sie in Eisen. Lasst sie über die Planken gehen!«, brüllte der erboste Kapitän, doch von dem Mutterschiff erhielt er keine Unterstützung.
»Der Erste Offizier hat das Recht auf einen Landgang«, hieß es lakonisch. »Der Kapitän auch.«
»Na gut. Dann soll sie leben bleiben. Sie ist ja nur ein wertloses Mädchen.«
»Deine Meinung zu weiblichen Wesen werden wir beizeiten noch korrigieren müssen, Kapitän Philipp. Aber bevor du Anker wirfst, gib mir doch bitte erst mal einen Überblick über die Lage.«
Der Seebär schielte zwar ebenfalls verlangend nach der Insel, auf der Milch und Honig flossen, aber gehorsam beugte er sich dem Befehl seines Admirals.
»Das hier ist die Dracheninsel«, erklärte er und zeigte auf das runde Medaillon inmitten des großen, blauen Seidenteppichs, der den Boden fast des ganzen Raumes bedeckte. »Die darf man nicht anlaufen, weil das Untier jeden Menschen vernichtet.«
»Verstehe. Er sieht ja auch ganz besonders garstig aus.«
»Aber in den vier Ecken sind rettende Inseln. Auf ihnen gibt es wunderbare Vögel. Im Süden einen Phönix, im Westen Enten, im Norden sitzt der Pfau und im Osten gibt es Kraniche.«
»Der Pfau bewohnt eine Höhle, vermute ich«, fragte Mama, die ein erfreuliches Verständnis für das Szenario des aufregenden Spiels bewies, und zeigte auf den Sessel, der über der Pfaueninsel stand.
»Ja, genau. Manchmal haust aber auch der Pirat dort.«
»Das habe ich mir fast gedacht.«
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
© 2009 by Blanvalet Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-02569-4
www.blanvalet.de
Leseprobe
www.randomhouse.de