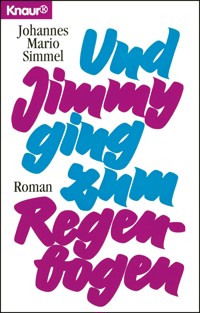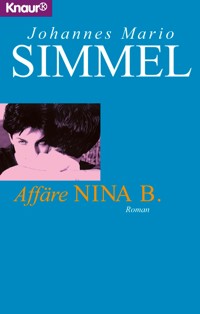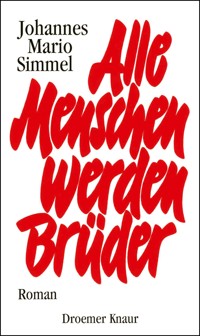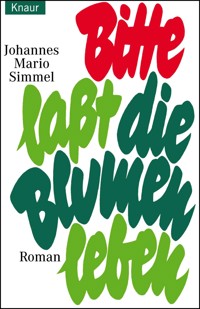6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Gibt es noch Frieden für Menschen, die einander wirklich lieben? Dieser Frage geht Johannes Mario Simmel in seinem spannungsgeladenen Roman nach, dessen Held, der Reporter Paul Holland, auf der verzweifeltenb Suche nach seiner Geliebten in einen Strudel geheimnisvoller und abenteuerlicher Ereignisse gerissen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Gott schützt die Liebenden
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für Lulu in Liebe
Wenn wir zu einem Menschen sagen: Ich kann ohne dich nicht leben, dann meinen wir in Wirklichkeit damit:
Ich kann nicht in dem Gefühl leben, daß du vielleicht Schmerz empfindest, unglücklich bist, Not leidest. –
Das ist alles. Wenn die Menschen tot sind,
dann endet unsere Verantwortung.
Wir können nichts mehr für sie tun.
Wir können in Frieden ruhen.
Graham Greene, Das Herz aller Dinge
Erstes Buch
1
Das Telefon läutete.
Ich fuhr im Bett hoch und tastete in der Dunkelheit nach dem Schalter der Nachttischlampe. Es war nicht mein Bett, und es war nicht mein Zimmer, und deshalb fand ich den Schalter nicht. Das Leuchtzifferblatt einer kleinen Uhr zeigte die Zeit: genau fünf. Wieder läutete das Telefon, und wieder. Sibylle hörte es nicht. Ruhig und gleichmäßig atmete sie weiter, als ich mich jetzt über sie neigte. Wir hatten im gleichen Bett geschlafen, eng aneinander, sie in meinem Arm. Meine rechte Hand, auf der vergeblichen Suche nach dem Lichtschalter, fand den Telefonhörer.
»Hallo …« Ich räusperte mich, denn meine Kehle war verlegt, und ich konnte kaum sprechen.
»Ist dort siebenundachtzig-dreizehn-achtundvierzig?« Die Stimme der jungen Frau vom Amt klang frisch und fröhlich.
»Ja«, sagte ich. Jetzt bewegte sich auch Sibylle. »Sind Sie Herr Holland?«
»Ja«, antwortete ich zum zweitenmal.
»Sie haben uns einen Weckauftrag gegeben«, sagte die Frauenstimme. »Es ist genau fünf Uhr. Wir wünschen Ihnen einen guten Morgen, Herr Holland!«
»Danke.«
Ich legte den Hörer vorsichtig in die Gabel und ließ mich wieder auf den Rücken sinken. Weit entfernt klang Flugzeugmotorenlärm auf. Ich lag ganz still und sah in die Finsternis hinein und wartete darauf, daß der Lärm lauter wurde. Dieses Geräusch beunruhigte mich immer wieder. Sibylle hörte es gewiß gar nicht mehr, sie lebte schon zu lange in Berlin.
Aber für mich war dieses Brausen, das in der Tat nun anschwoll und lauter und lauter wurde, so etwas wie eine beständige Mahnung, eine unsagbare Drohung, und es erfüllte mich mit Traurigkeit. Die Scheiben des Fensters klirrten ein wenig, als die schwere viermotorige Maschine über das Haus hinwegbrauste.
Die Tage in Berlin waren wieder einmal vorüber. Ich mußte fort. Nichts war von Dauer. Nicht die Trauer, und nicht das Glück. Es gab keinen Frieden.
Zwei Zeilen eines Gedichtes fielen mir ein: »… und immerfort hör’ ich in meinem Rücken den Sauseschritt der Zeit, die weitergeht …« Wer hatte das geschrieben? Ich erinnerte mich nicht. Nun wurde das Brausen wieder leiser. Tag und Nacht, mindestens viermal in jeder Stunde, flog eine Maschine über Sibylles Haus – vor der Landung, nach dem Start. Etwas südlicher lag der Flughafen Tempelhof. Die Maschinen flogen stets schon oder noch sehr tief, wenn sie über das Haus hinwegrasten. Zur Zeit der Blockade, hatte Sibylle mir erzählt, klirrten die Fensterscheiben alle zwei Minuten, bei Tag und bei Nacht. Bei schönem Wetter und auch bei schlechtem. Alle zwei Minuten. Der Sauseschritt der Zeit, die weitergeht …
Noch eine Viertelstunde, dachte ich. Dann wollte ich aufstehen. Nein, das war zuviel. Zehn Minuten. Nun wurde der Motorenlärm ganz leise, zärtlich, wie verliebtes Gemurmel, und dann hörte ich nichts mehr. Die Stille kam wieder. Doch sie kam nicht, um zu bleiben. Eine neue Maschine flog schon Berlin an – irgendwo über den Wolken noch, im ersten rosigen Frühlicht dieses Wintertages, kam näher, bereit, über uns hinwegzutoben, die Luft erzittern zu lassen, übermächtig, gebieterisch und doch so schwankend und unsicher, so balancierend zwischen Tod und Leben wie die Menschen in ihr und unter ihr.
»Paul?«
»Ja, mein Liebling.«
Sie drehte sich zur Seite und legte ihren weichen, warmen Mund auf meine Brust. Sie war kleiner als ich und sehr zart, sie hatte lange Beine und schmale Hüften. Ihre Brüste waren klein und fest. Nackt sah sie fast aus wie ein Junge. Männer, die Frauen nicht mochten, sagten voll Hochachtung von Sibylle: »Sie ist ja Gott sei Dank gar keine richtige Frau!« Aber das sagten sie, weil sie Sibylle nicht kannten. Ich kannte sie. Ich wußte, wie fraulich sie war, wie sentimental sie sein konnte, wie zärtlich und anschmiegsam. Die anderen wußten es nicht, sie hatten keine Ahnung.
Wir schliefen nackt. Sibylle preßte ihren Jungenkörper gegen den meinen. Ich fühlte mich wie ausgehöhlt von einer unendlichen Traurigkeit, deren ich nicht Herr werden konnte.
»Wir müssen aufstehen, nicht wahr?« flüsterte sie. Es war niemand in ihrer Wohnung außer uns; aber sie flüsterte, als dürfe niemand uns hören, als hätte sie Geheimnisse mit mir vor ihren Büchern, ihren Bildern, ihrem schmalen Bett.
Ich räusperte mich krampfhaft. »Mein Armer«, flüsterte sie. »Das tust du immer. Immer wenn du von mir fort mußt, beginnst du dich zu räuspern.«
»Mir ist sehr elend«, sagte ich.
»Sprich nicht so!« Ihre Hände streichelten mich, aber sie waren kalt und blutleer. Die meinen waren feucht vor Aufregung und Schwäche. »Was soll ich denn sagen?« flüsterte sie in meine Achselhöhle. »Du fliegst wenigstens noch fort – aber ich komme zurück in meine Wohnung, hierher in dieses Bett, das noch nach dir riecht, in dieses Zimmer, in dem mich alles an dich erinnert. Weißt du, daß ich schon einmal dein Kissen verprügelt habe, weil es nicht aufhörte, nach deinem Haar zu riechen?«
Ich erwiderte, während ich gespannt auf das Nahen einer neuen Maschine lauschte: »Ich liebe dich, Sibylle.«
»Und ich dich, mein Herz«, sagte sie.
»In zehn Tagen bin ich wieder bei dir.«
»Ja, Paul.«
»Dann werde ich lange bleiben.«
Jetzt brannte die Nachttischlampe, und ich konnte Sibylle sehen. Sie sah aus wie eine schöne, leidenschaftliche Katze. Ihre Augen waren schräg geschnitten und so schwarz wie ihr Haar, das sie kurzgeschnitten trug. Die Nase war aufgeworfen, man sah die Nasenlöcher, die oft nervös vibrierten. Ihr roter Mund leuchtete samtig und feucht. Sibylle besaß den größten Mund, den ich je gesehen hatte. Es war ein enormer Mund. Ein Freund hatte einmal mit ihr eine Wette abgeschlossen. Es ging darum, ob sie imstande war, einen geschälten kalifornischen Pfirsich in den Mund zu nehmen. Sibylle hatte die Wette gewonnen.
»Wir werden sehr glücklich sein«, flüsterte sie. Meine Brust wurde naß, dort, wo ihre Tränen sie trafen. »Ich werde auf dich warten«, flüsterte sie, »ich werde unsere Schallplatten spielen und die Bücher lesen, die du mir gebracht hast. Ich werde Rachmaninoff spielen, unser Klavierkonzert!«
»Lade deine Freundinnen ein.«
»Ja, Paul.«
Ihre Augen verschleierten sich, eine milchige Trübung nahm den leuchtendschwarzen Pupillen ihren Glanz. Das war stets so, wenn Sibylle sich traurig fühlte. Dann senkten sich seltsame Vorhänge der Schwermut über ihre Augen.
»Und geh abends aus.«
»Nein, ich will nicht.«
»Doch! Geh ins Theater. Oder zu Robert.« Robert hieß der Besitzer einer Bar auf dem Kurfürstendamm. Wir kannten ihn gut. Sibylle und ich gingen oft zu ihm, wenn ich in Berlin war.
»Ich will nicht zu Robert gehen«, sagte sie, »und du willst auch nur hören, daß ich nicht gehen will.«
»So ist es, mein Liebling.« Ich dachte: Die Stille dauert zu lange, der Frieden ist zu groß. Wo bleibt der Lärm? Wann landet die nächste Maschine?
»Wenn ich wiederkomme«, sagte ich indessen, »müssen sie mir im Büro Urlaub geben.«
»Ja«, sagte sie still.
»Ich habe dann auch genug Geld, Sibylle. Wir fahren in den Süden, bis Neapel. Dann nehmen wir ein Schiff und reisen durchs Mittelmeer. Nach Ägypten! Vier Wochen lang.«
»Versprichst du es mir?«
Ich legte eine Hand zwischen ihre Beine, weil ich bei etwas schwören wollte, woran ich glaubte, und sagte: »Ich verspreche es dir.«
»Vier Wochen«, wiederholte sie. »Und du wirst keine Artikel schreiben?«
»Keine einzige Zeile«, sagte ich. »Ich werde dich nur liebhaben. Ich werde dich vor dem Frühstück liebhaben, mein Herz, und nach dem Frühstück, und vor dem Mittagessen und nach dem Mittagessen, und vor dem Abendessen und nach dem Abendessen.«
»Bitte, nicht nach dem Mittagessen«, flüsterte sie, und ich fühlte, daß sie wieder weinte. Meine Füße waren kalt. Ich bewegte die Zehen hin und her und wartete auf die neue Maschine. Wo blieb sie? Warum zerstörte sie noch nicht den Frieden der letzten Minuten?
Plötzlich sagte sie: »Seit ich dich kenne, bete ich wieder. Ich habe viele Jahre lang nicht gebetet. Aber jetzt tue ich es. Ich bitte Gott, daß er uns zusammen läßt. Und daß wir glücklich bleiben. Darum bitte ich Gott.« Sie hob sich auf einer Schulter und stützte den Kopf mit einer Hand. Der Blick ihrer schrägen, leidenschaftlichen Katzenaugen ruhte auf meinem Mund. »Du glaubst nicht an ihn.«
»Nein«, sagte ich.
»Hast du nie an ihn geglaubt?«
»Doch«, sagte ich. »Früher. Vor dem Krieg. Im Krieg habe ich damit aufgehört.« Ihr großer Mund stand leicht geöffnet, ich sah die schönen Zähne. Ich setzte hinzu: »Aber bete du ruhig. Vielleicht hilft es. Man kann nie wissen.«
Sie antwortete mit ihrer heiseren Stimme: »Wir lieben uns. Das sage ich auch Gott immer. Ich sage, schau uns an, lieber Gott, wir betrügen einander nicht, und einer ist das Glück des anderen. Mach, daß es so bleibt, lieber Gott! Es gibt nicht mehr viel Menschen in dieser Zeit, die einander lieben. Laß keinen von uns unruhig werden, rastlos, hungrig nach einem anderen Menschen …«
Ich lag auf dem Rücken und sah ihre winzigen Brüste an und ihre schönen, schmalen Handgelenke, und ihre langen, zarten Finger, und ich schwieg.
»Immer wenn du fliegst, bete ich«, flüsterte Sibylle. »Ich bete, daß du Erfolg in deiner Arbeit hast und daß du mich weiter so liebst wie in diesem ersten Jahr, und daß du keine Frau findest, die dich mehr aufregt als ich …«
Indessen dachte ich: Eben haben wir einen Krieg erlebt. Bald kommt ein neuer. Wenn er doch nur nicht zu bald käme! Ein paar Jahre noch, ein paar Jahre des Friedens! Sibylle hatte es leicht, sie konnte mit Gott sprechen. An ihn zu glauben, war das Einfachste auf der Welt.
Oder nein, es war wohl das Schwerste.
Ich hätte gern an Gott geglaubt. Dann hätte ich ihn jetzt auch bitten können, uns zu beschützen. Ich streichelte Sibylles Hand und wartete auf das aus dem Frieden entstehende Brausen der neuen Maschine. Und das Brausen kam nicht.
»… du fliegst bis nach Brasilien, Paul«, murmelte Sibylle an meinem Ohr und senkte dabei ihre Stimme noch mehr. »Es heißt, daß es in Rio de Janeiro die schönsten Frauen der Erde gibt.«
»Du bist die schönste Frau der Erde.«
»Wenn du unbedingt mußt, Paul, dann betrüg mich in Rio. Es macht mir nichts aus.«
»Das ist nicht wahr!«
»Doch, es ist wahr. Es ist wahr, wenn es nur in Rio geschieht, und wenn du in zehn Tagen wieder bei mir bist …«
»Ich werde dich nicht betrügen«, sagte ich, »schon aus Aberglauben nicht.«
»Du bist klug«, flüsterte sie. »Du bist der klügste Mann von der Welt! Du weißt, daß es nicht mehr dasselbe sein würde, wenn erst der eine den anderen einmal betrogen hat.«
Ich dachte: Ich habe in meinem Leben mit vielen Frauen gelebt, und Sibylle hat mit vielen Männern gelebt. Aber ich habe alle meine Frauen verlassen, oder sie haben mich verlassen, und Sibylle ist es ebenso ergangen. Wir waren beide voller Unruhe, bevor wir einander trafen, wir haben zuviel getrunken und zuviel geraucht und keinen Frieden gehabt. Seit wir einander kennen, schlafen wir gut, und die kleinen Stunden des Morgens haben ihren Schrecken für uns verloren. Wir wachen gern auf, wenn es noch dunkel ist, denn wir schlafen im selben Bett und halten einander immer im Arm, und das Bett ist so schmal, daß nur Menschen, die einander wirklich lieben, in ihm Glück finden können. »Natürlich«, flüsterte Sibylle, während ich das dachte, »werden wir einander nicht gleich verlassen, wenn einer den anderen zum erstenmal betrügt!«
»Natürlich nicht, mein Liebling.«
»Aber es würde nicht mehr dasselbe sein!«
»Nein«, sagte ich. Wo blieb die nächste Maschine? Warum kam sie nicht und zerstörte alles mit dem Toben ihrer vier Motoren? Geschah ein Wunder? Es gab doch keine Wunder …
»Das Vertrauen wäre fort«, sagte Sibylle. »Und wir lieben einander doch so sehr, weil wir einander vertrauen. Weißt du, daß man in der ganzen Stadt von uns spricht?«
»Mein Alles«, sagte ich. »Mein Schönes.«
»Alle beneiden uns.«
»Ich würde uns auch beneiden!«
»Paul?«
»Ja?«
»Wenn es sehr heiß ist in Rio, und wenn du viel getrunken hast, und wenn du dich sehr … unruhig fühlst – dann tu es!«
»Ich will nicht.«
»Du bist großartig. Aber wenn sie einen großen, aufregenden Mund hat, so wie ich –«
»Ich will nicht!«
»– und lange, aufregende Beine, und schwarze Haare, und kleine, feste Brüste –«
»Sei ruhig!« Ich richtete mich auf und drückte sie an mich und küßte sie. Sie seufzte leise und fühlte sich sehr zart und zerbrechlich in meinem Arm an. Sie flüsterte: »Es heißt, du beschützt die Liebenden, Gott. Beschütze auch uns. Bitte, Gott, bitte!«
Dann hörte ich endlich das ferne Brausen; eine neue Maschine flog Berlin an. Ich preßte Sibylles Körper an mich, meine Lippen blieben auf den ihren, ich fühlte ihr Herz schlagen, wir waren eins. Und doch kam das Brausen näher, eiskalt und unerbittlich, zerriß den Frieden, zerstörte die Stille, wurde maßlos. Die Fensterscheiben klirrten wieder. Ich schloß die Augen. Es war wie eine schwere, aber erlösende Heimkehr in die Gewißheit von Trauer, Unrast und spätem Leid. »Wir müssen aufstehen«, sagte ich.
»Ja, mein Herz.«
»Gib mir die Prothese.«
Sie glitt aus dem Bett und lief nackt und lautlos durchs Zimmer zu dem Stuhl, auf dem die Prothese lag. Es war eine Prothese für ein linkes Bein. Mir fehlte ein linkes Bein, vom Kniegelenk an, ich besaß nur noch ein rechtes.
Sie kam mit der Prothese zurück, kniete vor mir nieder, und ich setzte mich im Bett auf, damit sie die Prothese an den Stumpf schnallen konnte. Der Stumpf schmerzte.
»Es kommt Regen«, sagte ich.
»Jetzt im Winter?«
»Du kannst dich darauf verlassen.«
Es war eine ganz moderne Prothese, und ich konnte mich sehr gut mit ihr bewegen. Nach dem Krieg hatte ich zuerst Krücken benützt, bis die Wunde verheilt war. Dann kam eine Prothese, nicht diese, eine andere. Die erste Prothese besaß einen starren linken Schuh, der rechte wurde mitgeliefert. Aber der linke Schuh saß an der Prothese fest. Das irritierte mich. Ich wohnte viel in Hotels. Und abends stand ich dann immer vor demselben Problem, wenn ich meine Schuhe vor die Tür stellen wollte. Entweder ich stellte beide, mit der Prothese, hinaus, oder nur den rechten. Das sah dann aber wieder so aus, als wäre ich verrückt oder betrunken. Deshalb erwarb ich eine zweite Prothese. Ihren linken Schuh konnte man abnehmen wie den von dem gesunden rechten Fuß. Sie war sehr kostspielig gewesen, diese Prothese, aber sie war auch aus bestem Leder und verchromtem Nickel hergestellt.
Sibylle hatte das Kunstbein angeschnallt, die Riemen saßen fest, der Stumpf ruhte auf dem kleinen Schaumgummikissen.
»Sitzt sie gut so?«
Ich stand auf und wippte ein paarmal.
»Ja«, sagte ich, »sie sitzt ausgezeichnet.«
2
Ich lese, was ich bisher geschrieben habe, und überlege, ob es nicht bei weitem meine Kräfte übersteigt, diesen Bericht fortzusetzen. Etwas über zwei Monate sind vergangen, seit an jenem kalten, windstillen Morgen um fünf Uhr früh das Telefon läutete. Ich schreibe diese Worte in einem komfortablen Zimmer im vierten Stock des Hotels Ambassador in Wien. Das Zimmer ist in den Farben Rot, Weiß und Gold gehalten. Auch die Tapeten sind rot. Es ist heller Tag. Aus der Tiefe dringen vom Neuen Markt her Autogeräusche und Menschenstimmen zu mir herauf. Ein Fenster steht offen.
Wir schreiben Dienstag, den 7. April 1956. Es ist schon recht warm in Wien, recht warm für April. Die Blumenfrauen vor dem Eingang der Kapuzinergruft, die sich gegenüber dem Hotel befindet, verkaufen kleine Sträuße von Primeln, Schneeglöckchen und Veilchen. Der Frühling scheint in diesem Jahr sehr zeitig zu kommen.
Ich wurde bereits vor einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen. Aber mein Arzt, Doktor Gürtler, besteht darauf, daß ich mich noch ein paar Tage völlig ruhig verhalte.
»Die Wunde heilt doch zu«, protestierte ich. »Man versichert mir von allen Seiten optimistisch, daß ich mich schon lange außer Lebensgefahr befinde.«
»Warum wollen Sie aufstehen?« fragte er mich.
»Ich muß etwas aufschreiben.«
»Dazu ist es zu früh.« Doktor Gürtler ist ein älterer, weißhaariger Herr, den mir der Wiener Vertreter der West-Presse-Agentur sehr empfohlen hat. Er kümmert sich rührend um mich. Seit meiner Entlassung aus dem Krankenhaus besucht er mich täglich. Als ich ihn gestern bat, aufstehen zu dürfen, sagte er kopfschüttelnd: »Sie sind unvernünftig, Herr Holland! Fünf Zentimeter höher, und die Kugel trifft Ihr Herz, und Sie äußern niemals mehr den Wunsch, irgend etwas aufzuschreiben.«
»Sie sehen«, antwortete ich, »was fünf Zentimeter ausmachen können! Herr Doktor, bitte erlauben Sie mir, täglich eine Stunde zu schreiben. Es macht mir keine Mühe. Ich habe eine kleine Reiseschreibmaschine. Ich tippe selber – seit Jahren. Und ich muß schreiben, ich muß!«
Darauf sagte Doktor Gürtler, der über alles informiert ist, was mir in den letzten beiden Monaten widerfuhr:
»Sie sind im Begriff, etwas sehr Unkluges zu tun.«
»Nämlich was?«
»Sie wollen sich mit Ihrer Vergangenheit beschäftigen.«
»Ja«, sagte ich. »Nur so kann ich sie vergessen.«
»Sie denken noch immer an diese Frau.«
»Woher wissen Sie das?«
»Die Nachtschwester hat es mir erzählt.«
Ich habe eine Nachtschwester im Hotel Ambassador. Die West-Presse-Agentur hat darauf bestanden. Und zum erstenmal in meinem Leben habe ich nach dem Mordversuch auf mich das Gefühl, daß ich ein wichtiger und geschätzter Mitarbeiter der West-Presse-Agentur bin.
Doktor Gürtler fuhr fort: »Sie sprechen im Schlaf. Manchmal schreien Sie auch. Die Nachtschwester ist sehr beunruhigt.«
Ich erwiderte: »Ist zu verstehen, was ich sage und schreie?«
Er nickte stumm, und in seine weisen, alten Augen trat ein Ausdruck von Mitleid. Ich dachte: Bin ich schon ein Mensch, mit dem man Mitleid empfindet?
»Sie sprechen nur von ihr«, sagte Doktor Gürtler. »Nur von – dieser Frau.« Er machte eine abschätzende Pause vor den letzten beiden Worten.
»Ich habe diese Frau geliebt«, sagte ich.
»Sie sollen nicht mehr an sie denken. Sie müssen gesund werden, Herr Holland. Dann, wenn Sie erst gesund sind, machen Sie eine Reise, eine weite Reise, vielleicht ans Mittelmeer, vielleicht nach Ägypten. Und auf dem Schiff schreiben Sie sich alles von der Seele. Alles, was Sie erlebt haben!«
»Ich wollte immer schon eine Reise ans Mittelmeer unternehmen.«
»Nun, sehen Sie!«
»Ich wollte mit ihr reisen, Herr Doktor.«
Darauf schwieg er, und auch ich schwieg und sah die roten Seidentapeten meines Zimmers an, und die vergoldeten Sessellehnen und den weißen Plafond.
»Mit ihr können Sie nicht mehr reisen«, sagte Doktor Gürtler. »Das wissen Sie. Sie ist tot.«
»Ja«, sagte ich. »Sie ist tot.« Ich hatte eine Flasche Whisky unter meinem Bett versteckt, und eine zweite Flasche verwahrte ich in meinem Schrank. Der Etagenkellner hatte sie mir beide gebracht, ich hatte ihn bestochen, denn es war mir verboten, Whisky zu trinken. Aber wenn ich nicht Whisky trank, konnte ich nicht schlafen, und wenn ich nicht schlafen konnte, erschien mir Sibylle und setzte sich auf meine Brust und ließ mich nicht atmen. Auch während ich mit Doktor Gürtler sprach, war sie im Raum, ich fühlte es deutlich. Ich konnte sie nicht sehen. Ich konnte Sibylle niemals mehr sehen. Nur fühlen konnte ich sie noch. Wenn sie sich auf meine Brust setzte und mir den Atem nahm. Deshalb hatte ich den Etagenkellner bestochen, mir Whisky zu bringen. Der Whisky war stärker als Sibylle. Wenn ich ihn trank, kam sie nicht. Der Etagenkellner versorgte mich auch mit Eis und Sodawasser. Er war ein verständiger Mensch und hieß Franz. Ich war sehr glücklich, zu denken, daß ich noch eineinhalb Flaschen Whisky besaß. Es schien aller Trost zu sein, den ich noch hatte.
»Ich darf also nicht aufstehen?« fragte ich den Arzt, entschlossen, gleich nach seinem Abgang ein Glas oder zwei zu trinken, denn ich fühlte, daß Sibylle im Zimmer war, ich konnte den Duft ihrer Haut riechen, ich konnte sie atmen hören. Es machte dabei nichts aus, daß Sibylle tot war. Ich hörte sie dennoch atmen. Ich fühlte dennoch den Duft ihrer Haut.
»Ich verbiete Ihnen vorläufig mit aller Bestimmtheit, aufzustehen und zu schreiben«, sagte Doktor Gürtler, sich erhebend. Gleich nachdem er gegangen war, stand ich auf. Ich trank ein Glas Whisky und zog meinen Schlafrock an. Die Wunde unter dem Herzen zog und stach. Ich war noch sehr benommen. Wahrscheinlich hatte ich Fieber. Ich setzte mich dennoch ans Fenster und drehte ein Blatt Papier in meine kleine Schreibmaschine. Sibylle war im Raum, ich fühlte es nun ganz stark, der Duft ihrer Haut und ihr Parfüm betäubten mich. Ich trank noch einen Schluck. Es war wie eine wundervolle Erleichterung, als ich die ersten Worte dieses Berichtes zu schreiben begann, als ich mich jener Nacht entsann, in der alles seinen Anfang nahm, jener schneereichen, bitterkalten Nacht in Berlin. Ich schrieb etwa zwei Stunden. Dann brach ich ab.
Und nun sitze ich hier und überlege, ob es nicht bei weitem meine Kräfte übersteigt, fortzufahren. Viel ist geschehen in den letzten zwei Monaten. Und es ist mir geschehen. Mir, der ich darauf nicht vorbereitet war. Von allen Menschen mir. Was soll ich tun?
Schweiß rinnt mir vom Nacken in den Hemdkragen und macht die Tasten meiner Maschine glatt. In meinen Ohren dröhnt es. Meine Lippen sind trocken. Mein Herz klopft laut. Gott schützt die Liebenden. So sagte Sibylle. Aber hat er es getan? Bei jedem Atemzug schmerzt mich noch die Wunde unter dem Herzen, aus welcher Doktor Gürtler, geschickt und umsichtig, vor kurzem eine stählerne Kugel des Kalibers 6,65 gezogen hat.
Gott schützt die Liebenden …
Unten in der Tiefe preisen die Wiener Blumenfrauen ihre Waren an, Veilchen, Primeln, Schneeglöckchen. Es ist sehr warm in Wien, sehr warm für April. Ein Flugzeug zieht seine unnahbare Bahn über die Stadt, ich kann die Motoren brummen hören.
Ein Flugzeug! Es hat keinen Sinn.
Ich muß weiterschreiben. Nur so kann ich vergessen, was geschehen ist. Was geschehen ist in den letzten beiden Monaten und was seinen Beginn nahm in der eingeschlossenen, viergeteilten Stadt Berlin, im Herzen eines zweigeteilten Landes, an einem Wintertag, um fünf Uhr morgens, im Grunewald, in einer Wohnung des Hauses Lassenstraße 119.
3
Das Haus war sehr groß.
Ein reicher Mann hatte es um die Jahrhundertwende gebaut, ich glaube, er war der persönliche Notar des deutschen Kaisers. Das Haus stand mitten in einem alten Park. Es gab auch einen See, der im Winter dick zufror. Bei schönem Wetter spielten immer Kinder auf dem Eis. Ihr Lachen und ihre Rufe drangen bis in Sibylles Zimmer.
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man das große Haus unterteilt, Trennwände gezogen, Durchgänge geschaffen und Durchgänge zugemauert und so insgesamt vier Wohnungen entstehen lassen, die alle ihre Mieter fanden. Es waren stille, zurückgezogene Leute: ein Ehepaar, ein Industrieller mit seiner Freundin, zwei junge Maler. Man sah sich eigentlich nur im Park, denn die Wohnungen hatten eigene Eingänge. Die Villa besaß keine direkte Nachbarschaft: Das Haus auf der linken Seite war im Krieg ausgebrannt und stand nun da als schwarze, verwitterte Ruine, die langsam unter rankendem Unkraut verschwand – und auf der rechten Seite lag der See. Ich erwähne diese Abgeschiedenheit besonders, weil sie im Verlauf der Ereignisse eine gewisse Rolle spielt.
Der Portier hieß Wagner. Er war ein kleiner, blasser Mann mit einer großen, schwerfälligen Frau und einer Tochter von sechzehn Jahren. Nach einem akuten Anfall von Scharlach hatte diese Tochter die Sprache verloren. Maria – so hieß das Mädchen – vermochte nur noch heisere, bellende Laute hervorzuwürgen. Man meinte stets, sie würde an ihnen ersticken. Sie war blond und stark entwickelt. Seit einem Jahr trieb sie sich mit Jungen herum. Manchmal verschwand sie eine Nacht lang. Die Mutter war verzweifelt. Sie sagte einmal zu mir: »Die Jungen wissen, daß Maria nichts erzählen kann.«
Maria stand neben ihr und sah mich aus halbgeschlossenen Augen an. Die Spitze ihrer Zunge glitt schnell über die Lippen. Dann stieß sie ein paar hohe, grelle Töne aus und rannte davon …
»Es ist ganz windstill«, sagte Sibylle. Sie stand am Fenster, als ich aus dem Badezimmer zurückkam, und sie trug jetzt einen Morgenrock. Sie war noch ungeschminkt. »Du wirst einen guten Flug haben«, sagte sie und sah in den dunklen Park hinunter. »Ich glaube, es ist sehr kalt.« Sie sprach immer weiter. Ein Satz kam. Dann eine Pause. Dann wieder ein Satz. »Außerdem gibt es Glatteis.« Ihre großen schwarzen Augen wichen mir aus. »Hoffentlich sind die Startbahnen frei.« Ich nahm sie an den Schultern und drehte sie zu mir um. »Mein Liebling«, sagte ich. Sie küßte mich auf die Wange und seufzte leise. Ich schob eine Hand unter den Morgenrock und berührte Sibylles Schulter. Sie wich zurück. »Nicht«, sagte sie. »Bitte nicht. Es macht mich ganz krank, wenn du mich anrührst, und ich weiß, daß wir keine Zeit mehr haben.«
»Wir haben noch Zeit.« Meine Hand glitt tiefer. »Ein wenig Zeit haben wir noch.«
»Wir sind beide viel zu nervös dazu«, sagte sie. »Zieh dich an. Ich koche Kaffee.« Sie lief in die Küche. Ich trat in die kleine Halle, die zwischen den zwei Zimmern der Wohnung lag und deren Türen auf eine weite Steinterrasse hinausführten. Ich sah ins Freie. Die Straßenlaternen brannten noch. Der Himmel war bleigrau. Es wehte tatsächlich kein Windhauch.
Während ich mich anzog, hantierte Sibylle in der Küche. Dann packte ich meine wenigen Kleidungsstücke ein und legte meine Schreibmaschine auf den Koffer. Nun hörte ich Sibylle im Badezimmer. Ich setzte mich neben das Regal, in dem ein Teil ihrer Bücher stand. Sie hatte viele Bücher, hauptsächlich italienische. Sibylle war lange in Italien gewesen. Jetzt verwendete sie die Bücher beruflich: Sie war Sprachlehrerin.
Sie liebte Italien, sie erzählte immer wieder von diesem Land. Ich denke, sie war in Italien sehr glücklich gewesen. Sie hatte eine Menge Münzen in die Fontana di Trevi in Rom geworfen. Es hieß, daß man zurückkehren mußte in die Ewige Stadt, wenn man das tat …
Ich zog einen dünnen Band aus dem Regal und stellte fest, daß es eine kritische Arbeit über Anaximander von Milet war. Las Sibylle so etwas? Sie hatte seltsame Bücher, die überhaupt nicht zu ihr paßten. Ich blätterte in dem Buch, während ich hörte, wie sie ihre Zähne putzte, und las dann eine Stelle, die jemand mit Bleistift angestrichen hatte: »Der Ursprung der Dinge ist das Grenzenlose. Woraus sie entstehen, darin vergehen sie auch mit Notwendigkeit, denn sie leisten einander Buße und Vergeltung für ihr Unrecht nach der Ordnung der Zeit.«
»Paul?«
Ich sah auf. Sie stand vor mir, sie trug nur Strümpfe und einen Halter, sonst war sie nackt. Ich sah ihren ebenmäßigen Jungenkörper, das schmale Becken, die breiten Schultern, die kleinen Brüste mit den hervorstehenden Warzen. Sie streckte mir die Arme entgegen. Nun sah ich auch das Muttermal unter der rechten Achselhöhle. Es war so groß wie ein Markstück und sehr braun.
»Was soll ich anziehen? Das grüne Kostüm oder das schwarze?«
»Das schwarze«, sagte ich. »Es ist wärmer.«
»Schau mich an«, sagte sie. »Schau mich noch einmal genau an, damit du nicht vergißt, wie ich aussehe.«
»Das vergesse ich nie. Ich kann zu jeder Zeit die Augen schließen und mir dein Gesicht vorstellen und deinen Körper, und immer entstehen beide sofort ganz deutlich und genau.«
»Mir geht es auch so.«
»Weil wir uns lieben.«
»Ich bin gleich fertig. In zehn Minuten können wir frühstücken«, sagte sie und lief ins Schlafzimmer zurück. Ich fühlte mich müde und leer. Mein Kopf schmerzte, und meine Hände waren kalt.
4
Wir tranken nur den heißen Kaffee, essen konnten wir beide nichts. Die frischen Brötchen lagen zwischen uns, die weichen Eier blieben in ihren Bechern stehen. Das bunte Jam, die helle Butter.
»Es hat keinen Sinn«, sagte Sibylle. »Ich bekomme keinen Bissen hinunter.«
»Wir Hysteriker«, sagte ich. »Ein Jahr kennen wir uns nun, und jedesmal, wenn wir uns trennen müssen, machen wir dasselbe Theater.«
Ich ging zum Telefon und rief ein Taxi. Sibylle zog ihren schweren Mantel an. Wenn sie seinen großen Kragen aufstellte, verschwand ihr Kopf vollständig in ihm. Ich nahm meinen Koffer und ging zur Tür.
»Laß mich deine Schreibmaschine tragen«, bat sie. Sie hatte jetzt einen Hut auf dem Kopf, der aussah wie ein Tropenhelm, einen grauen Filzhut. Der Mantel war auch grau. Er hatte große Taschen. Wir gingen die Treppe hinunter und traten ins Freie. Es war stechend kalt, der Frost verlegte meine Nase.
»Paß auf, Liebling«, sagte ich. »Es ist wirklich sehr glatt.«
An meiner Seite trippelte sie auf ihren hohen Absätzen vorsichtig zum Tor. Als wir die Straße erreichten, war das Taxi noch nicht da. Ein Bäckerjunge mit seinem Fahrrad trug Brötchen aus. Aber er schob das Rad, denn es war zu glatt, um zu fahren. Die Straße glänzte wie Spiegel. Der Junge ging zusammengekrümmt, weil ihn fror, und hängte weiße Leinensäckchen an die Schnallen der Gartenpforten.
Das Taxi kam lautlos wie ein Schiff übers Meer. Plötzlich erfaßten uns die Lichtkegel seiner Scheinwerfer. Der Chauffeur hielt und stieg aus, um meinen Koffer zu verstauen.
»Zum Flughafen«, sagte ich. Das Einsteigen war schwer, ich konnte die Prothese nur mühsam in den Wagen heben. Der Stumpf schmerzte noch immer. Das Wetter schlug um. Im Fond tastete ich nach Sibylles Arm. Sie zog einen Handschuh aus und verflocht ihre Finger fest mit den meinen. Es war sehr kalt im Wagen, und es roch nach Benzin und altem Leder.
In den Kurven schleuderte der Wagen.
»Fahren Sie langsamer«, sagte ich, »wir haben es nicht eilig.« Der Chauffeur gab keine Antwort.
Wir fuhren jetzt durch die Stadt. Frierende Arbeiter standen bei den Autobushaltestellen. Es war noch sehr still. Ich sah zwei kleine Mädchen, die auf und nieder hüpften, um die Füße warm zu halten. Was machten Kinder um diese Zeit auf der Straße?
Ich sagte zu Sibylle: »Wenn du nach Hause kommst, leg dich noch einmal ins Bett und versuche zu schlafen. Nimm Tropfen.«
Sie nickte. Wir fuhren jetzt über eine große Brücke. Unter ihr zog sich ein Gewirr von Schienen hin. In der Ferne stieß eine Lokomotive Dampf aus. Die weiße Säule stieg in der Dunkelheit auf und verlor sich im Bleigrau des Himmels.
Ohrenbetäubend dröhnte plötzlich ein Flugzeug über uns hinweg, es befand sich unmittelbar vor der Landung. Ich sah die grünen und roten Positionslichter.
»Wir sind da«, sagte Sibylle tonlos.
Der Chauffeur erreichte den großen Platz vor dem Zentralflughafen. In der Morgendämmerung sah ich das Denkmal der Luftbrücke, den aufsteigenden Betonbogen, der plötzlich zu Ende war. Ich fragte: »Sind eigentlich viele Maschinen abgestürzt während der Blockade?«
»Ein paar«, sagte Sibylle. »Die Piloten hatten es schwer, unser Flughafen lag mitten in der Stadt. Die Maschinen mußten zwischen den Häusern landen und aufsteigen.« Der Chauffeur, der bisher kein Wort gesprochen hatte, sagte plötzlich: »Einmal war ich dabei.«
»Bei einem Absturz?«
»Ja, Herr.« Er wies mit dem unrasierten Kinn auf eine Ruine. »Dort drüben war’s. Ich arbeitete damals hier.«
Er sprach die ganze Zeit mit abgewandtem Gesicht. Vorsichtig fuhr er jetzt über den spiegelglatten Platz auf die Lichter des Flughafens zu. »Ich half die Maschinen ausladen. Na, und eines Abends, es war kalt wie heute, da kommt so ein Ami herunter, beladen mit Mehl, verstehen Sie. Kommt in der Einflugschneise etwas zu weit nach links – und mitten rein in das Haus! Mensch, war das vielleicht eine Schweinerei!« In der Erinnerung schüttelte der Chauffeur noch angewidert den Kopf. »Sechs Tote, ein Haufen Verletzte. Bevor wir noch was machen konnten, begann das Mehl zu brennen.«
»War der Brand nicht zu löschen?«
»Herr, die Hitze war so groß, daß das Flugzeugwrack weißglühend wurde! Aber vor dem Haus stand ein Baum, eine alte Kastanie. Mitten im Schnee, ich sage ja, es war so kalt wie heute, vielleicht Mitte Januar. Und am nächsten Morgen, was glauben Sie, was geschehen war?«
»Was?« fragte ich. Der Wagen hielt vor dem Eingang des Flughafens, ein Träger eilte herbei.
»Die Kastanie hatte zu blühen begonnen!«
»Nein!«
»So wahr ich vor Ihnen sitze«, sagte der Chauffeur, drehte sich um und nickte ernst mit dem Kopf. »Die Hitze war dran schuld. Die Blätter kamen heraus – und die Blütenkerzen! Es sah unheimlich aus, Herr! Überall Trümmer und Blut und Mehl – und mittendrin in der ganzen Scheiße steht so eine alte Kastanie und blüht!«
Ein Träger riß den Wagenschlag auf und grüßte.
»Panair do Brasil«, sagte ich. »Nach Rio. Nehmen Sie den Koffer. Die Maschine trage ich selber.«
»Ist gut.«
Ich sagte zu dem Chauffeur: »Wenn Sie Ihre Uhr abstellen und warten wollen – die gnädige Frau fährt wieder in den Grunewald zurück.« Ehe der Chauffeur noch seine Zustimmung aussprechen konnte, unterbrach ihn Sibylle in einem Tonfall, den ich an ihr nicht kannte: »Nein, danke! Ich nehme eine andere Taxe oder vielleicht auch den Bus.«
Ich sah sie an. Sie wich meinem Blick aus. Ich zuckte die Schultern und bezahlte den enttäuschten Chauffeur. Sibylle war mittlerweile vorausgegangen. Beim Eingang zur Wartehalle holte ich sie ein: »Was war denn?«
»Wo?«
»Im Taxi.«
»Nichts!« Sie lachte künstlich. »Der Chauffeur war mir unsympathisch!«
»Aber die Geschichte vom Kastanienbaum –«
»Gerade wegen der Geschichte war er mir unsympathisch!«
»Das verstehe ich nicht«, sagte ich, überrascht von der Heftigkeit ihres Ausbruchs.
»Die Geschichte ist doch nicht wahr!« Zwischen ihren Augenbrauen entstand eine senkrechte Falte, die Nasenflügel vibrierten nervös. »Der Mann lügt um einer Pointe willen. Ich hasse Menschen, die so etwas tun!« Sie war stehengeblieben, ihre Stimme hob sich. So etwas hatte ich mit ihr noch nicht erlebt. »Die Blütenkerzen und die Blätter!« fuhr sie erbittert fort. »Nicht genug mit den Blättern allein! Übertreibung und Angabe! Aus dem Tod entsteht das Leben, es gibt kein Ende, und all dieser symbolische Unsinn! Widerlich ist das!« Ihre Unterlippe bebte. »Was tot ist, ist tot! Nie kehrt es wieder, in keiner Form!«
»Sibylle!« sagte ich laut und nahm sie am Arm. Da sah sie mich an wie eine Erwachende, mit völlig leeren, verständnislosen Augen, in die langsam ein Ausdruck von Verlegenheit trat. »Was ist denn los mit dir?«
»Nerven«, sagte sie und wandte den Kopf fort. »Nichts als Nerven. Komm!« Sie führte mich an der Hand in das Flughafengebäude hinein. Dabei drückte sie meine Finger mit den ihren. Ich begriff, was das bedeutete; ich sollte nicht mehr von ihrem Ausbruch sprechen.
Die Halle des Flughafens war von Neonröhren erleuchtet, das Licht kalt und hart. Alle Menschen in ihm sahen krank aus. Hinter den langen Pulten der verschiedenen Fluggesellschaften arbeiteten viele Angestellte. Die jungen Mädchen hatten vor Müdigkeit ganz kleine Augen, die Männer in ihren blauen Anzügen waren nervös.
Die Menschenmenge, die ich erblickte, verblüffte mich. Ich hatte nicht soviel Betrieb erwartet. Die ganze lange Halle war überfüllt mit Fluggästen, Frauen, Männern, Kindern.
»Was ist denn hier los?« fragte ich meinen Träger.
»Politische Flüchtlinge aus der Ostzone«, sagte er. Es klang verächtlich. »Werden in den Westen geflogen.« Er stellte meinen Koffer auf eine elektrische Waage beim Schalter der Pan American Airways und zuckte die Schultern: »So geht das bei uns jeden Morgen. Soll noch schlimmer werden, heißt es.«
Ich sah die Flüchtlinge an. Sie saßen auf ihren Bündeln und Koffern, schlecht gekleidet, entrechtet, demütig. Sie sprachen leise miteinander. Die Frauen trugen Kopftücher, die Männer bäuerliche Anzüge. Viele hatten keine Krawatten oder Hemden ohne Kragen. Ihre Hände waren schwielig, verarbeitet, rot vor Kälte. Ein kleines Kind begann zu weinen.
»Macht fünfzig Pfennig«, sagte der Träger. Er tippte an seine Kappe und verschwand. Sibylle hielt sich fest an mir an. Ich drückte sie plötzlich an mich, denn mir fielen alle die anderen Flüchtlinge ein, die ich in Saigon gesehen hatte, und die Flüchtlinge in Seoul, und die Flüchtlinge auf der Insel Quemoy. Immer hatte ich sie auf Flughäfen gesehen, auf ihren Bündeln sitzend, die Männer mit dem starren und doch demütigen Blick ins Nichts, die Mütter mit den unruhigen Kindern an der Brust, die vor sich hinmurmelnden uralten Frauen, die Großväter in Rollsesseln. Immer hatten sie an einem Bindfaden einen Zettel um den Hals getragen. Stets hatte der Zettel neben dem Namen eine Nummer aufgewiesen. Und nach den Nummern waren sie stets aufgerufen worden. Nach den Nummern. Nicht nach den Namen. »Achtung«, sagte eine Lautsprecherstimme. »Air France gibt den Abflug ihres Clippers sieben-sechsundneunzig nach München bekannt. Die Passagiere werden durch Flugsteig zwei an Bord gebeten. Bitte Frauen mit Kindern zuerst. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug!« Bewegung kam in die Wartenden. Sie drängten vor. Angehörige hielten sich an den Händen. »Laßt doch die Kinder vor!« schrie jemand. Aber niemand hörte ihn.
Und immerfort hör’ ich in meinem Rücken den Sauseschritt der Zeit, die weitergeht …
Ich preßte Sibylle noch fester an mich. Vor mir verhandelte ein Angestellter der Pan American mit einem Mann aus dem Osten. Ich stand hinter ihm. Der Mann hielt einen alten Hut in der Hand. Er trug trotz der Kälte keinen Mantel, und sein altes Hemd hatte keinen Kragen. Der Mann war unrasiert und bleich. Er sprach Sächsisch. Es war ein einfacher Mann, der nicht begreifen konnte, was ihm widerfuhr.
»Herr Pilot«, sagte er demütig zu dem Angestellten, »bitte, verstehen Sie mich richtig. Wir kommen aus Dresden. Meine Frau, meine beiden Kinder und die Katze.« Seine Katze entdeckte ich erst jetzt. Sie lag unter einer Decke in einem kleinen Korb, der auf der Theke stand. Es war eine dicke rotbraune Katze, die sehr schläfrig wirkte. »Aus Dresden, Herr Pilot!«
»Ich bin kein Pilot«, sagte der Angestellte, ein cholerischer Mann mit einer beginnenden Glatze. »Ich kann Ihnen leider nicht helfen.«
»Herr – wie heißen Sie, bitte?«
»Klär.«
Hinter mir bildete sich eine Menschenschlange. Alles war nervös, aber alles lauschte dem Gespräch des Mannes aus Dresden mit dem Angestellten.
»Herr Klär, verstehen Sie doch, die Katze hat mit uns Dresden verlassen! Es ist sehr weit von Dresden hierher. Wir sind drei Tage unterwegs gewesen. Heimlich sind wir in den Westsektor gekommen. Wir können nicht mehr zurück.«
»Herr Kafanke, das weiß ich alles. Ich –«
»Wir sind anerkannte politische Flüchtlinge! Wir waren alle in der Kuno-Fischer-Straße! Sechs Wochen lang. Auch die Katze. Wir haben alle unsere Papiere!«
»Die Katze nicht«, sagte der Mann, der Klär hieß.
»Aber sie hat doch mit uns Dresden verlassen, Herr! Wir haben ihr Brom ins Fressen gemischt, damit sie ruhig bleibt! Herr Klär, was sollen wir denn tun? Wir können das Tier doch nicht in Berlin zurücklassen!«
»Achtung, bitte! British European Airways geben den Abflug ihres Viscountfluges drei-zweiundvierzig nach Hannover und Hamburg bekannt. Die Passagiere werden durch Flugsteig drei an Bord gebeten. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug!«
»Herr Kafanke, haben Sie Verständnis. Tiere können wir nicht befördern. Es ist gegen die Vorschrift. Sehen Sie, es stehen schon so viele Herrschaften hinter Ihnen in der Schlange, sie haben es alle eilig.«
Der Mann aus Dresden sah die Menschen, die hinter ihm standen, demütig an und verneigte sich wie ein russischer Postmeister vor einem General des Zarenreiches: »Vergebung, meine Herrschaften, bitte, seien Sie mir nicht böse, es geht um meine Katze. Verzeihen Sie den Aufenthalt!«
Keiner von uns sprach. Ein paar von uns nickten.
»Attention, please! Passenger Thompson, repeat Thompson, with PAA to New York, will you please come to the ticket counter! There is a message for you!«
Der Mann, der Kafanke hieß, sagte indessen: »Es ist Mord, wenn Sie mich die Katze nicht mitnehmen lassen, verstehen Sie, Mord!«
»Reden Sie nicht so!«
»Was soll denn aus dem Tier werden?«
»Katzen können für sich selber sorgen. Sie finden immer heim.«
»Heim nach Dresden?« Flüchtling Kafanke hatte Tränen der Wut in den Augen. »Durchs Brandenburger Tor vielleicht?«
»Herr Kafanke, bitte!«
Dem Angestellten Klär trat der Schweiß in feinen Perlen auf die bleiche Stirn.
»Dazu sind wir also geflüchtet, Mutter«, sagte Kafanke zu einer dicken Frau, die hinter ihm auf einem Koffer saß. »Dazu haben wir unser Heim verlassen.«
»Darf Mieze denn nicht mit?«
Ich machte dem Clerk ein Zeichen. »Warten Sie einen Moment«, sagte dieser zu dem Mann aus Dresden. Er kam zu mir. »Wohin fliegen Sie, mein Herr?«
»Aber hören Sie –«, protestierte Kafanke schwach und verstummte. Er streichelte die braune Katze. »Mein Gutes«, sagte er, »mein Schönes, hab keine Angst. Wir verlassen dich nicht. Und wenn ich mit einem amerikanischen General reden muß!«
»Calling for passenger Thompson! Passenger Thompson! Will you please come to the PAA ticket counter!«
Die Katze ließ ein dünnes Miauen hören.
»Ich fliege nach Rio«, antwortete ich dem Angestellten Klär. »Mit der Panair do Brasil.«
Die brasilianische Gesellschaft besaß in Berlin kein eigenes Büro. Pan American agierten für sie. Ich legte meinen Flugschein auf den Tisch.
»Calling passenger Thompson, passenger Thompson, to New York! Come to the PAA ticket counter. There is a message for you!«
Der Angestellte, der Klär hieß, sah in hoffnungsloser Erbitterung die rotbraune Katze an, wischte sich den Schweiß von der Stirn und zog eine Liste heran. »Herr Paul Holland?«
»Ja.«
»Wohnort?«
Ich zögerte. Das war eine Frage, die mir immer wieder unangenehm war, sooft sie auch an mich gestellt wurde. Ich wohnte an vielen Orten und in vielen Städten, aber ich war gar nirgends zu Hause. Ich hatte keine Wohnung, seit Jahren nicht mehr. Die einzige Wohnung, in der ich gelegentlich lebte, gehörte Sibylle. Ich antwortete: »Frankfurt am Main, Parkstraße zwölf.« Das klang wie eine gute Adresse. Es war nur keine. Es war die Adresse des Hotels Astoria, in dem ich ein Jahreszimmer gemietet hatte. In ihm hing ein Bild Sibylles. In ihm gab es einen Schrank voller Wäsche und Anzüge. In ihm gab es ein paar Bücher und viele alte Manuskripte. In ihm gab es alles, was mir auf dieser Welt gehörte. Es war nicht viel. Es war eigentlich recht wenig.
»Warum fliegen Sie nach Rio?« fragte der Clerk.
»Es steht auf meiner Einreiseerlaubnis«, sagte ich, wütend auf Herrn Klär, obwohl ich nur wütend auf mich selber, auf meine Art zu leben war.
»In der Einreiseerlaubnis steht ›beruflich‹.« Er wurde unfreundlich. »Was heißt beruflich?«
»Ich bin ein Korrespondent der West-Presse-Agentur«, erklärte ich ihm, während Sibylles streichelnde Hand mich zu Ruhe und Freundlichkeit mahnte. »Wir besetzen gerade unser Büro in Rio mit neuen Leuten. Ich kenne Rio. Die neuen Leute sind fremd dort. Ich soll sie einführen.«
»Danke, Herr Holland.« Er war jetzt ungeheuer sachlich.
Sibylle lächelte ihn an. Auch er lächelte. »Ich tue nur meine Pflicht, gnädige Frau«, sagte Herr Klär.
»Herr Holland meinte es nicht so.«
»Wir sind alle nervös«, sagte Herr Klär.
Die Katze miaute wieder.
»Achtung, bitte, British European Airways geben die Ankunft ihres Fluges vier-zweiundfünfzig aus Düsseldorf bekannt!«
Und immerfort hör’ ich in meinem Rücken …
»Darf ich jetzt Ihren Seuchenpaß sehen, Herr Holland?« Ich gab ihm das kleine gelbschwarze Heft. Ich hatte mich für diesen Flug impfen lassen müssen. Auf meiner Brust schmerzten noch zwei Stellen von den Injektionen.
»Danke, Herr Holland. Und nun, bitte, das ärztliche Attest.«
Ich gab ihm die Urkunde, aus der hervorging, daß ich weder an Tuberkulose, ägyptischer Augenkrankheit, Lepra noch an Auszehrung und hereditärer Syphilis litt. Dann gab ich ihm die unterzeichnete Versicherung, daß ich mich in Brasilien keiner gegen die bestehende Regierung gerichteten Organisation anschließe noch auf den Straßen betteln, noch der öffentlichen Wohlfahrt zur Last fallen würde.
»Danke, Herr Holland. Ist das Ihr ganzes Gepäck?«
»Ja.«
»Sie haben noch Zeit. Wir werden Sie aufrufen.« Ich nahm meine Schreibmaschine, nickte ihm zu und versuchte, für Sibylle und mich einen Weg zu bahnen. »Erlauben Sie«, sagte ich zu Herrn Kafanke. Er sah mich mit seinen alten, mutlosen Augen an: »Sie sind Reporter, mein Herr. Ich habe es eben gehört. Können Sie nicht meiner Katze helfen?« Ich sah alle Menschen an, die in der großen Halle warteten, und ich sah wieder die Kinder in Seoul und die alten Männer in Salgon und die hysterischen Frauen auf der Insel Quemoy, die sich die Kleider aufrissen und den amerikanischen Piloten die Brüste zeigten als Zeichen ihrer Bereitschaft zur Hingabe, wenn sie nur mitgenommen würden, wenn sie nur mitgenommen würden …
»Ich kann niemandem helfen«, sagte ich leise und hielt mich dabei an Sibylles Arm fest, als wäre er das letzte und einzigste, woran ich mich noch festhalten konnte auf dieser Welt.
»Attention, please«, sagte die Frauenstimme aus dem Lautsprecher, »still calling passenger Thompson, passenger Thompson …« Sie suchten ihn noch immer, diesen Herrn Thompson, Fluggast der Pan American World Airways nach New York. Eine Nachricht wartete auf ihn.
5
Im Flughafenrestaurant begrüßten mich die Kellner wie einen alten Bekannten. Ich war schon sehr oft hier gewesen. Die Kellner konnten an unseren Gesichtern stets ablesen, ob ich gerade abflog oder eben angekommen war.
Das Lokal war fast leer. Durch die großen dunklen Scheiben sah man zu den wartenden Maschinen hinunter, die in der Dämmerung aufgetankt wurden. Männer in weißen Overalls arbeiteten auf den Tragflächen. Es wollte nicht hell werden an diesem Morgen. Ich setzte mich an Sibylles linke Seite. Ich saß immer an dieser Seite, denn Sibylle hörte schlecht auf dem rechten Ohr. Ein alter Mann hatte sie auf der Straße geschlagen, als sie zwölf Jahre alt war. Das rechte Trommelfell war verletzt.
»Kaffee, die Herrschaften?«
»Einen Mokka«, sagte ich.
»Bitte, Herr Holland.« Der Kellner lächelte höflich. Er sympathisierte mit mir. Ich gab stets zu große Trinkgelder, in allen Ländern.
»Mir eine Tasse«, sagte Sibylle.
»Jawohl, Madame.« Der Kellner verschwand. Im Hintergrund legte ein anderer neue Tücher auf die Tische. Und unter uns füllte ein Auto die Tanks der Superconstellation der Panair do Brasil, mit der ich fliegen sollte.
»Du mußt fort aus Berlin«, sagte ich. Ich hatte jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich wollte von Tatsachen reden. Die Katze hatte mir den Rest gegeben.
»Wo soll ich denn hin, mein Herz!« Ihre Hand lag auf der meinen. Immer lag ihre Hand auf der meinen, wo wir auch saßen.
»Du kommst zu mir in den Westen.«
»Nach Frankfurt?«
»Ja. Ich habe genug Geld. Wir nehmen eine Wohnung.« Ich wurde erregter. »Jeden Tag kann hier etwas geschehen. Was machen wir, wenn eine neue Blockade kommt? Wenn es keine Flugzeuge mehr gibt? Wenn sie mich nicht mehr zu dir lassen?«
»Liebling«, sagte sie leise, »darüber haben wir schon so oft gesprochen. Ich kann nicht einfach meinen Beruf und meine Freunde und meine ganze kleine Welt hier aufgeben, um nach Frankfurt zu kommen und dort als deine Freundin zu leben!«