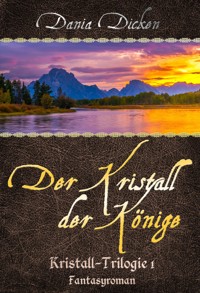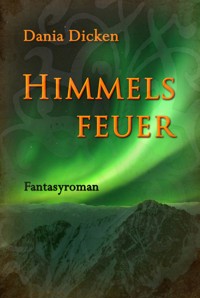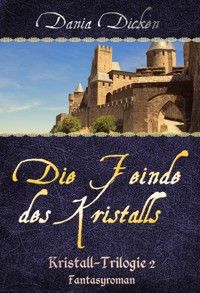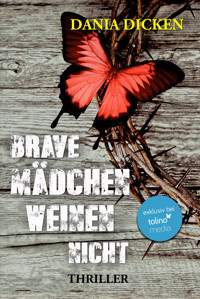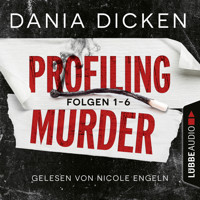1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des Fantasyromans "Himmelsfeuer" // Fernab der Schwesternschaft der Klinge lebt die Kriegerin Caelidh zusammen mit dem königlichen Wächter Gileond in dessen Heimat. Beide stehen sehr unter Druck, da eine Heirat längst überfällig wäre, die Gesetze ihrer Länder eine Hochzeit jedoch nicht zulassen. Als der König zu einer Reise ins Nachbarland aufbricht, wächst die Hoffnung der beiden, daß doch noch eine Einigung erzielt werden kann. Allerdings ahnen sie nicht, welche Schwierigkeiten und Gefahren in Caelidhs alter Heimat auf sie lauern ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
1. Kapitel
Der Eintopf war bereits fertig, als ich zur Tür hineinkam. Zufrieden seufzend ließ ich mich auf die Bank fallen, da Fianna sogar schon gedeckt hatte und für mich nichts zu tun übrig blieb. Cardiana lag in einer Decke auf der Bank und schlief selig. Verträumt schaute ich auf meine kleine Nichte, die inzwischen nicht mehr runzelig aussah, sondern wie ein gesunder kleiner Wonneproppen. Sie war nun gut eine Woche alt und hatte ein niedliches kleines Gesicht, eine rosige Gesichtsfarbe und die dunklen Haare ihres Vaters, aber Fiannas blaue Augen.
Fianna stellte den Topf auf den Tisch und reichte mir einen Löffel. Wir begannen schweigend zu essen, bis sie sich erkundigte, wie der Unterricht verlaufen war.
„Der Prinz nimmt das alles schon gar nicht mehr ernst“, sagte ich. „Ich bin auch nicht sicher, ob er sonderlich viel gelernt hat, wohingegen die Prinzessin und der König sich wirklich gut machen. Und das, obwohl die Prinzessin den Winter über gar nicht hier war.“
„Du bist sicher eine gute Lehrerin, das habe ich dir die ganze Zeit gesagt!“
Und das mit zwanzig Jahren! Dabei hatte ich diesen Geburtstag erst vor wenigen Tagen gefeiert. Vor kurzem hatte auch Gileond Geburtstag gefeiert; er war ziemlich genau ein Jahr älter als ich. Turumath war mit seiner Familie gekommen, um ihn zu beglückwünschen, und sie hatten auch an mich gedacht. Mit Gileonds Eltern verhielt es sich etwas anders, denn sein Vater konnte sich noch nicht richtig mit mir anfreunden. Das lag allerdings inzwischen weniger daran, daß ich Khasarerin war, als vielmehr an der einfachen Tatsache, daß Gileond und ich noch immer nicht verheiratet waren. Gileond war es gleich. Es gab überhaupt nur eine Person, die uns deshalb ständig Ärger machte, und das war die Besitzerin des Hauses, in dem wir lebten. Ihr war es völlig egal, daß der khasarische König Schuld an der Misere war und Gileond konnte sie auch nur besänftigen, indem er von selbst den Mietpreis für unsere Zimmer erhöhte. Nur deshalb hatte sie uns noch nicht hinausgeworfen.
Wieviel besser hatte meine kleine Schwester es da! So kurz nach der Geburt kehrte sie noch nicht an die Arbeit zurück, aber allzu viel Zeit wollte sie sich damit nicht lassen. Deshalb hatte ich schon den Vorschlag gemacht, Cardiana zu hüten, wenn ich vom Unterricht im Palast kam. Ich würde bald ausreichend Zeit dazu haben, da ich einige Bücher aus der königlichen Bibliothek übersetzen sollte. Warum sollte ich nicht auf die Kleine aufpassen? Sie wurde nur alle vier Stunden gestillt, das war perfekt.
Doch bis dahin vertrieb ich mit tagsüber die Zeit mit Fianna, wenn Gileond Dienst hatte, und sie kam mittags zu uns, wenn er erst abends zum Dienst mußte. Es ging ihr und Cardiana sehr gut und ich wußte, wie glücklich Iaroth und sie mit der Kleinen waren. Sie war die Vollendung ihres Glücks. Der Schrecken der Geburt war längst vergessen, und wenn ich die Kleine auf dem Arm hielt, platzte ich vor Neid. Sie war unglaublich niedlich und ein liebes Kind und es war so schön, dieses warme zappelige Bündel zu halten, das immerzu nach Milch roch. Fianna kannte keine andere Sorge mehr als ihre Tochter, und ich hätte alles dafür gegeben, auch so ein Kind zu haben. Das hätte ich vorher nie vermutet, aber die Tochter meiner Schwester hatte irgendwo einen Nerv bei mir getroffen. Ich hatte mir nie vorgestellt, wie es wohl war, ein Kind zu haben, auch früher nicht. Aber jetzt, wo ich Gileond hatte, stand die Frage im Raum.
Bislang war es mir gelungen, nicht schwanger zu werden, weil ich wußte, wie ich es vermeiden konnte. Es war besser, zuerst zu heiraten. Allerdings störte es mich auch, denn ich konnte ihm nicht so nicht immer nah sein, wenn ich wollte, und die Angst war unser ständiger Begleiter. Jeden Monat wartete ich auf meine Blutung. Jedes Mal war es eine Erleichterung, wenn sie kam, und das nervte mich fürchterlich.
Fianna und ich plauderten während des Essens und wir waren gerade fertig, als Cardiana sich ebenfalls zu Wort meldete. Sie begann, ein erbärmliches Gewimmer anzustimmen, fuchtelte mit den kleinen Fäustchen in der Luft herum und plärrte.
„Komm her“, sagte Fianna und hob ihre Tochter auf den Arm, um sie zu stillen. Sie war längst nicht mehr so feingliedrig wie vor Cardianas Geburt; ihr Hüftumfang hatte zugenommen, so wie im Allgemeinen ihre Figur rundlicher geworden war. Sie hatte auch genug Milch für die Kleine und stillte sie mit einer bewundernswerten Ausdauer. Während sie die Kleine sanft wiegte, summte sie ein Lied und hing mit den Augen nur an ihr. Ich war nicht neidisch, sondern gönnte den beiden diese ganz besondere Liebe. Fianna war großartig als Mutter. Hätte sie ein Kind gehabt, ehe ihre Entführung durch die Soldaten passiert war - sie hätte nichts damit anzufangen gewußt. Aber jetzt war sie wirklich erwachsen und war liebevoll und fürsorglich zu ihrer Tochter.
Was geschehen war, war längst vergessen, für jeden von uns. Wir alle hatten Narben zurückbehalten und Iaroth lief bis heute mit einer Binde über seinem fehlenden Auge herum, aber das störte ihn auch weiterhin nicht. Ich war sogar soweit zu sagen, daß ich dankbar für alles war. Wie sonst hätte ich Gileond kennenlernen sollen?
Auch wenn die Schwesternschaft mir fehlte, war ich so glücklich mit ihm, wie man nur sein konnte. Er behandelte mich wie seine Ehefrau - im besten Sinne. Er tat gern so, als wären wir verheiratet, wenn es darum ging, irgendetwas einzufordern. Er bestand darauf, daß man mir mit dem gebotenen Respekt begegnete und betonte unglaublich gern, daß wir nicht die Schuld daran trugen, nicht heiraten zu können.
Das stimmte zwar nicht ganz, aber mir war es recht so. Für Fianna und Iaroth gehörte er jedenfalls zur Familie. Von moralischen Vorhaltungen hielten sie glücklicherweise nichts. Iaroth hatte auch einmal gesagt, daß er nicht glaubte, ihm würde das zustehen, denn er war drei Jahre jünger als Gileond.
Wir waren glücklich, und das war das Wichtigste. Fianna gegenüber sagte ich das immer wieder. Wir hatten viel Zeit, über die Männer zu reden, denn wir saßen jeden Nachmittag mit der Kleinen zusammen und ich amüsierte mich prächtig, wenn Fianna sich damit abmühte, ihrer Tochter ein Kleidchen zu nähen. Töpfern konnte sie inzwischen sehr gut, aber von Handarbeiten hielt sie noch immer nichts.
Wir redeten über dies und das, schwelgten in Erinnerungen und sprachen über die Ereignisse des letzten Sommers, als wäre alles nur ein böser Traum gewesen. Fianna hatte mir irgendwann haarklein alles erzählt, was sie erlebt hatte, aber sie hatte es seltsam ungerührt getan, so als ob es sie gar nichts anginge. Mir hatte es nichts ausgemacht, aber sie hatte daran gedacht, weil sie sich erinnert hatte, wie wir bei der Schwesternschaft ihre erste Schwangerschaft abgebrochen hatten. Sie war noch immer froh, so entschieden zu haben. Selbst jetzt, wo sie bereits ein Kind hatte, sagte sie, sie hätte ein Kind, das durch Gewalt entstanden war, nicht lieben können. Besonders für Iaroth wäre es furchtbar gewesen, eine Frau zu haben, die ein fremdes Kind bekam.
Die beiden waren glücklich, genau wie Gileond und ich. Als er am Abend endlich eintraf, konnte ich es kaum erwarten, wieder mit ihm allein zu Hause zu sein. Erst aßen wir alle gemeinsam zu Abend, so wie wir es oft taten. Iaroth war schon länger zurück und umschwärmte ständig seine schlafende kleine Tochter. Es war rührend, zu sehen, wie vernarrt die beiden in Cardiana waren.
Hand in Hand gingen Gileond und ich nach dem Essen nach Hause und ich verkniff es mir, ihm zu sagen, wie gern ich auch ein Kind gehabt hätte. Ich hatte Fianna schon um ihre Schwangerschaft beneidet, denn sie war so glücklich gewesen, daß sie regelrecht gestrahlt hatte. Es war spannend gewesen, alles mitzuverfolgen, und es ärgerte mich ein wenig, daß meine jüngere Schwester mir da etwas voraus hatte.
Als wir zu Hause angekommen waren, schloß ich die Tür und wäre fast mit Gileond zusammengeprallt, der neben mir stehengeblieben war. Ich kannte den Blick, den er auf mir ruhen ließ. Er war neugierig, aber auch fordernd und zugleich beinahe ein wenig spöttisch.
„Was?“ fragte ich und legte die Arme um ihn. Sein Wappenrock fühlte sich ganz weich unter meinen Händen an, und ich fand es unwiderstehlich, ihn in Uniform und mit Schwert am Gürtel vor mir zu haben. Das wußte er genau. Er spielte damit und lief öfter als nötig so herum. Eigenartigerweise mochte er es aber auch gerade, daß ich nach wie vor Hemden und Hosen trug. Ich besaß zwar inzwischen zwei Kleider, weil man nie wissen konnte, wofür sie gut waren, aber darin sah er mich gar nicht so gern. Ich hatte es aufgegeben, in Zweifel zu ziehen, daß er mich so liebte, wie ich war.
Er küßte mich auf die Stirn und legte seine Hände auf meinen Po. Ich schloß die Augen, als ich meinen Kopf an seine Schulter lehnte und eng umschlungen mit ihm stehenblieb. Die Abendsonne schien durch die Fenster hinein und tauchte alles in ein goldenes Licht.
„Du hast mir gefehlt“, sagte er und drückte mich ganz fest.
„Du mir auch. Wenn der Unterricht bald endet, sehen wir uns gar nicht mehr im Palast.“
„Erinnere mich nicht daran.“
Noch immer legte er seinen Dienst so, daß er in der Nähe war, wenn ich bei der Königsfamilie Unterricht hatte. Ich freute mich darüber, denn auch wenn er weiterhin seine Arbeit verrichtete und nie etwas sagte, war er wenigstens anwesend.
„Hast du noch zu arbeiten?“ fragte er.
„Nein, das hat Zeit. Warum fragst du?“
„Ich mußte heute immerzu an dich denken. Es ist furchtbar, wenn ich dich morgens gesehen habe und dann nachmittags beim Dienst daran denken muß, wie lang es noch dauert, bis ich dich wiedersehe...“
„Armer Gileond“, neckte ich ihn.
„Und weißt du auch, woran ich immer denke?“
„Du wirst es mir jetzt bestimmt sagen.“
„Daran, was ich mit dir machen könnte, wenn ich zurück bin...“
„Ach so?“ Ich schaute zu ihm auf und wunderte mich nicht, als seine Hände auf Wanderschaft gingen und er mich zärtlich küßte. „Hab ein Einsehen mit mir“, bat er mich leise.
„Ein Einsehen?“ Wortlos löste ich mich von ihm, griff nach seiner Hand und zog ihn ins Schlafzimmer. Das konnte er haben. Ich löste seinen Gürtel und legte ihn mitsamt des Schwerts vorsichtig auf den Boden. Meins hing unbenutzt über dem Bett. Zu schade eigentlich. Ich zog meine Stiefel aus und warf mich aufs Bett, ehe er es mir gleichtat. Einander zugewandt lagen wir da und genossen die knisternde Spannung, die in der Luft lag.
Er ließ sich Zeit, so wie meistens. Ich wußte nicht, woher er diese Geduld nahm; manchmal überstieg sie sogar meine. Ich lag so dicht bei ihm, daß ich seine Wärme und seinen Atem spüren konnte. Eins stand fest: Ohne diese Nähe konnte und wollte ich nicht mehr leben. Und wenn es gar nicht anders ging, würde ich die Schwesternschaft verlassen, um ihn zu heiraten. Ich wollte Kinder, da blieb mir gar nichts anderes übrig. Und so sehr, wie er mich offensichtlich liebte...
Er hatte es am liebsten, wenn er mit mir machen konnte, was er wollte. Umgekehrt war es ihm gar nicht wichtig, aber er liebte es, mich zu berühren. Ich schloß die Augen und ließ ihn gewähren, als er mich erst durch die Kleidung streichelte und dann ganz allmählich mein Hemd aus der Hose zog, um seine Hand darunter verschwinden zu lassen. „Mein süßes Mädchen“, sagte er leise und grinste. „Ich bin verrückt nach dir.“
2. Kapitel
Wir wurden von der Sonne geweckt, die ins Schlafzimmer schien. Gileond war wie immer nicht zu müde, um mich begierig zu küssen und übermütig durchs Bett zu rollen. Schließlich lag er halb auf mir und küßte mich wieder, scheinbar ohne es jemals enden lassen zu wollen. Das war aber auch nicht schlimm, denn wir hatten noch etwas Zeit, und die nahmen wir uns auch.
Ich war verliebt. Ich war ganz schrecklich verliebt, wie am ersten Tag, vielleicht nur noch schlimmer. Es war mir auch unbegreiflich, wie man sich mit weniger zufriedengeben konnte. Ich hätte das nicht gekonnt. Aber es war nicht nur das Gefühl der Verliebtheit, es war viel mehr als das. Natürlich waren wir verrückt nacheinander und konnten kaum die Finger voneinander lassen, aber es hatte mich auch verändert. Ich war inzwischen nicht mehr so sicher, ob ich wegen der Schwesternschaft auf eine Heirat verzichten wollte, und seit ich Tante war, dachte ich auch ganz anders über Kinder. Ich liebte Gileond über alles, soviel stand fest. Er hatte so viel für mich getan und ich für ihn, wir waren unzertrennlich und neben der Tatsache, daß wir ein Liebespaar waren, auch gute Freunde. Er nahm mich einfach so, wie ich war, was ganz bestimmt nicht einfach war.
Schließlich standen wir auf, Gileond zog seine Uniform an und bürstete sein Haar, nahm das Schwert und band den Gürtel um. Ich war schneller fertig, band mir einen Zopf und holte Brot aus dem Korb in der kleinen Vorratskammer. Im Handumdrehen war für das Frühstück gedeckt und wir aßen gemeinsam. Kurz darauf brach Gileond zum Palast auf und verabschiedete sich mit einem Kuß von mir. Ich hätte nie gedacht, daß es einen so untadeligen, gewissenhaften Wächter wie ihn so erwischen könnte. Und schon bald sah ich ihn wieder...
Bis dahin ging ich auf den Markt, kaufte frisches Brot und einige andere Dinge, dann machte ich mich ebenfalls auf dem Weg zum Palast. Ich begrüßte die Königsfamilie und die anderen Anwesenden auf Khasar und sprach auch die meiste Zeit mit ihnen in meiner Muttersprache, um ihnen die Aussprache näher zu bringen und ihre eigenen Fähigkeiten zu vertiefen. Sie verstanden mich und konnten mir auch mehr oder weniger flüssig antworten, was mich sehr freute. Seit einigen Monaten unterrichtete ich sie und hätte nie gedacht, so schnell diesen Erfolg zu erzielen.
Gileond wachte mit einem Kameraden über unseren Unterricht. Es freute mich, daß er fast immer in der Nähe war, und wir verbrachten auch seine Mittagspause zusammen im sonnenüberfluteten Hof des Palastes. Erst danach machte ich mich auf den Weg zu Fianna und ihrer Tochter, die bislang allein zu Hause gewesen waren. Es wurde wirklich Zeit, daß Fianna sich nicht mehr langweilen mußte, denn ein kleiner Säugling sorgte nicht gerade für Unterhaltung. Zudem war im Gespräch, daß ich vielleicht bald an der Tempelschule lehren sollte, aber diesbezüglich stand noch nichts fest. Zuerst sollte ich mich um die Bücher aus der Bibliothek kümmern.
Wir machten nachmittags einen Spaziergang. Fianna hatte sich die Kleine mit einem großen Tuch vor den Bauch gebunden und hütete sie wie einen Schatz. Als es an der Zeit für Iaroth war, nach Hause zu kommen, holten wir ihn an der Schlachterei ab und er stahl Fianna die Kleine, die er stolz in den Armen wiegte und liebevoll an sich drückte. Während Fianna das Essen bereitete und Iaroth sein Töchterchen selig in den Armen hielt, kam auch Gileond und erkundigte sich, was wir so getrieben hatten. Bei ihm hatte sich - wie meistens - nicht viel ereignet. Das Wächterdasein war sehr oft sehr langweilig, zumindest fand ich das, aber er war zufrieden damit.
Wir blieben auch nach dem Essen noch eine Weile, ehe wir nach Hause zurückkehrten und uns ins Bett legten, Arm in Arm, einfach nur um dazuliegen und zu träumen. Gileond war von der Langeweile im Dienst müde und gab sich damit zufrieden, bei mir zu sein.
„Es ist schön, dir beim Unterricht zuzusehen“, sagte er. „Dann ist es wenigstens nicht langweilig.“
„Das glaube ich gern... Wie ist es denn jetzt um dein Khasar bestellt?“
„Es geht“, antwortete er in meiner Muttersprache. „Ich werde es nie so beherrschen wie du Untosisch.“
„Mußt du ja auch nicht“, sagte ich ebenfalls auf Khasar. „Ich habe mich daran gewöhnt, deine Sprache zu sprechen. Schließlich lebe ich in Untosia. Ich spreche ja nur mit Fianna und Iaroth Khasar.“ Das war aber eine Gewohnheit, die wir auch dann beibehielten, wenn Gileond dabei war. Er hatte sich das selbst gewünscht. Wenn wir zusammen waren, sprachen wir immer nur Khasar und nur außerhalb Untosisch. Doch wenn ich mit Gileond zusammen war, benutzten wir meistens seine Muttersprache. Es klang einfach so schön, auf Untosisch „ich liebe dich“ zu sagen...
„Und du hast wirklich kein Heimweh?“ fragte er.
„Nein. Wonach soll ich Heimweh haben? Nach unserem Dorf? Nein, das fehlt mir schon lang nicht mehr. Und wie das Leben in Harlaen bei der Schwesternschaft ist, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das Leben im Wald fehlt mir ein wenig, das war schön... aber in der Schule? Nein. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen, nicht nach den Abenteuern, die wir erlebt haben. Und auch sonst fehlt Khasarud mir herzlich wenig. Gwinnath und die anderen Mädchen vermisse ich, aber nicht dieses Land, in dem eine Frau nur dann etwas zählt, wenn sie sittsam ist und am besten viele Söhne bekommt. Nein, danke.“
„Ich kann es mir kaum vorstellen. Alles, was ich kenne, sind die Jünger und die Schwesternschaft. Das andere habe ich nicht kennengelernt, nur deine Eltern und die von Iaroth.“
„Das macht nichts. Du hast nichts verpaßt. Was erwartest du von einem Land, in dem ein Mann seine Frau verstoßen kann, wenn ihr Gewalt angetan wurde? Wo ist das gerecht?“
„Ich kann mir das wirklich nur schwer vorstellen“, sagte Gileond. „Iaroth ist doch ganz anders, ihr alle seid es.“
„Ja, sicher. Aber weißt du, würde ich jetzt hier ein Kind bekommen, wäre das nicht schön. Die Leute würden reden. In Khasarud wäre das eine mittlere Katastrophe. Die Regeln sind so furchtbar strikt.“
„Das stimmt. Ein Glück, daß das vorbei ist.“
„Ja“, sagte ich und schmiegte mich seufzend in seine Umarmung. Das war wirklich ein Glück.
Gileond hatte den Wechsel zur Nachtschicht vor sich und deshalb bis zum Abend frei. Ich freute mich immer wieder, wenn er Schichtwechsel hatte, denn so hatte er länger frei als sonst und wir konnten die Zeit gewinnbringend nutzen. Ich hatte mit Fianna gesprochen und sie wußte, daß ich mit Gileond einen Ausritt machte. Sangaiblan befand sich immer noch in meinem Besitz, er war im Stall eines Nachbarn untergekommen, der sich gut um ihn kümmerte. Ich hatte schon darüber nachgedacht, ihn vielleicht zu verkaufen, weil wir eigentlich nie ein Pferd brauchten, aber ich konnte mich nicht von ihm trennen und so war es uns heute möglich, einen Ausritt zu unternehmen. Wir nahmen einige Vorräte mit, holten Sangaiblan und ritten zu zweit auf ihm aus der Stadt. Ihm machte es nichts aus, wir ließen ihn gemütlich traben und nahmen uns alle Zeit der Welt. Unser Weg führte uns an der Küste entlang, an der die Brandung wogte und die Sommersonne wärmend aufs Wasser schien und die Schaumkronen glitzern ließ.
Mir gefiel das mildere Klima in Untosia sehr. Der Winter war nicht so bitterkalt gewesen wie in Khasarud und der Sommer war wundervoll. Gileond kannte sich in der Gegend gut aus, wir ritten zu einer kleinen Bucht nördlich der Stadt, die sehr einsam gelegen war und einen wunderbaren Blick aufs Meer bot. Von dort aus konnte man auf die Schiffe schauen, die aus den Hafen Samacias ausliefen, und am nördlichen Horizont konnte man die weißen Klippen schauen, die steil ins Meer abfielen.
Die grünen Wiesen reichten bis fast ans Wasser heran, nur abgelöst von einem schmalen Sandstreifen. Dort setzten wir uns hin und ließen Sangaiblan in der Nähe herumstreifen. Er würde schon nicht verschwinden, dafür war er mir zu treu.
Wir legten uns ins Gras und schauten den Wolken hinterher. Gileond unterhielt sich mit mir über die Möglichkeit, an der Tempelschule zu lehren, wo ich die Söhne und vielleicht sogar einige Töchter reicher Familien in Khasar unterrichten sollte. Ich fand diese Aussicht spannend, aber etwas anderes hätte ich noch viel lieber getan.
„Ich fände es schön, wenn es hier auch so etwas wie die Schwesternschaft gäbe. Eine Gemeinschaft, die jungen Mädchen einzigartige Chancen bietet, die sie Sprache, Rechtskunde und die Kampfkunst lehrt. Ich habe es geliebt.“
„Die Schwesternschaft der Klinge ist uralt. So etwas jetzt hier aufzubauen halte ich für schwierig, bis jetzt gibt es das hier auch noch nicht“, warf Gileond ein.
„Trotzdem fehlt es mir... ich lehre hier meine Muttersprache, aber ich könnte noch so viel mehr tun!“
„Biete es doch an. Du kannst auch Mädchen lehren, die dir nichts bezahlen können, denn ich verdiene doch genug für uns beide.“
Das stimmte allerdings. Wenn wir gewollt hätten, wir hätten in ein Haus ziehen können, aber das wollten wir nicht. Wir brauchten es gar nicht.
„Wenn wir jetzt heiraten könnten, würdest du es wirklich wollen?“ fragte Gileond mich ganz überraschend.
„Warum fragst du?“ wollte ich wissen.
„Du würdest Untosa werden und du würdest mir unterstehen. Wäre das kein Problem für dich?“
Verwundert setzte ich mich aufrecht und sah ihn nachdenklich an. „Du kennst mich gut.“
„Mir ist nur aufgefallen, daß du zurückhaltender bist, was diese Sache angeht. Es stört dich gar nicht, daß noch nichts entschieden ist. Ich glaube manchmal, du bist froh, daß es noch so ist.“
Ich zuckte unentschlossen mit den Schultern. „Ich weiß gerade selbst nicht, was ich denken soll. Ich habe es satt, dich nicht heiraten zu können, ohne auf die Schwesternschaft verzichten zu müssen. Es ärgert mich, daß es so lang dauert, weil ich das Gejammer der Alten nicht mehr hören kann. Aber andererseits hast du Recht, das muß ich zugeben.“
„Du mußt mich gar nicht heiraten, wenn du nicht willst.“
„Doch, natürlich... ich will das. Ich will eheliche Kinder haben, um ihrer selbst willen. Ich habe mich auch schon gefragt, was ich tun würde, wenn ich mich zwischen der Schwesternschaft und dir entscheiden müßte. Die Wahl würde auf dich fallen.“
„Nein...“ wehrte Gileond entschlossen ab. „Tu das nicht.“
„Warum sagst du das?“ fragte ich. „Warum bestehst du so sehr darauf, daß ich bei der Schwesternschaft bleibe?“
„Weil ich dich gut genug kenne. Du wärst früher oder später unglücklich, wenn du das aufgeben müßtest.“
„Aber es ist wahr, ich kann es auch leben, ohne eine Schwester zu sein.“
„Aber das willst du nicht, und du willst auch deine Freiheit behalten. Dabei weißt du doch, daß ich nie über dich bestimmen würde, oder?“
Ich nickte. „Natürlich weiß ich das, Gileond. Hier in Untosia geht es mir besser, als es mir in der gleichen Situation in Khasarud gehen würde. Hier bin ich freier.“
„Weißt du, ich verstehe das. Warum sollte ich dir denn auch etwas zu sagen haben?“
„Warum machst du dir dann Sorgen?“ fragte ich.
„Ich weiß nicht... ich wünsche mir manchmal einfach nur zu sehr, mir deiner Liebe gewiß zu sein. Ich weiß, daß du mich liebst, aber wenn du mich nicht heiratest - du könntest doch jederzeit wieder in deine Heimat gehen und...“
„Gileond!“ rief ich entsetzt und drückte seine Hand. Ich sah ihm direkt in die Augen und schüttelte den Kopf. „Du brauchst doch keine Angst zu haben, daß ich weggehe. Warum sollte ich das tun?“
Ich hatte keine Ahnung gehabt, daß ihm das Sorgen machte, aber ich konnte es verstehen. Wie konnte er sicher sein, mich zu halten, wenn ich nicht seine Frau war? Ich umarmte ihn impulsiv und drückte ihn an mich. Plötzlich wurde mir klar, daß er sich so um mich sorgte, weil dieser Gedanke ihm Angst machte. Er tat alles für mich, um mich zu halten.
Er erwiderte meine Umarmung sehr schnell. „Ich weiß nicht, wohin das führen soll, Caelidh. Ich fechte das alles gewissenhaft durch und stehe zu dir, ich will auch nicht, daß du die Schwesternschaft verläßt... aber mich auch nicht.“
Das war ein ständiges Thema bei uns. Immer wieder kam es auf, weil er es ansprach. Von mir kam das selten. Ich kannte mein Gefühl, ich wußte, daß ich Gileond liebte. Ich riskierte unseren und vor allem meinen Ruf jedes Mal, wenn ich meiner Sehnsucht nach seiner Nähe nachgab, und das tat ich viel zu oft. Es vergingen nur wenige Tage, an denen wir einander nicht nah waren, in welcher Form auch immer.
Er wußte auch, daß es trotz meiner Liebe zu ihm nicht einfach für mich war, nachzugeben, ohne verheiratet zu sein. Aber wußte er wirklich, wie es um meine Liebe bestellt war? Konnte er wirklich sicher sein? Er kannte mich so gut, daß er wußte, welche Probleme ich für mich sah und ich wußte, daß ihm alles gleich war. Er legte keinen Wert darauf, mich der Konventionen wegen zu heiraten und er hatte auch immer wieder gesagt, er fände es nicht schlimm, wenn ich schwanger würde. Sein Ruf war ihm gleich, er konnte sich das leisten. Er wollte nur mit mir zusammensein, mehr zählte für ihn nicht. Aber er wollte mich halten.
„Wenn ich muß, dann verlasse ich eben die Schwesternschaft und heirate dich“, versprach ich.
„Nein...“ murmelte Gileond und schüttelte nachdrücklich den Kopf.
„Es macht doch keinen Unterschied.“
„Das mußt du aber nicht tun.“
„Und wenn doch? Was, wenn der König uns nicht hilft?“
„Dann bleibt alles so.“
„Und du bist unglücklich.“
Darauf wußte er nichts zu erwidern.
„Kommt nicht in Frage“, sagte ich. „Ich wünsche mir auch Kinder und sie sollen ehelich geboren werden.“
„Ich würde sie anerkennen...“
„Das bringt doch nichts. Es wäre nicht dasselbe.“
„Aber ich will dich so, wie du bist.“
„Das ehrt dich“, sagte ich, „aber das geht nicht, das weißt du doch.“
Wir redeten uns darüber die Köpfe heiß, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Er wollte auch Kinder, das wußte ich. Ihn hatte es vielmehr erstaunt, daß ich welche wollte, aber interessant war das auch erst durch Cardiana geworden. Ich hatte mir vorher selbst nicht zugetraut, diese Gefühle zu entwickeln. Wichtiger war ihm jedoch meine Liebe, das wußte ich auch. Alles andere kam erst danach.
Wir genossen es, nur uns zu haben und in der Sonne zu liegen. Den ganzen Tag verbrachten wir dort und kehrten erst nach Samacia zurück, als es für Gileond an der Zeit war, zum Dienst zu gehen. Ich ging wie üblich zu Fianna und Iaroth, um nicht ganz allein zu Hause zu sein, und setzte mich später im Licht der Dämmerung und einer Kerze noch zum Übersetzen hin.
Am schwersten fiel es mir, allein ins Bett zu gehen. Ich konnte unglaublich schlecht einschlafen, wenn Gileond nicht bei mir war, obwohl das immer wieder vorkam. Mir fehlte seine Wärme, sein ruhiger Atem, einfach alles. Wie schön war es doch morgens gewesen, von ihm geweckt zu werden und gleich zu spüren, daß man begehrt wurde ...
3. Kapitel
Als ich aus dem Palast zurückkehrte, war Gileond bereits auf den Beinen. Er stellte gerade die Vorratskammer auf den Kopf und suchte das Gemüse für den Eintopf zusammen, ließ aber alles stehen, als er mich bemerkte, und küßte und umarmte mich zur Begrüßung.
„Schon wach?“ fragte ich erstaunt.
„Ich konnte nicht mehr schlafen. Es ist zu hell, draußen zu laut... ich kann tagsüber nicht schlafen. Außerdem habe ich mich nach dir gesehnt.“
„Ach so?“ fragte ich spöttisch. Gileond küßte mich wieder und ehe ich wußte, wie mir geschah, hatte er die Hände unter mein Hemd geschoben und drückte mich rücklings an die Wand. Ich war erst zu verblüfft, um zu reagieren, aber dann sagte ich: „Du gehst ja ran.“
„Ich habe auf dich gewartet, Caelidh... und wenn nicht jetzt, wann kommen wir dann dazu? Gleich kommt deine Schwester!“
„Und was, wenn ich gar nicht will?“ wollte ich ihn ärgern, aber er nahm es ernst.
„Oh, tut mir leid...“
„Nein, nein“, winkte ich ab und erwiderte seinen Kuß. Er riß mir regelrecht die Kleidung vom Leib und ehe ich wußte, wie mir geschah, saß ich auf der Bank und sah, wie er sich hastig die Hose von den Hüften zerrte und sich zwischen meine Beine drängte.
„Was ist mit dir los?“ fragte ich lachend. Er legte einen Arm um mich und drückte mich an sich, küßte mich begierig und wurde eins mit mir. Ich begriff gar nichts. Ich war völlig überrumpelt und ließ ihn gewähren, denn meine Überraschung verwandelte sich gleich in Lust. Er wußte genau, wie er es anstellen mußte, mich zu überreden. Ich schlang die Beine um ihn und drückte mich an ihn; er glühte schier und küßte mich immer wieder. Ich war sofort davon gefangen. Mit beiden Armen hielt er mich an sich gedrückt, so daß kein Haar mehr dazwischengepaßt hätte, und raunte mir ins Ohr, daß er verrückt nach mir war. Es imponierte mir, daß er mich einfach so überfiel, aber wir hatten in der Tat nicht viel Zeit. Und er wußte, ich hatte nie etwas dagegen, wenn er mich liebte...
Er legte eine Hand in meinen Schoß und streichelte mich. Obwohl es so unvermittelt gekommen war, ließ ich mich gleich darauf ein und genoß es aus vollen Zügen. Es fiel ihm nicht schwer, mich damit um den Verstand zu bringen, und es dauerte gar nicht lang, bis schon wieder alles vorüber war. Keuchend sank er gegen mich und hielt sich an mir fest. Er kniete vor mir am Boden und war völlig außer Atem.
„Was?“ fragte ich grinsend.
„Das tut so gut...“
Ich lachte. „Du hast doch nur auf mich gewartet.“
„Natürlich, was glaubst du denn? Ich habe von dir geträumt und bin vorhin aufgewacht und habe gewartet, ja.“
„Und mich überfallen.“
„Was du natürlich überhaupt nicht wolltest.“
Wir hörten die Haustür quietschen und quälten uns ruckartig von der Bank hoch. Ich zerrte meine Hose hoch und stopfte hastig mein Hemd hinein. Wir waren beide angezogen, ehe es oben bei uns an der Tür klopfte. Zwar waren meine Haare etwas zerzaust, aber ich ging trotzdem, um meiner Schwester zu öffnen. Sie hatte die Kleine dabei, die sie sicher mit einer Decke auf die Bank legte, nachdem sie uns begrüßt hatte. Wir kümmerten uns gemeinsam um das Essen, während Gileond ganz berufsgemäß ein Auge auf die Kleine hatte und den Tisch deckte. Immer wieder warf er mir verstohlene Blicke zu und grinste, was ich nur erwidern konnte. Er war einfach unmöglich.
Wenig später aßen wir gemeinsam und als hätte Cardiana es geahnt, begann sie kurz nach dem Essen erbärmlich zu wimmern und verlangte nach ihrem Recht. Fianna nahm sie mit in unser Schlafzimmer, um sie dort zu stillen, während Gileond und ich uns um den Abwasch kümmerten. Iaroth war der einzige Mann, in dessen Anwesenheit sie sich um die Kleine kümmerte, und das war auch wenig verwunderlich.
Iaroth kam an diesem Tag recht früh aus der Schlachterei und hatte frisches Brot und andere Leckereien für das Abendbrot mitgebracht. Wie immer aßen wir zusammen und Gileond machte sich danach auf den Weg zum Palast. An diesem Abend spielte ich Karten mit Fianna und Iaroth und übersetzte wieder, als sie fort waren.
Ich ging wie immer früh schlafen, wenn ich allein war. Wie sollte ich mir sonst auch die Zeit vertreiben? Aber als ich im Bett lag, dachte ich darüber nach, was Gileond bei unserem Ausritt gesagt hatte. Allmählich mußten wir uns wirklich etwas überlegen. Mir war es immer noch ein Rätsel, warum ausgerechnet er sich so dagegen sträubte, daß ich die Schwesternschaft verließ. War es mir ein Jahr zuvor noch undenkbar erschienen, hatte ich mich inzwischen mit dem Gedanken angefreundet. Ich lebte nicht mehr dort, warum mußte ich ihr angehören? Mein neues Leben stellte auch Erwartungen an mich. Besser war es, zu heiraten...
Am Morgen war ich zeitig auf und übersetzte weiter, ehe Gileond vom Dienst kam. Wie immer war er schrecklich müde und aß nur eine Kleinigkeit, ehe er sich schlafen legte. Besonders gesprächig war er auch nicht, aber morgens hatte er immer seinen Tiefpunkt erreicht. Mitten in der Nacht und morgens nach Dienstende war er meistens besonders müde. Ich ließ ihn in Ruhe, übersetzte weiter und ging zum Unterricht.
Ich begrüßte die Königsfamilie freundlich auf Khasar und sie erwiderten den Gruß. Der König erhob sich und bat mich um ein Gespräch unter vier Augen. Wir begaben uns in eine der hinteren Ecken des Raumes, wo er mit gedämpfter Stimme fragte: „Was schreibt der König?“
„Der König?“ fragte ich irritiert.
„Ich ließ Gileond gestern Abend einen Brief für Euch mitgeben. Ein Bote aus Harlaen ist am Nachmittag eingetroffen und brachte auch ein Schreiben vom König für Euch.“
Ich war völlig überrascht. „Das hat er mir gar nicht gesagt.“
„Verstehe“, sagte der König. „Vielleicht gefiel ihm der Inhalt nicht.“
„Ich denke nicht, daß er ihn gelesen hat“, sagte ich. „So gut ist sein Khasar nicht.“ Dessen war ich mir zwar nicht sicher, aber ich glaubte nicht, daß Gileond diesen Brief geöffnet hatte und mir den Inhalt verschwieg. Vermutlich hatte er nur Angst davor - oder er war schlicht und ergreifend zu müde gewesen.
„Laßt es mich wissen, wenn es Schwierigkeiten gibt“, sagte der König. „Wir werden voraussichtlich am Ende des Sommers nach Harlaen reisen.“
Ich verstand, worauf er hinaus wollte, und dankte ihm. Wir begannen kurz darauf den Unterricht, aber ich war gar nicht ganz bei der Sache und umso erleichterter, als wir früher aufhörten. Ich beeilte mich, nach Hause zu kommen, wo Gileond noch schlief. Mucksmäuschenstill schlich ich ins Schlafzimmer, wo er seine Uniform wie immer sauber über den Stuhl gehängt hatte. Ich hob den Wappenrock und entdeckte tatsächlich darunter einen versiegelten, ungeöffneten Brief, der das königliche Siegel trug und an mich adressiert war. Nein, Gileond hatte ihn mir sicher nicht böswillig verschwiegen.
Ich verließ das Zimmer und machte ein wenig Lärm in der Küche, woraufhin Gileond verschlafen und mit kleinen Augen am Tisch erschien und sich setzte. Er trug nur eine Hose, hatte sich nicht einmal die Haare gebürstet und sah fragend zu mir auf.
„Was ist los?“ wollte ich wissen. Er zog die Hände unter dem Tisch hervor und zeigte mir den Brief.
„Vom König. Aus Harlaen“, sagte er.
„Ich... ich weiß, daß du ihn hast“, sagte ich. „Der König hat mich angesprochen.“
„Oh, tut mir leid... ich wollte es dir nicht verschweigen, aber ich hatte Angst davor, heute Morgen hineinzuschauen. Ich habe überhaupt Angst davor. Ich wollte es jetzt mit dir machen.“
„Komm“, sagte ich und setzte mich neben ihn. Als er den Brief nicht öffnete, tat ich es. Ich brach das Siegel, faltete das Pergament auseinander und las langsam auf Khasar vor.
„Beschluß in der Angelegenheit betreffend der Staatsbürgerschaftsfrage von Schwestern der Klinge... Der König und sein hoher Rat haben entschieden, daß unverändert nur Khasarerinnen der Schwesternschaft der Klinge angehören dürfen. Sie müssen in Khasarud geboren sein oder von Khasarern abstammen und die Staatsangehörigkeit behalten. Es ist nicht möglich, durch Heirat oder andere Umstände eine andere Staatsbürgerschaft anzunehmen und weiterhin der Schwesternschaft anzugehören.“
Das war alles. Ich stockte zwischendurch und ließ mit eiskalten, zitternden Händen den Brief sinken, als ich mit leiser Stimme geendet hatte. Diese wenigen Zeilen zerstörten gerade alles, was wir uns wünschten.
Gileond legte einen Arm um mich und drückte mich wortlos an sich. Ich legte den Brief auf den Tisch und schloß die Augen. Bitte nicht... Nun, da ich es schwarz auf weiß hatte, bekam ich Angst. Ich mußte mich also entscheiden: Gileond oder die Schwesternschaft. Beides konnte ich nicht haben.
„Verdammt“, hörte ich ihn sagen.
„Der... der König hat mir Hilfe angeboten“, stammelte ich.
„Die haben wir bitter nötig.“
„Daß ich Untosa würde, wenn ich dich heirate, besagen die Gesetze unserer beider Länder“, sagte ich. „Das kann er nicht ändern.“
„Aber er kann mit eurem König reden.“
„Wegen uns beiden?“ Ich lachte bitter. „Nein, Gileond, vergiß es. Wir müssen uns jetzt entscheiden: Entweder ich bleibe eine Schwester der Klinge oder ich werde deine Frau. Eine andere Wahl habe ich nicht.“
„Du kannst nicht meinetwegen alles aufgeben, was dich ausmacht!“
„Warum willst du das nicht?“ fragte ich gereizt.
„Weil ich dich so liebe!