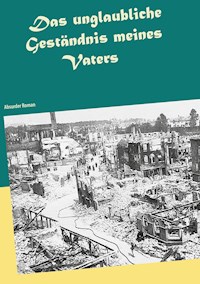Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Erzählung "Grenzüberschreitung" schildert den Alltag des freien Journalisten Stefan Bröker, der mit Frau und Sohn im holsteinischen Uetersen lebt. Sein Alltag ist geprägt von Existenznöten sowie Auseinandersetzungen mit Nachbarn, dem Arbeitgeber, Arbeitskollegen und mit der Lehrerschaft der Schule, die sein Sohn besucht. Der erste Urlaub nach mehr als zehn Jahren, den er mit seiner Familie in Polen verbringt, löst eine Krise bei ihm aus. Sie kulminiert darin, dass er während eines Danzig-Besuchs auf der Mottlau-Brücke ein halluzinatorisches Erlebnis hat, das zu seinem Zusammenbruch führt. Dieser ist aber gleichzeitig der Anfang von etwas Neuem, wobei offengelassen wird, wie das aussehen könnte. Die Erzählung basiert auf einem tatsächlichen Erlebnis des Autors. Er geht davon aus, dass sich viele Menschen aus "seiner" Region, die sie lesen, darin wiedererkennen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Erzählung „Grenzüberschreitung“ schildert den Alltag des freien Journalisten Stefan Bröker, der mit Frau und Sohn im holsteinischen Uetersen lebt. Sein Alltag ist geprägt von Existenznöten sowie Auseinandersetzungen mit Nachbarn, dem Arbeitgeber, Arbeitskollegen und mit der Lehrerschaft der Schule, die sein Sohn besucht. Der erste Urlaub nach mehr als zehn Jahren, den er mit seiner Familie in Polen verbringt, löst eine Krise in ihm aus. Sie kulminiert darin, dass er während eines Danzig-Besuchs auf der Mottlau-Brücke ein halluzinatorisches Erlebnis hat, das zu seinem Zusammenbruch führt. Dieser ist aber gleichzeitig der Anfang von etwas Neuem, wobei offengelassen wird, wie das aussehen könnte. Die Erzählung basiert auf einem tatsächlichen Erlebnis des Autors. Er geht davon aus, dass sich viele Menschen aus „seiner“ Region, die sie lesen, darin wiedererkennen werden.
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Zweiter Teil
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Erster Teil
1.
Ich saß statuarisch unbeweglich an meinem Schreibtisch und überlegte. Jemand, der mich länger beobachtete, konnte glauben, ich sei mit diesem funktionalen, stabilen Möbel verwachsen, das trotz der acht oder neun Umzüge in den vergangenen zwölf Jahren, die hinter ihm lagen und an seinem Lack gekratzt hatten, noch recht ansehnlich wirkte. Auf dem Schreibtisch, zwischen ausladendem, nicht: flachbrüstigen Monitor und der leicht verstaubten mausgrauen Tastatur, erstreckte sich ein noch überschaubares Chaos aus Schreibblöcken, Notizzetteln, Gläsern und Unterassen. Darauf klebten − wie lange schon? − hässliche, eingetrocknete, bräunlich verfärbte Teebeutel. Links und rechts des Monitors, in einigem Abstand, zwei zum Schweigen verurteilte handtellergroße Lautsprecher.
In der deckellosen, durchsichtigen Plastikbox, die auf der Unterlage mit der Darstellung einer mittelalterlichen Weltkarte Platz gefunden hatte, drängten sich CDs, die eilig formulierte, für den alsbaldigen Verbrauch bestimmte Zeitungstexte enthielten. Bereits vor längerer Zeit versandfertig gemachte Standard-Briefe, die längst auf den Post-Weg hätten gebracht werden sollen, lehnten abwartend am Monitor.
Ich − zweiundfünfzig Jahre alt, klein, schmal, jungenhaft wirkend, wie ich mich selbst sah − wendete mich von dem Text auf dem Monitor, den ich bislang fixiert hatte, ab. Die Arme hinter dem Kopf verschränkt blickte ich aus dem Fenster. Draußen tobte ein Nordweststurm, zerrte an Ästen und Zweigen entlaubter Bäume, wirbelte das vom Herbst liegen gebliebene Laub sowie Papierfetzen auf und fegte sie in alle Ecken und Winkel des Wohnblocks. Auf der Jochen-Klepper-Straße, die ich von meinem Platz aus in ihrer gesamten Länge überschauen konnte, bewegte sich außer einer scheuen Katze, die kein Unglück bringen wollte, nichts Lebendiges. Das Tier lief quer durch die gepflegte Gartenanlage des gegenüberliegenden schlichten Seniorenwohnheims und verschwand hinter einer immergrünen Bambushecke.
Ein alter, zerbrechlich wirkender Mann verließ das Wohnheim und trat auf die Straße. Als ihm eine heftige Windböe den Atem nahm, schlug er rasch den Jackenkragen hoch, um damit Mund und Nase zu schützen. Mit leicht vornübergebeugtem Oberkörper, den Kopf ein wenig zur Seite gewendet und den Blick auf die Straße geheftet, kämpfte er sich bis zu seinem ebenfalls betagten Opel vor, den er in einiger Entfernung geparkt hatte. Er wirkte sichtlich erleichtert, als er endlich im geschützten Raum seines Wagens saß.
Ich wusste sehr wohl, wem der alte Herr Gesellschaft geleistet hatte: der Nachbarin von schräg gegenüber, der fast siebzigjährigen Maria Schulz. Sie stand, erst bei genauem Hinsehen erkennbar, an ihrem Stubenfenster und schaute ihrem Freund nach, wie er mit seinem Oldtimer in die Reuterstraße einbog und aus ihrem Gesichtsfeld verschwand. Erst danach öffnete die für ihr fortgeschrittenes Alter recht resolute und unternehmungslustige Frau die Terrassentür einen Spalt weit und hielt ihre Nase in den Sturm.
Hatte sie schon jemals in einem der vielen Januar-Monate, die an ihr vorübergezogen waren, so ein Wetterchen erlebt? Gewiss nicht! Die strengen Winter ihrer Kindheit, die nach warmen Wollsocken, Mütze und Schal verlangten, waren einer vorfrühlingshaften vierten Jahreszeit gewichen. Etwa zwei Wochen zuvor hatte sich sogar ein Gewitter, das von der Elbe heraufgezogen kam, lautstark entladen: Das Klima spielte verrückt.
Heftiges Sodbrennen verwies mich auf mich selbst. Rekordverdächtige drei, vier Tage war ich ohne Omeprazoltablette ausgekommen. Jetzt hieß es für mich wieder: Schlucken!
„Es hört nicht auf!“ murmelte ich kopfschüttelnd.
Mit einer gewissen Abscheu griff ich zur Tablettenpackung, die auf dem Aufsatz meines Schreibtisches bereit lag, fingerte eine ovale Kapsel heraus und spülte sie mit einem Schluck abgestandenen, warmen Mineralwassers, übriggeblieben vom Abend zuvor, hinunter. Bis sie mir Erleichterung verschaffte, würde es allerdings noch eine Weile dauern, wusste ich aus Erfahrung.
Magenprobleme kannte ich seit meiner Jugend. Dem leichten, dumpfen Schmerz oder der Übersäuerung, die sich früher in wöchentlichen oder monatlichen Zeitabständen einstellten, hatte ich jedoch nie besondere Beachtung geschenkt: So schnell wie die Beschwerden kamen, waren sie zumeist auch wieder verschwunden. Doch an einem warmen Herbsttag des vergangenen Jahres begann mein empfindliches Organ plötzlich zu rebellieren. Dies kündigte sich durch eine Art Hungergefühl und lautes Magenknurren an und eskalierte verhältnismäßig schnell in einer heftigen Säureattacke, die bis zur Speiseröhre und in die rechte Brusthälfte ausstrahlte. Da in den folgenden Stunden und Tagen trotz Verzicht auf den eigentlich unentbehrlichen Kaffee und scharf gewürzte Speisen keine Besserung eintrat, besorgte ich mir in der nahe gelegenen Apotheke gängige Magentabletten. Doch obwohl sie kaum wirkten, wie ich feststellte, wartete ich selbstquälerisch noch eine Woche, bevor ich endlich widerstrebend meinen Hausarzt Dr. Germann aufsuchte: Dieser sollte mir ein stärkeres Präparat verschreiben.
Dafür ließ ich auch die unvermeidliche Untersuchungsprozedur über mich ergehen, die im Wesentlichen aus dem Abklopfen meines Unterleibs, insbesondere der Magengegend, bestand. Da sich nirgendwo Schmerzen meldeten, gelangte Germann zu der Meinung, dass es sich höchstwahrscheinlich um keine Magen-, sondern um eine Speiseröhrengeschichte handle. Klarheit bringe allerdings erst eine Magenspiegelung: Er wolle mir eine Überweisung zu einem Facharzt ausstellen.
„Das werden nicht die schönsten Minuten ihres Lebens sein. Aber dann wissen wir wenigstens Bescheid und können eine Strategie entwickeln, wie wir das Problem anpacken.“
Ich nickte zustimmend, dachte aber nicht daran, die unangenehme Prozedur über mich ergehen zu lassen. Wozu? Ich war sicher, organisch gesund zu sein und sah die Ursache meines Sodbrennens im Dauerstress: Das lag für mich klar auf der Hand. Mir ging lediglich darum, das Übel loszuwerden, das mich quälte − und das gelang mir auch tatsächlich mit Hilfe von Omeprazoltabletten, die mir der Allgemeinmediziner verschrieben hatte. Die Einnahme einer Kapsel, so fand ich heraus, verschaffte mir für wenigstens vierundzwanzig Stunden Ruhe. Das ermöglichte mir, wieder ein nahezu normales, beschwerdefreies Leben zu führen. Alles Weitere würden die Selbstheilungskräfte in mir bewirken, war ich mir sicher.
*
Eine helle, freundliche Jungenstimme, die hinter mir erklang, schreckte mich aus meinen Gedanken auf.
„Hallo Papa, ich gehe mal kurz zum Ein-Euro-Laden.“
Ich drehte mich mit seinem Sessel in Richtung Tür und blickte in das fein lächelnde Gesicht meines Sohnes Dennis. Mein Kleiner, neun Jahre alt, aufgeweckt und auffallend hübsch, lehnte am Türpfosten und fuhr sich mit den Fingern durch das blonde, vor dem Weihnachtsfest auf Streichholzlänge gebrachte Haar.
„Die haben jetzt Leuchtpistolen. Will ich mir mal ansehen.“
„Leuchtpistolen für einen Euro? Klingt ein bisschen unwahrscheinlich, nicht? Außerdem ist so etwas nichts für Dich! Und bei diesem Sturm…“
„Will ja nur mal gucken. Und tschüs!“
Dennis, der nicht allzu viel auf meine Einwände gab, winkte kurz mit der Hand und tobte dann die Treppe hinunter. Im Flur warf er sich die Jacke über, und schon fiel die Tür ins Schloss.
Einige Wochen vor dem Jahreswechsel hatte mein Sohn den Ein-Euro-Laden in der nahen Reuterstraße für sich entdeckt. Anfangs überwältigt von der Fülle der Billig-Artikel wie Kerzen, Batterien, Schmuck, Gläser, Geschenkpapier, Universalkleber und Spielzeug zog ihn alsbald das auf einem länglichen Tisch ausgebreitete, umfangreiche Sortiment an jugendfreien Feuerwerkskörpern und Tischfeuerwerken an. Er suchte sich einige ihm interessant erscheinende Feuerwerkskörper aus, bezahlte und lief dann eilig nach Hause. In einiger Entfernung vom eng geschnittenem Carport, das einem metallicblauen Reno Clio Schutz vor der Witterung bot, entfesselte er dann ein Feuerwerk aus verschiedenfarbigen Blitzen, Fontänen, Leuchtkugeln, Lichtern und Bodenfeuerwirbeln. Noch faszinierender für meinen Jungen waren allerdings die unterschiedlich starken, an sich ungefährlichen Knallkörper, die er auf dem Boden, in gehörigem Abstand vom Gesicht, anzündete. Ihre mehr oder minder lauten Detonationen lösten bei ihm helle Begeisterung aus.
Von diesem Tag an konnte Dennis es nicht mehr lassen. Fast täglich, so lange wie sein Taschengeld es hergab, besorgte er sich im Ein-Euro-Laden Nachschub, um es in der ruhigen, stark überalterten Wohngegend, in der er lebte, krachen zu lassen. Der Virus sprang auch auf seinen um ein Jahr älteren Freund, Klassenkameraden und Nachbarn Daniel Lehmann über, der kräftig mitmischte: Die Anwohner der Jochen-Klepper-Straße waren nicht gerade amüsiert. Nach Silvester formulierte ich dann ein freundliches, aber entschiedenes „Stopp!“.
„So, jetzt ist Schluss damit. Gib Dein Geld besser für andere Dinge aus!“
Teedurst trieb mich in die kleine Küche im Erdgeschoss. Sie war mit serienmäßig produzierten Standardmöbeln ohne Chic ausgestattet − und auch nicht besonders gemütlich. Miriam und mir war es noch niemals eingefallen, hier eine Tasse Kaffee zu trinken oder eine Mahlzeit einzunehmen: Das geschah ausschließlich in der Wohnstube. Nur Dennis und sein Freund Daniel nahmen hin und wieder einmal an dem schmalen Tisch in der Fensterecke Platz, um unkultiviert eine Salami- oder Gemüse-Pizza zu verdrücken oder Mineralwasser-Wettrinken zu veranstalten: Das war nur dort möglich.
Ich ließ Wasser fließen, schaltete den Schnellkocher ein, beförderte einen Teebeutel in die zerbrechliche, blaue Teetasse und goss brodelndes Wasser darüber. Dieses Ritual zelebrierte ich mehrmals täglich. Ich brauchte es, um ein wenig Abstand von meiner Text-Arbeit zu gewinnen und mich zu stimulieren.
Bevor ich wieder nach oben ging, warf ich einen Blick in die geräumige und gemütliche Wohnstube: Die Tüte Chips auf der schon ein wenig zerschlissenen Eckgarnitur sowie der laufende Fernseher sprachen dafür, dass mein Kleiner gleich zurückkommen würde. Die langen Gardinen waren zur Seite gezogen und gaben den Blick frei auf Terrasse, Garten sowie − in einigem Abstand − die Reihenhäuser dahinter.
Ich trat an die Terrassentür und vergewisserte mich, dass die Stellwände zu den Nachbarn links und rechts noch dem Sturm standhielten. Wenn dies auch der Fall war, wie ich feststellte, so nahm ich mich doch für das Frühjahr vor, zumindest die ältere Stellwand, die schon recht unansehnlich war, durch eine neue zu ersetzen. Und auch sonst wollte ich noch einiges im Garten sowie im Kellereingang, wo der Putz allmählich abbröckelte, tun. Einen eifrigen Helfer hätte ich bestimmt in Dennis: Das war etwas für ihn.
*
Mit der heißen Tasse Tee in der Hand ging ich wieder in mein Arbeitszimmer, um weiter an meinem Text über die jüngste Vernissage in der Museumsscheune, Veranstaltungs- und Kulturzentrum der Stadt Uetersen, zu feilen. Eine renommierte Hamburger Malerin in den Vierzigern, nicht ganz unattraktiv, aber ohne Ausstrahlung, wie ich fand, gab sich dort die Ehre. Ihr Gesamtkunstwerk spiegelte die Variation ausschließlich eines Themas wider: den aus verschiedenen Farbsträngen bestehenden Spiralnebel. Nicht nur unter den konservativen Ausstellungsbesuchern aus Uetersen und dem ländlichen Umland löste ihr wenig facettenreiches Werk heftige Diskussionen aus: Das Spektrum der Meinungen, die laut wurden, reichte von Kunst- und Einfallslosigkeit bis hin zur Verarschung.
Für mich, den freien Journalisten des Morgenkuriers, drittgrößte Tageszeitung im Kreis Pinneberg, war dies ein „gefundenes Fressen“: Daraus ließ sich doch etwas stricken. Und es bot mir die Gelegenheit, endlich einmal eigene Kritik an der Auswahl der Künstler einfließen zu lassen, die in der Museumsscheune ausstellen durften: Darauf war ich schon lange scharf gewesen. Ich beugte mich ein wenig vor und las, um den Faden wieder aufzunehmen, noch einmal den letzten Abschnitt meines Artikels.
Etwa zwanzig Minuten später, ich hatte den Zeitungstext fast beendet, klingelte es Sturm an der Haustür: Das konnte nur Dennis sein. Ich erhob mich, eilte nach unten und ließ meinen Sohn sowie dessen gleichaltrigen, vietnamesischen Klassenkameraden Toan ein. Dieser grüßte asiatischfreundlich, wobei er von einem Ohr zum anderen grinste.
„Hallo, Herr Bröker!“
„Wir haben uns in der Reuterstraße getroffen und sind dann kurz zu ihm gegangen“, erklärte mir Dennis. „Wir wollen ein bisschen mit den Lego-Steinen bauen.“
Sprach´s und schälte sich aus seiner beigen Übergangsjacke, die er gewohnheitsmäßig auf den Boden warf: Ordnung war nicht gerade seine Stärke. Toan hingegen hängte seine Jacke brav an die Garderobe.
„Ganz schöner Sturm, Herr Bröker, nicht?“ stellte der kleine Vietnamese mit freudigem Gesichtsausdruck fest: Das raue Lüftchen draußen schien ihm Spaß zu machen. „Schade, dass meine Eltern keine Zeit haben, nach Wedel an die Elbe zu fahren. Würde gern mal sehen, ob der Hafen überschwemmt ist.“
„Hochwasser ist gegen fünf. Wenn Ihr wollt, gucken wir uns das nachher mal an!“ schlug ich vor und löste damit bei den beiden Jungen Jubel aus. „Du musst aber Deinen Eltern Bescheid sagen – ja, Toan? Am besten, Du rufst gleich an.“
Ich drückte dem mandeläugigen Vietnamesen mit der amerikanischen Stoppelfrisur das schnurlose Telefon in die Hand. Kurz darauf war die Angelegenheit geklärt: Er durfte mit. Nun wollten die beiden Klassenkameraden aber erst einmal unter sich sein. Sie versorgten sich in der Küche mit Cola Light, schnappten sich die Chipstüte in der Stube und verschwanden nach oben.
Ein Blick auf die schlichte Küchenuhr an der Wand signalisierte mir, dass meine Frau in Kürze aus Hamburg zurückkehren würde. So ließ ich die Text-Arbeit erst einmal ruhen und machte mich stattdessen in der Küche zu schaffen: Meine Kochkünste waren gefragt. Wie es sich Miriam gewünscht hatte, bereitete ich − gewohnheitsmäßig schnell − einen babykopfgroßen Blumenkohl zu, den er dem bereits volljährigen, wenig geräumigen Kühlschrank entnahm: Mehr wollte sie nicht.
Seit Wochen, nein, seit Monaten, ernährte sich meine kleine, füllige Frau, die unbedingt abspecken wollte, fast ausschließlich von Gemüse und Obst und trank literweise Mineralwasser. Nur selten gab sie ihrem Heißhunger auf Fleisch und deftigeren Gerichten nach. Ich bewunderte ihre Selbstdisziplin und ihr Durchhaltevermögen, konnte aber äußerlich nicht feststellen, dass sie tatsächlich abnahm.
Trotzdem glaubte ich ihr, wenn sie mir versicherte: „Ich habe diese Woche schon wieder abgenommen. Hättest Du gedacht, dass ich das schaffe?“
Seitdem Miriam für das Hamburger Security-Unternehmen „Assist“ in Wechselschicht arbeitete, kümmerte ich mich um das Mittagessen. Zwar war es mit meinen Kochkünsten nicht weit her, wie ich wohl wusste, aber unseren heruntergeschraubten Ansprüchen genügte es. Schnell zubereitete Spaghetti, grobe Bratwurst von ALDI, Kohlrouladen aus der Dose, Salami-Pizza von Minimal, hygienisch verpackte Hähnchenflügel und Jägerklößchen aus der Tiefkühltruhe standen wöchentlich auf meiner Speisekarte. Wenn meine Frau ausnahmsweise einmal Zeit zum Kochen fand, kamen zur Freude von uns beiden „Männern“ ausschließlich frische Gerichte auf den Tisch.
„So kocht man bei uns zu Hause in Polen!“ hieß es dann jedes Mal von ihr, wenn sie bemerkte, wie gut es dem „Rest“ der Familie schmeckte. Aber ihr war auch klar, dass mir alltags normalerweise wenig Zeit zum Kochen verblieb: Die Redaktion des Morgenkuriers wartete täglich auf meine Berichte.
*
Miriam gehörte zum Wachtpersonal des Hamburger Security-Unternehmens „Assist“. Ihre Aufgabe war es, die überwiegend arabischen Flieger in den mächtigen Flugzeughallen auf dem Hamburger Flughafen Fuhlsbüttel im Auge zu behalten − ein öder, langweiliger, aber immerhin stressfreier Job. Diesen hatte sie angenommen, nachdem sämtliche Bemühungen gescheitert waren, wieder in ihrem Beruf Fuß zu fassen. Sprachprobleme, Unterschiede im Berufsbild zwischen Polen und Deutschland sowie auch schon das Alter standen einem beruflichen Wiedereinstieg der hochqualifizierten Hydro-Biologin und Umweltschutztechnikerin im Wege.
Ich bedauerte zutiefst, dass meine Frau, mittlerweile zehn Jahre an meiner Seite, gezwungen war, unqualifizierte, stupide Arbeit zu verrichten. Aber mit meinem schmalen Honorar, das ich als freier Journalist einstrich, kamen wir einfach nicht über die Runden.
„Mir macht das nichts aus, Stefan − wirklich nicht“, versicherte sie mir, wenn wir darauf zu sprechen kamen. „Ich arbeite gern auf dem Flughafen.“ Die Nachtschicht sei allerdings stressig, gab sie zu. Sie habe Mühe, wach zu bleiben. Aber allzu oft komme das ja nicht vor.
Bis vor drei, vier Jahren war unsere wirtschaftliche Situation noch eine völlig andere gewesen. Damals verdiente ich so gut, so dass wir Eheleute sogar Arbeitsteilung vornehmen konnten. Während ich für Bewegung auf dem Konto sorgte, kümmerte sich Miriam um Reihenhaus, Garten und Familie. Doch die lang anhaltende Rezession und die Dauer-Massenarbeitslosigkeit wirkten sich auch auf das Zeitungsgeschäft zunehmend negativ aus. Die Menschen sparten, viele konnten oder wollten sich ein Zeitungsabonnement nicht mehr leisten. Und das bekam auch der Morgenkurier zu spüren, der von zahlreichen Abonnementskündigungen sowie Einbrüchen beim freien Verkauf betroffen war.
Leander von Brecht, Verleger des Morgenkuriers, reagierte darauf mit einer Reihe von einschneidenden Sparmaßnahmen, die allerdings einseitig auf Kosten von uns freien, sprich: rechtlosen Journalisten ging. So reduzierte er unter anderem den Seitenumfang des Blattes und legte ein stark heruntergeschraubtes Zeilenlimit für die Berichte fest, die statt mit mehreren zukünftig nur noch mit je einem Foto illustriert werden sollten − ein Fiasko insbesondere für mich, der ich als einziger ausschließlich vom Zeilen- und Bildhonorar lebte: Meine Existenz war akut gefährdet.
Trotzdem dachte ich keinen Augenblick daran, deswegen das Gespräch mit meinem Chef zu suchen. Es war zwecklos, wie ich wusste, und würde meine Situation nur verschlechtern. Aber in mir wuchs seit damals der Hass gegenüber dem, wie ich schon früh erkannt hatte, gewissen- und skrupellosen Unternehmer, der für seine Profitinteressen über „Leichen“ ging. Anmerken ließ ich mir nichts, sondern spielte stattdessen weiterhin den pflegeleichten Mitarbeiter, der alles schluckte und dankbar war, dass er sich beim Morgenkurier nützlich machen durfte. Was sollte ich machen? Ein Zurück in meinen erlernten Beruf als Elektriker, den ich bereits vor einem halben Menschenleben geschmissen hatte, gab es für mich nicht, ebenso wenig eine wirkliche Job-Alternative. Und Schreiben schien ein Talent zu sein, über das fast alle verfügten: Die Zeitungen waren überlaufen von freien, leicht zu handhabenden Journalisten.
2.
Wer in einer Stadt wohnt, hat gewöhnlich auch Nachbarn, mit denen er sich mehr oder minder gut versteht. Mit unseren Nachbarn in der Uetersener Jochen-Klepper-Straße hatten wir drei Brökers kein Glück. Sie vertraten eine Spezies, die sich im Laufe der Evolution insbesondere in Deutschland durchgesetzt hatte und sich trotz veränderter „Umweltbedingungen“ noch immer als zahlenmäßig starke Population behauptete: Kleinbürger oder Spießer. Zwischen ihnen und uns war als „höchstes der Gefühle“, wie uns die Erfahrung gelehrt hatte, nur ein Waffenstillstand möglich − der allerdings jederzeit in eine Konfrontation umschlagen konnte. Dementsprechend gestaltete sich unser Umgang mit ihnen äußerst distanziert und beschränkte sich, wenn wir sie nicht völlig ignorierten, auf einen flüchtigen Gruß und hin und wieder ein paar unverbindliche Floskeln im Vorübergehen.
Für Dennis waren die meisten unserer Nachbarn „muffelige, alte Typen“, wie er formulierte, denen er am liebsten aus dem Weg ging. Aber auch die einzige junge Familie mit Kindern, die am Ende des Häuserblocks wohnte und über das größte Grundstück in der Jochen-Klepper-Straße verfügte, mochte er nicht: Er fand sie fade und langweilig.
„Die hocken jeden Sonntag in ihrem Glaubensschuppen und trällern in allen möglichen Chören mit“, mokierte er sich. „Und die Mädchen lachen nie und sind immer so brav. Mit denen kann man bestimmt keinen Spaß machen.“
Tatsächlich gehörten die Winters zu den aktivsten Gliedern der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde im Ort, ließen keinen Gottesdienst und keine wohltätige Veranstaltung aus und liehen ihre Stimme den christlichen Chorgemeinschaften unter dem Dach der barocken Klosterkirche. Die Stimme der Ehefrau und Mutter, die den verpflichtenden Vornamen Christina trug und für Hausarbeit und Nachwuchs zuständig war, hörte man allerdings auch häufig bis zu unserer Wohnung, wenn sie in fast hysterischem Tonfall mit ihren strohblonden, eingeschüchterten Mädchen schimpfte: Das klang wenig danach, als käme es aus einem liebenden, christlichen Herzen.
Am auffälligsten an ihr war für mich ihr unfroher Gesichtsausdruck, mit dem sie gewöhnlich herumlief. Manchmal allerdings verwandelte er sich in eine Leidensmiene, die Anlass zur Besorgnis geben konnte. Woran litt sie? An sich selbst? An der Schuld, die wir alle auf uns geladen hatten? An der Gottlosigkeit in dieser Welt? Wo blieb die unbeschwerte Heiterkeit und Gelassenheit, die aus der Geborgenheit im Schöpfer entsprang?
Tiefe Abneigung empfanden wir drei Brökers, insbesondere aber Dennis und ich, gegenüber der Nachbarin von Nummer zweiunddreißig, Helen Dreyer. Die fette, unproportionierte Frau undefinierbaren Alters, die mich um Haupteslänge überragte und sich entenhaft watschelnd vorwärts bewegte, gehörte zu den Bewohnern „unseres“ Häuserblocks, die Luft für uns waren. Sie hatte sich uns gegenüber von Anfang an abweisend verhalten und demonstrierte uns bald, wer sie war − nämlich eine unintelligente, frustrierte und aggressive Kuh.
Den ersten Vorfall mit ihr gab es bereits einige Tage nach unserem Einzug in die Uetersener Jochen-Klepper-Straße und betraf Dennis und seine kleine, dunkelhaarige Schulfreundin Vivian. Sie erlebten eine unangenehme Überraschung, als sich ihnen während einer Besichtigungstour durch die Nachbargärten auf einem für alle Mieter offenen Plattenweg plötzlich die Dicke in den Weg stellte, sie übel beschimpfte und davonjagte. Die Kinder liefen sogleich zu mir und berichteten mir aufgebracht von dem unerfreulichen Vorfall.
„Als wir an ihrem Haus vorbeikamen, ist sie gleich rausgestürmt und hat uns alle möglichen Schimpfwörter an den Kopf geworfen“, erzählte Dennis empört und mit hochrotem Kopf. Und seine bezopfte Begleiterin fügte zornig hinzu: „Die wollte und den Arsch versohlen, wenn wir nicht sofort verschwinden!“
„Das hat man wohl bei diesem Fettgewächs versäumt“, erwiderte ich spontan und löste damit bei den Beiden lautes Gelächter und eine Art Wettbewerb um die deftigsten Schimpfwörter aus, mit denen sie Dreyer belegen konnten: Ob ihr wohl die Ohren klangen?
Wenig später stand ich vor dem Haus Nummer zweiunddreißig und klingelte, um die Dicke zur Rede zu stellen. Sie öffnete nach einer Weile und musterte mich spöttisch von oben bis unten − um dann wortlos wieder die Tür zu schließen: So musste ich unverrichteter Dinge wieder abziehen. Allerdings ergab sich bereits am folgenden Tag bei einer zufälligen Begegnung in Höhe des Rondells am Ende der Jochen-Klepper-Straße die Gelegenheit, ihr die Meinung zu geigen − verbunden mit der Warnung, die Kinder nicht mehr zu belästigen. Dabei musste ich neben der Dicken herlaufen, die nicht einen Augenblick stehenblieb und es eilig hatte, in ihre schützenden vier Wände zu kommen. Dort stellte sie sich ans Fenster und bedeutete mir mit einer unmissverständlichen Geste, wofür sie mich hielt − nämlich für einen ausgemachten Idioten. Dann verschwand sie in der Wohnung.