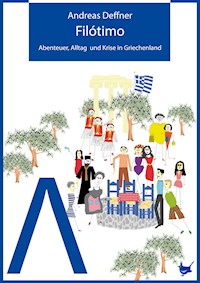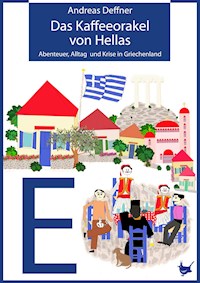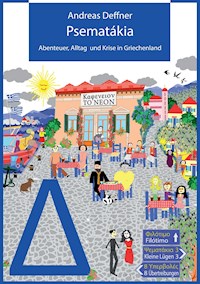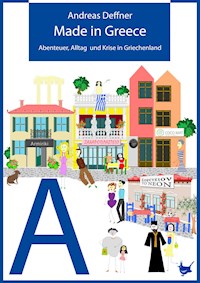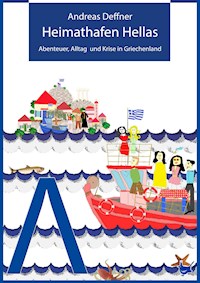7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit Griechinnen und Griechen durch ihren Alltag. Andreas Deffner begleitet die Protagonisten und lernt so Land und Leute abseits der Touristenpfade richtig kennen. In Band 6 der Reihe "Abenteuer, Alltag und Krise in Griechenland" dreht sich alles um das Thema Liebe. So vielschichtig und schillernd, wie es wohl nur die Griechen beschreiben können. Haben sie deshalb gleich mehrere Wörter für den Begriff der Liebe? Worin liegen die Unterschiede? Und was hat Platon davon gewusst? Fragen über Fragen und reichlich Antworten liefern die Erlebnisse in Griechenland von A bis Z. Von Athen, über das Epirus, durch Thessaloniki, über die Peloponnes und zurück. Eine Reise zu den Wurzeln der Liebe, zu Agápi und Érotas. Jedes Kapitel ein heiterer Spaziergang, der Lust darauf macht, mitzulaufen. Und jedes Kapitel bringt außerdem das passende, original griechische Kochrezept. Lassen Sie sich von den Geheimnissen der Griechinnen und Griechen verführen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Agápi und Érotas
www.abenteuer-griechenland.eu
Andreas Deffner
Agápi und Érotas
Abenteuer, Alltag und Krise in Griechenland
IMPRESSUM
Agápi und Érotas
Autor
Andreas Deffner
Schriften
Constantia
Covergestaltung
Marti O’Sigma
Lektorat
Theo Mavrogatos
Verlagslabel
Filótimo!-Verlag
Buchsatz von tredition, erstellt mit dem tredition Designer
ISBN Hardcover: 978-3-384-48256-3
ISBN E-Book: 978-3-384-48257-0
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg,
Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne
seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung
erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Andreas Deffner,
Lendelallee 34, 14469 Potsdam, Germany . Kontaktadresse nach EU-
Produktsicherheitsverordnung: info@abenteuer-griechenland.eu
© 2025 Andreas Deffner
Website: www.abenteuer-griechenland.eu
I N H A L T
PROLOG 8
AGÁPI, ÉROTAS UND AMEN! 13
Wenn die Kirche weltlich wird
DER KÄSESCHMELZER VON KAYSERI 31
Ein Bougátsa-Baby mit Guinness-Rekord in Thessaloniki
DAS STAATSBORDELL 50
Die Leiden eines Solaranlagensymphatisanten
TENEKÉ IST WEG! 55
Ein winterlicher Blechdosendiebstahl
DURCHS FEUCHT-FLEISCHIGE TZOUMERKA 67
Wilde Natur und Tavernenfreuden mit Meráki
DAS CHAOS LEBT IN ATHEN 98
Wo steckt Pavlina, und wann kommt Erdogan?
VON DER LIEBE, UND DEM VERGESSEN 123
Ein Drehbuch der Liebe, vom Strand bis in den Sessel
WELTREKORDE UND KRÄUTERPITA 133
Vom Mount Everest bis zum göttlichen Olymp
VON AVLÍ BIS MÁNESI 167
Den Dorfkamáki erwartet ein königlicher Tod
FAVATASTING UND FAHRERFLUCHT 192 Uriger Unfallzeuge zwischen Feuerholz bis Kanarienvogel
MIT DER METRO ZUR VIA EGNÁTIA 213
Ein musikalischer Zug von Rom bis Kappadokien
DAS KERAMISCHE EXTRABLATT VON THESSALONIKI 226 Die Kellnerin der Tonkunst
BLOCKHAUSIDYLLE AM SPERRGEBIET 245 Vom Kurort in die Tiefe der Geschichte
NACHWORT UND DANK 277
REZEPTREGISTER 280
BIOGRAPHISCHES 281
ANMERKUNGEN/QUELLENANGABEN 283
Für Adonis, die Liebe, das Leben, und Filótimo!
PROLOG
»Τώρα νοσταλγώ τις μέρες που υπήρχε αγάπη«
Liedzeilen aus »Νοσταλγώ Τις Μέρες«
von Domenica, 2022
»Jetzt vermisse ich die Tage, als es noch Liebe gab.«
Abenteuer, Alltag und Krise in Griechenland: Die Reihe, die mit dem »Kaffeeorakel von Hellas« begann, findet mit »Agápi und Érotas« ein hoffentlich würdiges Ende. Als ich 2006 die ersten »Spaziergänge« mit Griechinnen und Griechen durch ihren Alltag gemacht habe, war das Ziel, ein Buch zu schreiben. Ich wollte den Leserinnen und Lesern das echte Leben abseits der Touristenpfade zeigen. Sie sollen durch meine Spaziergänge Land und Leute besser kennenlernen. Das wollte ich auch den vielen Millionen Griechenlandurlaubern anbieten, die Jahr für Jahr das Land meines Herzens besuchen.
Erst viele Spaziergänge später war klar, dass sich das ganze Land nicht in einem Buch beschreiben lassen würde. Erst recht nicht, nachdem Griechenland ab 2008, erst langsam und dann rasant, in eine historische Wirtschafts- und Finanzkrise geriet. Die Krisenjahre hatten erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Griechinnen und Griechen, und so wäre der erste Band dieser Reihe auch beinahe nicht erschienen. Der ursprüngliche Verlag, bei dem ich unter Vertrag stand, wollte das Buch plötzlich um viele Jahre verschieben. Man wollte zunächst abwarten, wie sich die Krise entwickeln und welche Auswirkungen sie auf das Alltagsleben in Griechenland haben würde. Doch gerade das wollte ich nicht: Abwarten. Ich löste den Vertrag auf, fand eine Alternative, um das fertige Manuskript von »Das Kaffeeorakel von Hellas« zeitnah im Jahr 2010 zu veröffentlichen, und parallel begann ich mit der Arbeit an Band 2, »Filótimo!«, erschien 2012, Band 3, »Heimathafen Hellas«, 2015, Band 4, »Made in Greece«, 2019 und schließlich 2022, Band 5, »Psematákia«.
Mit dem Größenwahn-Verlag hatte ich den richtigen Partner für die Buchreihe gefunden, und für eine Neuauflage hatten wir beschlossen, dass jeder Band auf dem Buchrücken einen griechischen Buchstaben tragen sollte. So würde nach sechs Bänden im Bücherregal zu lesen sein: »ΕΛΛΑΔΑ«, das griechischen Wort für Griechenland. Die Idee: Wer alle sechs Bände gelesen hat, versteht Land und Leute und kennt sich aus in Hellas.
Alle Bände haben einen roten Faden, der sich thematisch durch die Kapitel zieht. Das Kaffeetrinken in Band 1, das Lebensgefühl in Band 2, die erste Reise in meine zweite Heimat und die verrücktesten Erlebnisse in Band 3, Produkte, Ideen und Leistungen Made in Griechenland in Band 4, kleine Schummeleien in Band 5. Bei der Planung des letzten Bandes, des Abschlussbuches meiner großen Reise, wurde mir unwohl. Inzwischen war mir klar, dass ich noch unzählige weitere Spaziergänge mit Griechinnen und Griechen durch ihren Alltag machen könnte. Griechenland steckt voller Überraschungen, ist prall gefüllt mit Geschichte und Zukunft, und bietet noch so unendlich viel zu entdecken. Was also könnte das angemessene Thema für Band 6 sein?
Ich liebe Griechenland. Seine Menschen, ihr Lebensgefühl, Land und Leute, das Klima, Essen & Trinken, die Vielfalt, die Spontanität und die zuverlässige Unzuverlässigkeit, die einen immer wieder zum Improvisieren zwingt. Aber was lieben eigentlich die Griechinnen und Griechen? Ich habe so viel Liebe in den unterschiedlichsten Ausprägungen in Griechenland erfahren, davon wollte ich in Buchform etwas zurückgeben. Und mir war schnell klar, dass es in Hellas keine einfachen Antworten gibt. Im Deutschen gibt es das Wort Liebe. Den Griechen wäre das zu banal. Sie haben in ihrer Sprache gleich mehrere Begriffe für Liebe. Im Griechischen unterscheidet man grundsätzlich zwischen »Agápi« und »Érotas«. Hatte ich mir ein zu komplexes Titelthema überlegt? Oder liegt gerade darin der besondere Reiz?
Lasst mich als kurzen Einstieg, und zum besseren Verständnis, auf Platon zurückgreifen. Der antike griechische Philosoph wurde 428 oder 427 v. Chr. geboren und zählte zu den wichtigsten Gelehrten seines Landes. Eines seiner bedeutendsten Werke ist das »Symposion«, das vermutlich um das Jahr 380 v. Chr. entstanden ist. Ein fiktionales Werk, über ein Gastmahl, das auch als Trinkgelage bezeichnet werden kann. Die Teilnehmer: Philosophen und Dichter. Sie hatten sich zur Aufgabe gemacht, das Wirken des Liebesgottes Eros zu würdigen, der in der griechischen Mythologie als Gott der begehrlichen Liebe bezeichnet wird. Jeder der zehn Teilnehmer trägt etwas über die Natur der Liebe bei, indem er seine eigene Perspektive erläutert. So philosophieren sie bei Wein über ihre unterschiedlichen Ansätze aus teils gegensätzlichen Theorien. Der Rebsaft fließt in Strömen und ich stelle mir dabei eher ein antikes griechisches Gelage vor als ein wissenschaftliches Zusammentreffen.
Doch nach dem Willen des Gastgebers Agathon soll an diesem Abend nicht nur wild gefeiert, sondern auch tiefgründig diskutiert werden. Die Gäste, allesamt Philosophen, Dichter und Denker, dürfen der Reihe nach vortragen, was sie über die Liebe, und über den Gott Eros, denken. Dabei sollen sie begründen, wie sich Érotas, die leidenschaftliche, sinnliche Liebe im Verhältnis zu Agápi, der selbstlosen, spirituellen Liebe, verhält.
Für Phaidros, der den Abend eröffnet, ist Eros die mächtigste aller Kräfte. Sie inspiriere zu Heldenmut und großen Taten. Wer wie Eros, also erotisch, liebe, tue Dinge, die er sonst nie wagen würde. Und er würde Gutes tun wollen, um nicht vor dem oder der Geliebten schlecht dazustehen.
Pausanias unterscheidet zwischen der »edlen« Liebe, die die Seele inspiriere (Agápi), und der »gewöhnlichen« der körperlichen Liebe Érotas. Beide könnten unabhängig voneinander positiv sein, solange sie in den richtigen Grenzen bleiben. Die himmlische Liebe Agápi sei aber nur unter Männern möglich.
Eryximachos sieht die Liebe hingegen überall, sogar in der Natur und im Kosmos. Für ihn ist die Liebe ein harmonisches Gleichgewicht, wie bei Gesundheit und Krankheit. Und vieles Schlechte würde auf die Unordnung und Zügellosigkeit des Eros zurückzuführen sein.
Aristophanes, hat eine eher abwegige Theorie: Früher seien Menschen kugelrund gewesen und hätten zwei Köpfe, vier Arme und vier Beine gehabt. Zeus habe schließlich aus Angst vor zu viel Macht die Menschen in zwei Hälften gespalten. Seitdem würden wir unsere andere Hälfte suchen, wobei uns Érotas, die tiefe Sehnsucht, helfen würde. Für Aristophanes ist Eros der menschenfreundlichste Gott.
Gastgeber Agathon glänzt mit einer poetischen Rede: Seiner Meinung sei Eros die Quelle aller Schönheit und Tugend, und er strebe immer nach dem Guten. Eros sei der jüngste Gott, und er altere nie.
Sokrates bringt einen göttlichen Aspekt ins Spiel, als er eine Priesterin, die Diótima, zitiert und erklärt, dass Eros weder besonders gut noch besonders schlecht, aber unvollkommen sei. Die Diótima unterscheide gar in fünf Stufen der Liebe, von der körperlichen bis zur Liebe des Schönen an sich. Dazwischen drei weitere Entwicklungsstufen. Sokrates sieht den Eros daher als Mittler zwischen Sterblichen und Göttern. Die Liebe beginne mit körperlicher Anziehung (Érotas) und führe schließlich über die Liebe zur Seele zur höchsten Stufe der Liebe, zur Schönheit selbst. So erreiche sie die vollkommene Liebe, die Agápi.
Letztlich kommt der völlig betrunkene Alcibiades zu Wort, der die philosophischen Gedanken seiner Vorredner ignoriert. Er schwärmt stattdessen von seiner unerwiderten Liebe zu einem der anderen Teilnehmer. Er zeigt damit die Kehrseite von Érotas, nämlich Sehnsucht, Eifersucht und Leidenschaft.
Die weinselige Runde zeigt auf, dass die Liebe viele Gesichter hat. Von der körperlichen, leidenschaftlichen, die als Érotas daherkommt, bis zu einer höheren, geistigen Dimension, namens Agápi. Beide gehören zwar irgendwie zusammen, aber sie im Gleichgewicht zu halten, sei nicht einfach. Und so endet das Symposion vor knapp 2500 Jahren, wie so manche Party der Gegenwart, in einer Mischung aus Wein, Philosophie, Chaos und Herzschmerz. Und seit jeher ist man sich darin einig, dass die Liebe kompliziert ist und unendliche Facetten hat.
Platon verzichtet im »Symposion«, ebenso wie in seinen anderen Werken, auf eine eigene Lehrmeinung. Wie ein abstrakter Maler überlässt er es den Betrachtern, sich jeweils eigene Meinungen zu bilden.
So wie aus dem Symposion jede und jeder ein eigenes Fazit ziehen soll, so überlasse ich es auch meinen geschätzten Leserinnen und Lesern über »Agápi und Érotas« zu urteilen, zu diskutieren und im besten Fall zu philosophieren. In welchem Kapitel findet sich die Analyse von Sokrates, in welchem die Auffassung von Agathon? Wo ist Pausanias am ehesten verortet, und wo hat Phaidros seine Finger im Spiel?
In diesem Sinne wünsche ich eine erfüllende Lektüre mit den letzten Puzzlesteinen Griechenlands und eine weiterhin gute Reise. Καλό ταξίδι! (Kaló taxídi)
Andreas Deffner, Januar 2025
1
AGÁPI, ÉROTAS UND AMEN!
Wenn die Kirche weltlich wird
»Γιατί η αγάπη είναι θύελλα και κουνάει και βουνά.«
Liedzeile aus »Η αγάπη είναι θύελλα«
von Vasilis Karras, 2012
»Weil die Liebe ein Sturm ist, der sogar Berge bewegt.«
Julia sagte: »Du musst ihn unbedingt treffen!« Und damit hatte sie aufgelegt. Sie ließ keinen Zweifel aufkommen: Dieser Mensch würde mein Leben verändern. Meine Neugierde war geweckt. Und da ich ohnehin in den nächsten Monaten in der Gegend sein würde, schrieb ich unserer Vereinsvorsitzenden rechtzeitig vorab, wann ich vor Ort sein würde. Sie sollte einen Termin organisieren. Gemeinsam mit einigen Griechinnen, Griechen und Deutschen, die in und rund um Nafplion, der ersten Hauptstadt des modernen Griechenlands wohnen, und Deutsch und Griechisch sprechen, hatten wir vor einigen Jahren den Verein Filia zur Völkerverständigung ins Leben gerufen. Julia ist seitdem mit voller Hingabe die 1. Vorsitzende und organisiert zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen in und um Nafplion oder mit der deutschen Partnerstadt Ottobrunn. Im Dezember 1832 wurde König Otto von Griechenland im heutigen Ottobrunn von seinem Vater verabschiedet und regierte von da an zunächst aus Nafplion (ursprünglich auch Nauplia genannt), ehe die Hauptstadt später nach Athen verlegt wurde. Der Beziehung zwischen Nafplion und Ottobrunn schadete der Umzug jedoch nicht. In Ottobrunn wurde an der Stelle des Abschieds die Ottosäule errichtet und in Nafplion ein bayerischer Löwe. 1921 wurde die damals wachsende Siedlung in Erinnerung an Otto von Griechenland in Ottobrunn umbenannt. Und im Jahr 1978 wurde die Städtepartnerschaft zwischen Ottobrunn und Nafplion besiegelt.
190 Jahre nach Ottos Aufbruch nach Nafplion lernt die Vereinsvorsitzende Julia zufällig in der Nähe einer kleinen, aber spektakulären Kirche beim Gassigehen mit ihrem Hund, Kostas kennen. Sie hatte mir sofort von dieser Bekanntschaft erzählt, ich solle unbedingt über ihn und seine große Liebe schreiben. Kostas, eigentlich Konstantinos, sei ein älterer Herr, jugendlich im Herzen und mit göttlicher Freundlichkeit ausgestattet. Julia würde mir einen Kontakt herstellen und sie würde dann gerne auch zu unserem Treffen dazukommen.
Konstantinos Papatheodórou, ein griechischer Architekt, hat in der Nähe der Kreisstadt Trípolis, rund 50 Kilometer von Nafplion entfernt, eine Kirche errichtet, die Baustile aller Epochen abbildet, und die die kirchliche mit der menschlichen Welt zu vereinen versucht. Der orthodoxen Kirche war das Bauwerk von Anfang an suspekt. Ein Verein ist der Betreiber der Ágia Fotiní. Hochzeiten und Taufen werden hier gern durchgeführt, den Popen muss man sich dafür allerdings selbst mitbringen.
September 2022
An diesem Morgen hatte ich mich noch im Heilwasser der Vulkanhalbinsel Methana geräkelt, danach einen Frappé an der Promenade getrunken und schließlich bei der guten Freundin Aspasía ein kleines Mitbringsel erworben. Am Nachmittag würde ich den sagenumwobenen Baumeister der Ágia Fotiní treffen. Ich wollte nicht unvorbereitet sein und hatte im Vorfeld etwas über diese einzigartige Kirche gelesen. Man müsse das Bauwerk in einer Reihe mit Gaudís »La Sagrada Família« in Barcelona und der »Santuario della Madonna delle Lacrime« in Syrakus nennen, hieß es unter anderem. Während ich bereits auf dem Weg bin, fallen mir diese Sätze wieder ein, und ich zweifele umgehend, ob meine beiden Seifen ein ausreichendes Gastgeschenk für den Großmeister der Architekten sein würden, auch wenn sie mit vulkanischem Heilwasser handgesiedet und von bester Qualität sind. Ich lasse es darauf ankommen.
Da ich rechtzeitig losgefahren bin, kann ich unterwegs einen kurzen Stopp einlegen und einen kleinen Mittagssnack zu mir nehmen. Spontan entschließe ich mich am Küstenstreifen des Ägäisbeginns gegenüber von Nafplion in der kleinen Ortschaft Mýli anzuhalten. Die kleine Taverne »Τα πέντε Φ«, die fünf F, sieht einladend aus. Im Schatten der Mittagssonne sitzen bereits zahlreiche Menschen auf typisch urigen Korbstühlen an wackeligen Holztischen mit blau-weiß karierten Tischdecken. Kaum habe ich mir einen Platz mit unverbautem Blick auf die Ägäis gesucht, erscheint wie aus dem Nichts der herumeilende Kellner. Er deckt meinen Tisch in Windeseile mit der obligatorischen Papier-Tischdecke, stellt eine Flasche Wasser darauf und fragt, ob ich noch weitere Gäste erwarte oder alleine sei.
»Ich bin allein unterwegs, nur auf der Durchreise, und hatte etwas Appetit. Was habt ihr denn Frisches für mich?«
»Warte, ich bring dir unsere Karte. Alles ist frisch, besonders der Fisch. Frisch von gegenüber!« Der sympathische, hagere Endfünfziger gibt sich als Chef des Ladens zu erkennen, deutet auf einige kleine Fischerboote am Anleger gegenüber der Straße und bringt schon kurz darauf die übersichtliche Karte mit typischen Fischtavernengerichten. Neben diversen Fischen auch Oktopuskroketten. Das klingt gut, hatte ich noch nirgends gesehen. Die will ich probieren. Und geräucherter Pérka mit hausgemachter Remoulade klingt ebenfalls verlockend. Eine kleine Barschart, die im Mittelmeer häufig gefangen wird. Ich mag das feste weiße Fleisch, das dürfte auch geräuchert köstlich sein. Dazu noch etwas Salat und ich wäre satt. Schnell rufe ich dem Tavernenwirt meine Bestellung zu, doch ich habe Pech.
»Die Oktopuskroketten sind leider aus. Meine Frau macht sie selbst, sie sind zu lecker.«
Ich beschließe kurzerhand, frittierte Zucchinibällchen zum Pérka zu bestellen, dazu einen Dákossalat mit Tomaten, Kapern, Zwiebeln. Dákos ist eine Art traditioneller Zwieback, der im Salat mit reichlich Olivenöl übergossen wird, das ihn dann saftig aufweichen lässt. Schon wenig später duften die Köstlichkeiten vor mir auf dem Tisch um die Wette. Die Zucchinibällchen sind köstlich und tatsächlich frisch in Olivenöl gebraten. Ein Gedicht. Die Tomaten und der Dákos schmecken nur in Griechenland so saftig aromatisch, und den Pérka probiere ich zuletzt. Etwas viel der Remoulade, die mit feinen Karottenstreifen jedoch frisch und lecker aussieht. Vom Pérka ist allerdings unter ihr wenig zu sehen. Der erste Bissen schmeckt gut. Räucherfisch. Kommt mir bekannt vor. Mit der Gabel streiche ich aus Neugierden die Remoulade beiseite, um den Fisch besser sehen zu können. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ganz deutlich liegt ein geräuchertes Heringsfilet auf dem Teller, so eins, wie man es häufig in Folie eingeschweißt im Supermarkt findet. Ich hätte es ahnen können, Räucherfisch ist nicht gerade eine griechische Spezialität und ganz besonders nicht hier auf der Peloponnes. Doch dem freundlichen Wirt kann ich diese kleine Schummelei auf der Speisekarte verzeihen, denn ich habe trotz allem gut und fast zu viel gegessen.
Ich könnte jetzt einen Mittagsschlaf machen oder mich zumindest auf eine Liege fläzen, so wie es die alten Griechen in der Antike getan haben, wenn sie zum Symposium zusammenkamen. Bei diesen Gelagen, die bereits Platon beschrieb, wurde zuerst ausgiebig gespeist, um dann anschließend bei Wein gesellig über gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Bei mir steigt die Vorfreude auf das, was mich gleich in Mantineía erwarten wird.
Von der Taverne an der Küste sind es nur rund 60 Kilometer bis in die Gegend der aus der Antike bekannten Stadt in der Nähe der heutigen Kreishauptstadt Trípolis. Schon sitze ich hinterm Steuer und lenke den Mietwagen kurz hinter Mýli in Richtung der historischen Bergwelt. Es geht serpentinenartig am Hang der Berge entlang, und immer weiter hinauf. Der Gebirgszug zu meiner Rechten steigt auf knapp 2.000 Meter an und bietet eine beeindruckende Kulisse. Kurz vor Trípolis erreicht die Straße die fruchtbare Hochebene, an deren nördlicher Seite Mantineía auf rund 600 Höhenmetern liegt. In der Antike gab es hier, am Ort der späteren Stadt, zunächst einen losen Zusammenschluss von fünf Dörfern des Stammes der Mantineíer. Um 460 v. Chr. schlossen sich die Dörfer schließlich zur Polis Mantineía zusammen, die mit dem südöstlich gelegenen Tegea um die Kontrolle der fruchtbaren arkadischen Hochebene konkurrierte. Um 385 v. Chr. wurde die Stadt schließlich von den Spartanern eingenommen, die die Polis wieder zugunsten der fünf Dörfer auflösten. Später wurde die einstige Stadt von Theben neugegründet, im weiteren Verlauf der Jahrhunderte in Kriegen erschüttert. Nach einer Revolte der Bewohner gegen die damaligen makedonischen Hegemonialherren im Jahr 226 v. Chr., lies der makedonische König die Stadt als Strafmaßnahme im drei Jahre später erobern. Alle Überlebenden wurden in die Sklaverei verkauft. Kolonisten besiedelten die Stadt später unter einem anderen Namen, ehe Mantineía in römischer Zeit unter Kaiser Hadrian im 2. Jahrhundert n. Chr. wieder der offizielle Name der Stadt wurde. Erst während der Slaweneinfälle auf der Peloponnes um 700 n. Chr. wurde die Stadt von ihren Bewohnern verlassen.
Mit dem Ruf der Stadt Mantineía ist übrigens der Name der legendären Diótima verbunden. Die Seherin, die bereits in Platons Symposion eine Rolle spielte, wird als Hohepriesterin beschrieben, die um das Jahr 400 v. Chr. gelebt haben soll. Im Symposion beschreibt Sokrates, wie die Diótima ihn über das wahre Wesen des Eros aufklärte. Ob es die Priesterin tatsächlich gegeben hat, ist zwar nicht zweifelsfrei belegt, doch ihr Vortrag aus dem Symposion ist legendär geworden. Das Eros-Konzept, das Platon Diótima in diesem Dialog vortragen lässt, wird seit der Renaissance als »platonische Liebe« bezeichnet. Meine Fahrt nach Mantineía erinnert mich daran, dass ich das kleine Reclam-Heftchen, das zuhause im Regal steht, schon länger einmal lesen wollte. Ich werde es nachholen.
Als ich vor der Ágia Fotiní ankomme, sehe ich bereits einen kleinen Jeep am Straßenrand parken. Ansonsten ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen, und auch unterwegs ist mir kaum jemand begegnet. Die Einsamkeit der Hochebene strahlt mit der nachmittäglichen Spätsommersonne um die Wette. Es ist warm, aber nicht mehr heiß, jetzt Ende September.
Ein rüstiger Rentner entsteigt dem Geländewagen, als ich mich dem Fahrzeug nähere. Er trägt eine olivfarbene Rangerhose, ein langärmeliges Hemd mit Taschen, und aus einem Knopfloch des Oberteils, ragt ein kleines Kräutersträußchen mit einer stahlblauen Kornblume. Beim Aussteigen aus dem Geländewagen greift der Mann noch zu einem ebenso olivfarbenen Käppi, das er sodann auf seinen beinahe kahlen Kopf setzt. Er hängt sich eine in die Jahre gekommene, lederne Umhängetasche um, und zieht dann zwei Aluminiumkrücken aus dem Jeep. Jetzt dreht er sich zu mir um, und ich erkenne einen überwältigend freundlichen Blick. Er lächelt stumm. Ein liebevolles Lächeln, das zu seiner runden Nase und dem sympathischen Gesamteindruck passt. Ein übermenschlich gutes Lächeln, das man nie vergisst.
»Du musst Kostas sein!«
»Oh, dann bist du Andreas aus Deutschland. Ich freue mich sehr, dass du den weiten Weg bis hierher gefunden hast. Wollen wir direkt reingehen?« Kostas deutet mit einer der Krücken in Richtung der Ágia Fotiní, seiner »Kirche«.
Genau in diesem Moment piept mein Handy. Eine Nachricht von Julia: Sie wird sich verspäten, aber wir sollten schonmal mit unserem geplanten Rundgang beginnen.
»Ja gerne«, sage ich zu Kostas. »Lass uns reingehen, ich bin sehr gespannt. Ich war zwar schon einmal hier, allerdings nur mehr oder weniger zufällig. Es ist ein erstaunliches Gebäude, viel mehr weiß ich noch nicht.«
»Also los, gehen wir! Ich bin übrigens nicht mehr so gut zu Fuß, aber mit den Krücken klappt es ganz gut.« Wieder blickt er mich mit einem Lächeln an, das gottgegeben scheint. Es nimmt mich in seinen Bann. Wie Gotteswerk und großmütige Liebe. Jesusgleich vermutlich.
»Julia kommt übrigens etwas später, sie hatte noch zu tun und lässt sich entschuldigen.«
Als ich ihren Namen erwähne, funkeln Kostas Augen. Später bei der Lektüre des Symposions von Platon muss ich wieder an diese Szene denken. Mit den Krücken in der Hand nickt Kostas mir etwas enttäuscht zu, bevor er mir plötzlich ungefragt sein Alter verrät. Ich bleibe unvermittelt stehen. Okay, ich hätte ihn im Rentenalter geschätzt, das ja. Aber dass er bereits 86 Jahre alt ist, lässt mich mit offenem Mund staunen. Man sieht ihm sein Alter absolut nicht an. Er muss leise lachen, als ich ihm meine Überraschung kundtue. Ich bin sicher, nicht einmal die Seherin Diótima hätte sein wahres Alter erraten.
Schon als Julia mir das erste Mal von Kostas Papatheodórou erzählte, hatte sie ausschließlich in Superlativen über ihn gesprochen. Ein faszinierender Mensch, wie sie sagte. Jetzt verstehe ich sehr gut, was sie meinte. Kostas‘ Augen haben einen milden, geheimnisvollen Blick, der tief in die Seele der Menschen zu blicken imstande scheint. Als er mir nun sein Alter verrät, entsinne ich mich wieder, dass ich noch dieses kleine Präsent für ihn bei mir trage.
»Bevor ich es vergesse Kosta, ich habe ein kleines Mitbringsel für dich. Direkt von der Seifensiederin von Methana. Eine Seife mit Heilwasser aus dem Vulkan.«
Ich reiche ihm die nett verpackten Seifenstücke, und seine Augen scheinen zu leuchten. Ein Blick, der Dankbarkeit von ganzem Herzen ausdrückt. Dann gibt er ein Zeichen, dass wir nun zu seiner Kirche hinübergehen sollen. Nun komme ich also das zweite Mal in den Genuss des Anblicks dieses Meisterwerkes. Ich muss zugeben, dass ich beim ersten Kurzbesuch zweifelnd war, was ich von ihr halten sollte. Allerdings wusste ich damals auch noch nichts über die Ágia Fotiní. Anschließend hatte ich aus Neugierde in einem vielseitigen Aufsatz gelesen, dass das Bauwerk zwischen Meisterwerk verehrt oder bis hin zu absolutem Blödsinn verachtet wird. Und weiter las ich, dass es aber in jeder Einschätzung als ein »lebendes Gebäude« beschrieben würde. Egal von wem betrachtet, die Eindrücke seien immer individuell unterschiedlich.1
Bei meiner heutigen Wiederkehr wird mir bereits von außen klar, dass es sich hier tatsächlich um etwas Besonderes handelt. Vielleicht liegt es an der künstlerischen Vielfalt ihres Erbauers: Kostas hat Architektur, unter anderem in Berlin und Aachen studiert, er ist darüber hinaus Bildhauer, Zeichner und leidenschaftlicher Ikonenmaler.
»Die Idee für dieses Bauwerk ist 1969 entstanden.« Kostas deutet mit seiner Hand einen Kreis und zeigt dann in Richtung der Stadt. Damals gab es einen Zusammenschluss von sieben Dörfern der Region Mantineía, eine Art Verein, der sich zum Ziel gesetzt hatte, eine Kirche zu errichten. Und ausgerechnet Kostas hatten sie auserkoren und gebeten, die Arbeiten zu leiten. Kostas war zur damaligen Zeit Mitarbeiter des Kulturministeriums in Athen. Für den Bau der Kirche standen so gut wie keine finanziellen Mittel zur Verfügung, doch es war auch die Zeit der Militärdiktatur, und Kostas nutzte die Gelegenheit, dem Ministerium den Rücken zu kehren. Er war ohnehin vom ersten Augenblick an überzeugt davon, dass der besondere Ort, an dem die Kirche entstehen sollte, absolut zu seiner Idee passen würde. Ein Ort der göttlichen Liebe braucht keinen Luxus und Protz. Vielmehr geht es ihm darum, wie die Menschen Gott wirklich sehen.
»Die Bauarbeiten begannen im Jahr 1971. Bis 1973 schufen wir das Haupthaus. Ab 1974 [in diesem Jahr endete die Militärdiktatur] folgte der Innenausbau und später folgten Erweiterungsarbeiten.« Kostas blickt plötzlich, als hätte er spontan weitere Ideen für einen nächsten Anbau entwickelt. Er sprüht vor Elan.
»Das griechische Wort für Deutschland, Germanía, Ger-Mania, bedeutet so viel wie ‚Manie für Gott‘!« Kostas sieht mich an. »Wusstest du das?« Dann ergänzt er, ohne meine Antwort abzuwarten: »Auch Deutschland ist abgeleitet von Deus-Land, das Land Gottes!« Kurze Pause. Dann: »Lass uns reingehen, ich will dir was zeigen!«
Auf dem Weg zum Haupteingang lässt Kostas den Blick über die Weite der Hochebene schweifen.
»Weißt du, für mich war es der Traum meines Lebens. Als ich damals diese Gegend hier sah, da wusste ich gleich, es ist der bestmögliche Ort. Die Gegend und die Menschen waren sehr arm, bescheiden und auch ein bisschen naiv. Und diese Naivität wollte ich in das bescheidene Bauwerk übertragen. Ich habe den Auftraggebern damals gesagt, wir brauchen keine herkömmliche Kirche, aber ein Bauwerk, das der Gegend und seiner Geschichte entspricht.«
Gut sechs Monate hatte er in einem kleinen Zelt direkt auf der Baustelle gelebt, tagein tagaus gearbeitet, geschuftet, teilweise selbständig in der benachbarten Stadt Trípolis nach Baumaterial gesucht. Er sammelte Steine und Bauschutt, hatte an Mauerwerken gemeißelt und Marmor zusammengetragen, um gemeinsam mit einfachen, ungelernten Arbeitern ein Monument für die Ewigkeit zu schaffen. Die Einheimischen hielten ihn zunächst für einen seltsamen Menschen, den man nur arbeitend zu Gesicht bekam. »Das Gespenst von Archaía Mantineía« nannten sie ihn. Doch als das Bauwerk aus den zusammengeklaubten Materialien Schritt für Schritt Gestalt annahm, wurde Kostas‘ Genialität sicht- und greifbar.
»Die Arbeiten waren mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden, und wir brauchten Gottes Hilfe, um das zu vollbringen.« Kostas blickt in den Himmel und fährt fort.
»Gott ist das Licht. Und die Ágia Fotiní sollte Namensgeberin meiner Kirche werden.«
Die Photiná, die »Erleuchtete«, soll nach der griechischen Überlieferung die Samariterin gewesen sein, der Jesus am Jakobsbrunnen begegnete. Sie wird bis heute als große Heilige verehrt.
»Meine Ágia Fotiní sollte ein Symbol dafür werden, wie wir Gott richtig erleben. Ich wollte die Welt symbolisieren, wie sie ist, und nicht nur die christliche, aber natürlich mit Anspielungen.«
Beides hat er damals miteinander verbunden, in einem kirchlichen Bauwerk, das bis heute von der offiziellen Kirche nicht vollumfänglich anerkannt wird. Der Betreiber der Kirche ist nach wie vor der ursprüngliche Verein. Die echte und die kirchliche Welt sind nicht immer passgenau. Und eines ist dem Architekten wichtig:
»Um den Menschen zu lieben, müssen wir zuerst Gott lieben.« Beides gehöre eben zusammen, meint Kostas. Philanthropisch bedürfe die Menschenliebe auch die Liebe zu Gott. Somit wird seine Architektur zu Theologie.
Als wir im Eingangsbereich der kleinen Kirche stehen, kommt mir der Anblick anders vor als bei meinem letzten Besuch. Als verändere sich die Kirche mit der Zeit.
»Wenn man die Kirche betritt, wird man mit der Auferstehung konfrontiert.« Kostas zeigt auf Fresken, Ikonen und architektonische Elemente. Er deutet in atemberaubendem Tempo auf immer neue Kleinigkeiten, die mir allein nicht aufgefallen wären. Ein absichtlich schiefes Kreuz etwa, dass den einschlafenden Jesus symbolisieren soll. Einem dreigestreiften christlichen Symbol, das Hirn, Herz und Seele symbolisiert, hat er einen vierten Streifen hinzugefügt – Gott! Damit es vollständig wird, wie er sagt.
»Jedes Teil hier hat seine Bedeutung, jedes noch so unscheinbare.« Es kommt mir vor, als sei alles in Bewegung.
»Genau!« Kostas strahlt und erläutert: Das griechische Wort für Gott, ο Θεός (o Theós), ist aus dem altgriechischen Verb θέω (théo) abgeleitet, das »bewegen, laufen, rennen« bedeutet. Alles ist also in Bewegung. Und in der Ágia Fotiní verbinden sich Elemente aus dem antiken Griechenland mit dem christlichen Weltbild. So wird die Liebe Gottes zu den Menschen weit über dieses Gotteshaus hinaus bis in das weltliche Leben verteilt. Und Kostas schweift plötzlich kurz ab.
»Ich war einmal in Bayern. Irgendwo im Nirgendwo gab es eine kleine Kirche. Ich trat ein. Wie aus dem Nichts spielte in diesem kargen Haus plötzlich eine Frau auf der Orgel. Ich habe mich sofort verliebt in diese Situation. Weißt du, was der Morgentau symbolisiert?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Gott wischt damit unsere Sünden weg.«
Und schon kommt er auf ein besonderes griechisches Wort zu sprechen: Aretí. Es ist ebenso ein weiblicher Vorname, wie auch die Liebe zur Tugend und der Wahrheit. Kostas ergänzt es so: Gott zu lieben, bedeutet alle Menschen zu lieben. Das ist auch die Bedeutung des Wortes Aretí. In der Ágia Fotiní stößt man förmlich an jeder Stelle auf ein Symbol der Liebe, der Nächstenliebe, der Menschlichkeit. Kostas zeigt auf ein Wellensymbol an der Wand.
»Sie stehen für Gott. Für Jesus auf dem See Genezareth. Du siehst, alles hier hat eine tiefere Bedeutung.«
Dann blickt Kostas für einen kurzen Moment traurig in Richtung Altar. Die offizielle Kirche hielt seine Ikonen für unheilig, wie er nun berichtet. Dabei benutze er überall christliche Symbole. Und immerhin habe bereits der Apostel Paulus Freiheit gefordert und Jesus wollte uns die Freiheit Christus bringen. Deshalb müssten die Kirchen, davon ist Kostas überzeugt, auch Ausdruck und Ausstellung unserer Menschlichkeit und Kultur sein.
»Weißt du, warum die Ikonen hier aus Beton sind?«
»Erzähl du es mir, üblicherweise sind sie auf Holz, oder?«
»Ja genau! Anfangs habe ich sie auch so für diese Kirche gemalt, auf Holz. Doch dann wurden einige von ihnen gestohlen. Also habe ich auf schwerem Beton gemalt.«
Kostas ist pragmatisch, er glaubt zwar an das Gute im Menschen, aber er findet auch Wege gegen die Tugendlosen.
Nachdem wir schon eine Weile durch die Ágia Fotiní gewandelt sind, erscheint plötzlich Julia. Kostas ist außer sich vor Freude, er strahlt über beide Wangen. Er drückt sie lange an seine Brust, wie ein Großvater seine Enkelin.
»Schön, dass du es auch noch geschafft hast!«, sagt er.
Die Szenerie bietet ein schönes Beispiel dafür, was Kostas meinte, als er vorher zu mir gesagt hatte:
»Kirche muss eins sein: Das wahre und das christliche Leben vereint. So, wie es das menschliche und das göttliche Leben gibt.« Und dann folgt ein interessanter Vergleich: Es gab den Gott Eros. Aus ihm entwickelte sich Érotas, und daraus wird Agápi. Ich beschließe, mich später mit den unterschiedlichen Begrifflichkeiten für Liebe noch einmal ausführlicher auseinander zu setzen, denn schon schlägt Kostas vor, nach draußen zu gehen. Er ist genau wie sein Bauwerk immer in Bewegung.
»Nachdem wir die Kirche fertig gestellt hatten, haben wir auch außen noch Erweiterungen vorgenommen. Kommt, ich zeige euch was!«
Kostas führt uns nun von einem Erweiterungsbau zum nächsten. Vorbei am Heroon, wie in der griechisch-römischen Architektur ein Heiligtum oder Grabdenkmal bezeichnet wird, hin zu einem Miniaturnachbau eines antiken Theaters mit einer Bühne aus weißem Marmor. Das Theater des Lebens mit all seinen Fehlern und Leiden.
»Wenn du im Zuschauerraum sitzt, willst du sehen, was passiert. Wir schauen also auf die Bühne, auf das Herz des Theaters, und wir schauen somit auf das Leben!« Kurze Pause, dann ergänzt Kostas:
»Ich glaube übrigens nicht, dass Menschen sterben. Sie wechseln den Körper.«
Vom Theater geht es weiter zum Jakobsbrunnen. Der Baumeister erklärt dabei die Bedeutungen kleinster architektonischer Unscheinbarkeiten und größerer Symbole. Diese Kirche mit ihren dazugehörigen Nebengebäuden ist zwar greifbar, aber unfassbar. Jeder Schritt, jede Bewegung lässt sie wie ein Herz pulsieren. Und ganz plötzlich steht, wie aus dem Nichts, eine hübsche Frau neben uns. Ich schätze sie auf Mitte 40. Kostas steht nun aufgerichtet an seinen Krücken. Er zupft das Kräutersträußchen in seinem Knopfloch zurecht.
»Kostas, erkennst du mich noch? Es ist so lange her. Wir haben uns ewig nicht gesehen.«, sagt die blonde Griechin und scheint etwas nervös auf die Antwort zu warten.
»Aber natürlich erkenne ich dich, du hast dich kaum verändert, aber früher warst du brünett. Lass dich drücken!« Und so nehmen sich die beiden gefühlt minutenlang in den Arm, ehe Kostas zu der Frau sagt:
»Ich war unhöflich, ich habe dir noch gar nicht meinen Besuch vorgestellt!« Kostas erklärt ihr, was es mit meiner Anwesenheit auf sich hat.
Als hätten die beiden Zeit und Raum vergessen, wendet sich die blonde Frau nun etwas verwirrt an mich und stellt sich vor, während Kostas offenbar gut zuhört. Den Rest unseres Rundgangs verbringen wir nun zu viert, während der Architekt die Frau immer wieder beim Vornamen nennt. Ich kann nicht in ihn hineinschauen und ich frage auch nicht danach, aber es kommt mir so vor, als ob Kostas ein kleines bisschen verliebt in Richtung der blonden Frau schaut. Ganz sicher ist jedoch, dass seine große Liebe die Ágia Fotiní ist.
»Sie ist mein Lebenswerk«, hatte er zuvor gesagt, und dass er sie liebe, wie seine eigenen Kinder.
Am Ende unserer Privatführung schlägt Kostas plötzlich vor, noch gemeinsam etwas essen zu gehen.
»Ganz in der Nähe, nur wenige Kilometer entfernt, hat kürzlich eine Taverne eröffnet. Lasst uns dort hinfahren!«, sagt er. Unsere reizende neue Freundin kann jedoch nicht länger bleiben, sie muss nach Hause. Zum Abschied nehmen sich die beiden alten Bekannten noch einmal wie allerbeste Freunde in die Arme. Ich bin gerührt und Kostas fragt abschließend nach ihrer Telefonnummer. Er sei nicht sicher, ob er sie noch habe. Der kleine Zettel mit ihren Kontakten wandert schnell in seine Umhängetasche und sie ruft ihm im Weggehen noch fragend zu:
»Sehen wir uns beim Arzt?«
Vermutlich. Zusammen sind sie weit über 120 Jahre alt.
Wenig später betreten wir ohne die blonde Frau die Dorftaverne. Kostas begrüßt den höchstens 20 Jahre alten Kellner freudestrahlend. Die beiden bringen Leben und Liebe in diese einsame Gegend. Es wird bereits dunkel, als wir uns setzen. Der liebenswerte Architekt blickt etwas wehmütig, als wir ihm sagen, dass wir nicht mehr lange bleiben und nur etwas mit ihm trinken können. Ein gemeinsames Abendessen muss leider ausfallen. Aber auch so wird die gute Stunde in der Taverne ein besonderes Erlebnis, denn Kostas ist in Plauderlaune. Er hat viel erlebt in den vergangenen 85 Jahren. Ende der 1950er Jahre studierte er in Berlin Architektur. Er unternahm gerne Ausflüge in den Ostteil der Stadt. Einmal hat in die Volkspolizei der DDR verhört. Er blieb auch unter Druck ehrlich: Er glaube nicht, dass es richtig sei, ein Volk zu teilen und voneinander zu trennen.
»Eines Tages werdet ihr wieder vereint sein.«
Wie schön, dass er auch damit Recht behielt. Und wo wir schon über historische Ereignisse reden, kommen wir auch gleich noch einmal auf die Diótima zu sprechen. Sie definierte den Begriff der Liebe als »eine Geburt des Schönen, in geistiger und körperlicher Hinsicht.«
Auch auf die Ágia Fotiní passt diese Definition hervorragend. Und wenn Kirche Liebe ist, dann ist diese Kirche Agápi und Érotas unter einem Dach.
Ich glaube, ich habe heute sowohl Érotas als auch Agápi leibhaftig erlebt. Dank Kostas war dieser Spaziergang durch sein Lebenswerk ein unvergessliches Erlebnis.
Als ich abends noch einmal auf die Begrifflichkeiten von Agápi und Érotas eingehen möchte und im Internet recherchiere, finde ich einen interessanten Text, der sich mit der kirchlichen Liebe beschäftigt.2 Ein Blick auf diese theologischen Erörterungen ist gerade vor dem Hintergrund der Ágia Fotiní spannend: Agápi und Érotas sind unbedingt voneinander zu unterscheiden. In der Bibel gibt es für die Begrifflichkeiten der Liebe das Wort Agape (biblisch für Agápi) und Philia (Filia, wie unser Verein!). Das Wort Eros oder Érotas hingegen taucht an keiner Stelle auf, und dass, obwohl das Neue Testament ursprünglich auf Griechisch verfasst wurde. Und auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments gibt es nur die Agape als das, was wir mit wahrer Liebe beschreiben, die nicht haben, sondern geben will, und die Philia als eine tiefe gegenseitige freundschaftliche Liebe. Im selben Text wird Eros (Érotas) nach Platon als etwas beschrieben, das »nach den idealen Vorstellungen, den Ideen hinter dem Schönen und Begehrenswerten« strebt. Aus Sicht der Kirche wird in diesem Sinne das geliebte Gegenüber zum Objekt gemacht, was sich mit der wahren Liebe Agápi nicht vertragen würde. Das würde auch erklären, warum die orthodoxe Kirche ein Problem mit der Ágia Fotiní hat: denn hier leben Agápi, Philía und Érotas unter einem Dach.
Oster-Hefezopf (»Tsouréki«)
Τσουρέκι
Den süßen Hefezopf mit dem unverkennbaren Geschmack, kennt in Griechenland jedes Kind. Besonders zum griechisch-orthodoxen Osterfest wird er überall gebacken. Tsouréki gibt es heutzutage jedoch nicht nur zum Frühjahrsfest, sondern das ganze Jahr über zu kaufen.
Zutaten:
900 g Mehl, 200 g Zucker, 125 ml lauwarme Milch, 125 g geschmolzene Butter, 100 ml lauwarmes Wasser, 4 Eier, 1 Orange, ½ EL Vanilleextrakt, 1 EL Mahlepi, 10 g Mastix (ca. 1- 2 Harzkügelchen), 14 g Trockenhefe, 1 Prise Salz, optional ½ TL Kardamom
Zum Bestreichen der Zöpfe vor dem Backen: 1 Ei, 2 EL Wasser, 2 EL Mandelblättchen, wahlweise 2 EL Sesam
Zubereitung:
In einer kleinen Schüssel die Milch lauwarm erhitzen, ½ TL Zucker und die Hefe dazugeben. Gut vermischen und ca. 15 Minuten stehen lassen, bis es zu schäumen beginnt. Parallel bereiten wir den Teig vor. Dafür geben wir das Mehl, den restlichen Zucker, das Salz, das Mahlepi und den Mastix in eine Schüssel und vermischen alles gut miteinander. In die Mitte drücken wir eine Mulde und geben die Milch-Hefemischung, die geschmolzene Butter, die Eier und den Abrieb der Orangenschale hinzu. In der Küchenmaschine oder von Hand zu einem glatten Teig kneten. Den Teig anschließend zugedeckt an einem warmen Ort etwa 1- 2 Stunden gehen lassen. Er sollte sich etwa verdoppelt haben. Den Teig anschließend in drei gleich große Stücke teilen. Aus den drei Stücken jeweils lange Rollen formen und diese drei zu einem Zopf flechten.
Den Tsouréki-Zopf geben wir nun auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und bestreichen ihn mit etwas Milch bestreuen und ihn mit den gehackten Mandeln und/oder dem Sesam bestreuen. Im vorgeheizten Ofen wird der Zopf nun bei 180 °C etwa 25-30 Minuten gebacken, bis er goldbraun ist. Anschließend lassen wir das Tsouréki auf einem Gitter abkühlen. Fertig!
Tipp:
Wer geschickt ist beim Backen, kann sich auch an einer gefüllten Variante versuchen. Dazu eine Schokolademasse vor dem Backen in den Teig geben.
Eine häufige Variante ist auch das schokoummantelte Tsouréki. Dazu wird das Tsouréki nach dem Backen rundum mit einer im Wasserbad erwärmten Schokoladen-Butter-Masse übergossen. Viel Spaß beim Ausprobieren!
2
DER KÄSESCHMELZER AUS KAYSERI
Ein Bougátsa-Baby mit Guinness-Rekord in Thessaloniki
»Το σ’ αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί
μες στην καρδιά να μπει να τη ζεστάνει«
Liedzeilen aus »Το σ΄ αγαπώ μπορεί«
von Dímitra Galáni, 2004
»Die Liebe kann, nur sie kann
ins Herz gehen, um es zu erwärmen.«
K ennt ihr Bougátsa? Sie ist wie das Croissant in Frankreich, wie das Wurstbrot in Deutschland, der Frühstückssnack der Griechen, der nicht fehlen darf. Geschichtsträchtig und allgegenwärtig. Aber es gibt regionale Unterschiede. Während in Athen und den südlichen Landesteilen die Tirópita, eine mit Schafskäse gefüllte Blätterteigtasche der Klassiker ist, ist in Thessaloniki und den nördlichen Regionen die Bougátsa-Krema, eine Blätterteigpastete mit Cremefüllung, das absolute Original. Warum ist das so? Dafür reisen wir ein kleines Stück in die griechische Geschichte, und ich reise nach Thessaloniki.
Kleinasien um 1899. Opa Bandís steht in einer kleinen Bäckerei in Casarea, dem heutigen Kayseri in Kappadokien, in der er als angestellter Bäcker jeden Morgen die frische Bougátsa backt. In der Zentral-Ost-Anatolischen Region Kappadokien lebten seit der Antike kontinuierlich Griechen, die so genannten griechischen Kappadokier. Von ihnen stammt auch Filippos Bandís ab, der heute noch eine kleine Bougátsa-Bäckerei in Thessaloniki betreibt. Doch zurück zu seinem Opa, der ebenso den Vornamen Filippos trug: Er lebte seit seiner Geburt in der heute zur Türkei gehörigen Region Kappadokien, die zwischen den Städten Ankara und Gaziantep im Landesinneren liegt und ländlich geprägt war. Um 1300 v. Chr. errichteten mykenische Griechen Handelsposten entlang der Küsten und kolonialisierten die gesamte Region. So verbreitete sich die griechische Sprache und Kultur, die sich nach der Eroberung Anatoliens durch Alexander den Großen auch bis in die Bergregionen Kappadokiens erstreckte. Immer mehr griechische Siedlungen entstanden. Über viele Jahrhunderte war und blieb die Gegend griechischsprachig und christlich. Erst im 11. Jahrhundert eroberten schließlich seldschukische Türken aus Zentralasien die Gegend und begannen einen langwierigen Wandel in Sprache und Religion. Das byzantinische Kleinasien wurde von einer überwiegend griechisch bevölkerten Region zu einer muslimisch-türkischen, und viele Christen konvertierten zum Islam. Die Seldschuken bauten wenige Städte zu ihren Zentren aus, insbesondere Karaman, Konya und Kayseri. Die osmanischen Türken eroberten im Laufe des 15. Jahrhunderts Kappadokien von den Seldschuken und turkifizierten die nach wie vor von vielen Griechen besiedelte Region. Diese mussten die türkische Sprache akzeptieren, was ihnen die Bezeichnung Karamanlides einbrachte – diejenigen, die sich dem türkischen Häuptling Karaman unterwarfen. Die in den abgelegeneren Dörfern lebenden kappadokischen Griechen hingegen blieben viele Jahre vom türkischen Einfluss kaum berührt und behielten lange Zeit ihre Sprache und Kultur. Allein in den Städten Konya und Kayseri lebten zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch rund 100.000 Griechen, davon allein knapp 27.000 in Casarea, dem heutigen Kayseri. Die griechischen Kappadokier waren berühmt für ihre Handelsaktivitäten und man sagte, es gebe nur wenige Städte, in denen kein Kaufmann aus Kayseri zu finden sei. Einer dieser war Opa Bandís. Zwar kein Kaufmann im herkömmlichen Sinne, aber er verkaufte seine Backwaren. Im Jahr 1927 betrug die Gesamtbevölkerung Kayseris knapp 40.000, darunter kaum noch Griechen. Was war geschehen?
Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges nahm das Schicksal der Griechen Anatoliens seinen Lauf. Während des Krieges wurden »etwa 750.000 anatolische Griechen (…) in einem Völkermord massakriert und 750.000 verbannt«. Einem türkischen Beamten namens Rafet Bey, der an dem Völkermord beteiligt war, wird das folgende Zitat zugesprochen. Er soll im November 1916 erklärte haben: »Wir müssen die Griechen erledigen, wie wir es mit den Armeniern getan haben.«
Im so genannten Griechisch-Türkischen Krieg der Jahre 1919– 1922 deportierten die Türken unzählige Griechen in die mesopotamische Wüste, wo viele von ihnen umkamen. Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde im Lausanner Friedensvertrag ein Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei vereinbart. Die überlebenden und verbliebenen kappadokischen Griechen wurden in der Folge im Jahr 1924 nach Griechenland ausgewiesen.3 Der Bevölkerungsaustausch umfasste insgesamt fast 2 Millionen Griechen und Türken, die in die eine oder andere Richtung zwangsmigriert wurden. Opa Bandís war einer von ihnen. Ihn zog es bereits 1922 auf der Flucht vor Krieg und Vertreibung ins sichere Thessaloniki. Seine Heimat Kayseri musste er verlassen, doch nicht, ohne etwas ganz Besonderes im Gepäck zu haben.
Diese spätere türkische Redewendung über die Kayserianer fand ich im Internet:
»Kayserililer kurnaz, cimri, paragöz, pinti ve uyanık olurlar. Annesini boyayıp, babasına satarlar.«
»Die Leute aus Kayseri sind schlau, geizig, geldgierig, knauserig und gewieft. Sie würden ihre eigene Mutter anmalen und an den eigenen Vater verkaufen.«4
Auf den griechischen Kayserianer Bandís trifft nur schlau und gewieft zu, denn er brachte das original griechisch-kappadokische Rezept für echte Bougátsa mit nach Thessaloniki. Seinem Enkel Filippos erzählte er später, dass diese Bougátsa tatsächlich in Kayseri erfunden wurde. Ursprünglich als ungefüllte Teigtasche, die die Bauern als Proviant mit aufs Feld und zur Arbeit nahmen. Teigtaschen gibt es seit Ewigkeiten auf der ganzen Welt. In China als Dim Sum, als Empanadas für die Pilger auf dem Jakobsweg oder die Gyoza in Japan. In einem Artikel über das Buch »Teigtaschen: Eine Reise zu den besten Rezepten der Welt« fand ich folgende interessante Geschichte:
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: