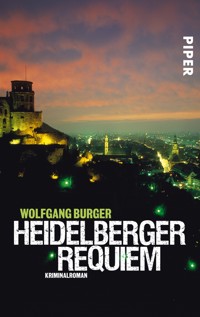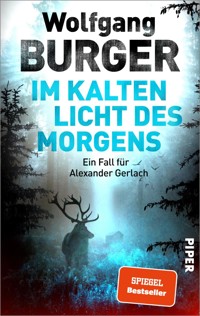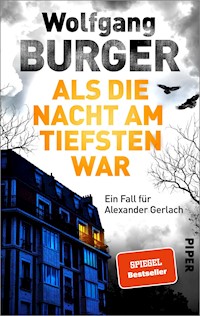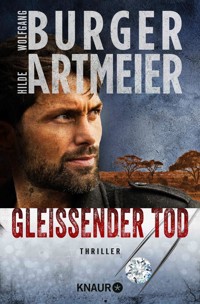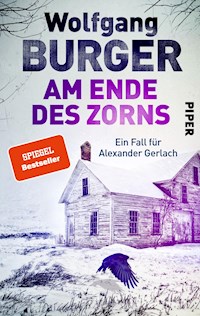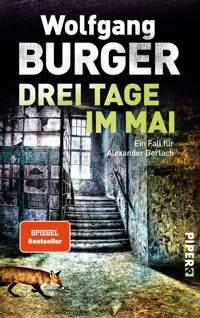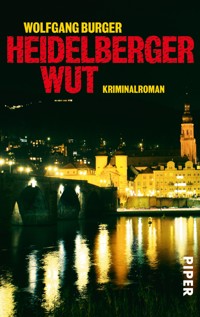
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als der eigenbrötlerische Seligmann von seiner Nachbarin als vermisst gemeldet wird, hat Kriminalrat Gerlach gerade ganz andere Sorgen, hat er doch einen noch immer unaufgeklärten Bankraub auf dem Tisch. Aber als man im Haus des Vermissten Blutspuren entdeckt, wird Gerlach hellhörig. Gibt es eine Verbindungslinie zu dem Bankraub? Und welche Rolle spielte Seligmann bei der brutalen Vergewaltigung einer Schülerin vor einigen Jahren? Kein Wunder, dass bei all diesen Geschehnissen auch Gerlachs Privatleben wieder einmal Kopf steht – gerade jetzt, wo die pubertierenden Zwillinge eigentlich seine Aufmerksamkeit dringend benötigen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Charlotte
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
ISBN 978-3-492-95459-4 Mai 2017
Deutschsprachige Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2007
Umschlag: semper smile, München
Umschlagmotiv: mauritius images / CuboImages
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
1
Noch eine Minute.
In sechzig Sekunden wird einer der beiden Männer dort drüben tot sein. Und ich soll entscheiden, welcher. Da stehen sie am Fenster, jenseits der breiten Straße, die seit einer Weile gesperrt ist und ganz menschenleer und totenstill.
Der schwarz vermummte Scharfschütze kniet vor mir und ist die Ruhe selbst. Sein schweres Präzisionsgewehr hat er auf der Fensterbank aufgelegt. Verschmolzen mit seiner Waffe, ein verlässlicher Handwerker des Todes. Balke, bleich wie noch nie, sieht fassungslos mit halb offenem Mund abwechselnd zu mir und auf dieses offene Fenster jenseits der Straße. Klara Vangelis, die sonst gar nichts umwirft, hat sich abgewandt, kann nicht mehr hinsehen. Und Seligmann, dieser Idiot, er hat mir das eingebrockt. Der Mann, der so viele Menschen ins Unglück gebracht hat. Er oder der Zahnarzt, dessen Namen ich mir einfach nicht merken kann, einer von beiden soll nun also sterben.
In spätestens fünfzig Sekunden.
»Chef!«, flüstert Balke mahnend, als hätte er Sorge, ich hätte stehend das Bewusstsein verloren. »Chef!«
Die Gewehrmündung bewegt sich kaum merklich und unendlich langsam ein klein wenig nach rechts.
Aber ich kann das doch nicht! Ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Ich bin Polizist. Meine Aufgabe ist es, Menschen zu beschützen, Leben zu retten und nicht, über ihren Tod zu bestimmen. Ausgerechnet jetzt fällt mir der Moment ein, als ich den Namen Seligmann zum ersten Mal hörte und natürlich nicht ahnte, was auf mich zukam. Wann? Vor drei Wochen? Vor vier? Eines weiß ich noch, es war an einem Freitag. Und plötzlich ist diese Wut da. Diese alles vernichten wollende, gnadenlose Wut, die meine Zähne ganz von alleine knirschen lässt. Sollen sie doch alle beide verrecken dort drüben! Was geht es mich an?
»Noch zwanzig Sekunden«, sagt Balke leise.
Diese Wut, die mich in der nächsten Sekunde zum Platzen bringen wird.
Wut auf wen?
Ja, auf wen eigentlich?
Ich hatte es eilig an jenem Freitag, daran erinnere ich mich noch gut. Es war schon später Nachmittag, und ich kam von einer nervtötend langen Besprechung mit der Staatsanwaltschaft, wo man dringend auf irgendwelche Akten und Ermittlungsergebnisse meiner Leute wartete, denn nächsten Mittwoch sollte die Hauptverhandlung beginnen. Außerdem waren die Herrschaften natürlich nicht begeistert, dass wir den Bankraub mit Geiselnahme noch immer nicht aufgeklärt hatten, der jetzt schon vier Wochen zurücklag. Immerhin gab es hier eine erste kleine Spur.
Ich hetzte die lichten Treppen der Polizeidirektion hinauf zum zweiten Stock, zur Chefetage, wo auch mein Büro lag. Um fünf, in zwei Minuten, hatte ich einen Termin bei Polizeidirektor Liebekind, meinem Vorgesetzten. Der schätzte es nicht, wenn man ihn warten ließ, und ich hatte meine ganz speziellen Gründe, ihn bei Laune zu halten.
Ein schlanker junger Mann kam mir entgegen. Er trug eine derbe Lederjacke, die nicht recht zu seinem schmalen Gesicht passen wollte, und einen schwarzen Motorradhelm unterm Arm. Unsicher sah er mir ins Gesicht, als wäre er sich unschlüssig, ob er es wagen durfte, mich anzusprechen. Sein Alter schätzte ich auf Mitte zwanzig, intelligente, wache Augen und weiches, langes Haar – meine Töchter wären entzückt gewesen.
Mein Gefühl täuschte mich nicht.
»Sind Sie nicht von der Kripo?«, fragte er, als ich an ihm vorbeiwollte. »Ich kenn Sie aus dem Fernsehen.«
»Ja«, keuchte ich, vom Laufen ein wenig außer Atem.
»Hätten Sie vielleicht ein paar Sekunden Zeit für mich?«
»Nein«, sagte ich und blieb stehen. »Ja, wenn es wirklich nur ein paar Sekunden sind. Worum geht’s denn?«
»Um meine Mutter.« Er sprach mit angenehm leiser Stimme, senkte den Blick, spielte mit zartgliedrigen Fingern an seinem furchterregenden Helm mit dunklem Visier herum, der zu ihm passte wie ein Hammer in ein Nähkästchen. »Bitte verzeihen Sie, dass ich Sie aufhalte. Aber sonst will ja hier keiner mit mir reden.«
»Aber machen Sie es bitte kurz.«
Aus irgendeinem Grund mochte ich den ratlosen Kerl. Ich war Vater zweier Töchter, und für weitere Kinder war es mit meinen vierundvierzig Jahren schon ein bisschen spät. Aber wenn ich jemals noch einen Sohn haben sollte, dann bitte einen wie diesen hier. Wäre es anders gewesen, ich hätte ihn vermutlich stehen lassen. Jemand ging in meinem Rücken die Treppe hinunter, grüßte und wünschte mir ein schönes Wochenende. Ich grüßte zurück, ohne hinzusehen.
»Was ist mit Ihrer Mutter? Steckt sie in Schwierigkeiten?«
»Nicht wirklich«, erwiderte der junge Mann ernst und sah mir endlich ins Gesicht. Seine Augen waren dunkel, die Wimpern ungewöhnlich lang, der Blick verzagt. »Es ist wegen unserem Nachbar. Sie macht sich solche Sorgen um ihn.«
»Warum?«
»Er ist verschwunden. Und Mom ist total durch den Wind deswegen. Ich hab ihr gesagt, dann ruf doch die Polizei an, sollen die sich drum kümmern. Aber sie traut sich nicht. Und da hab ich gedacht, bevor sie mir noch völlig durchdreht, mach ich’s eben.« Er schluckte. »Ich meine, wenn einer auf einmal spurlos verschwunden ist, dann sind Sie ja wohl zuständig, oder nicht?«
Ich sah auf die Uhr. Noch eine Minute. Ich hatte keine Ahnung, was Liebekind von mir wollte. Aber wenn er mich zu so unchristlicher Zeit zu sich bestellte, dann war es wohl wichtig.
»Seit wann ist Ihr Nachbar denn weg?«, fragte ich ungeduldig.
»Seligmann heißt er. Seit zwei oder drei Tagen. Genau weiß Mom es auch nicht. Bestimmt ist er bloß verreist, mal ein bisschen weggefahren, hab ich ihr schon tausendmal erklärt. Er ist ja alt genug, er ist nämlich schon Rentner. Aber Mom ist völlig aufgelöst, weil er ihr nichts gesagt hat.«
»Ist er denn gesund?« Ich tippte mir an die Schläfe. »Hier?«
Mein Gegenüber schenkte mit ein Lächeln, bei dem meinen Töchtern die Luft weggeblieben wäre. »Er ist nicht verrückt oder so was. Ein komischer Vogel, okay. Aber er weiß, wer er ist und wo er ist.«
»Aber warum ist Ihre Mutter dann so beunruhigt?«
»Tja, wenn ich das wüsste.« Betreten senkte er den Blick. Zuckte die Achseln. »Sonst sagt er eben immer Bescheid, wenn er mal länger wegbleibt. Er hat Haustiere, irgendwelche Amphibien, Spinnen, solches Zeug, und Mom versorgt die dann normalerweise. Aber diesmal hat er ihr nichts gesagt.«
Nun hatte ich wirklich keine Zeit mehr.
»Hat jemand in der Nachbarschaft einen Schlüssel zu Herrn Seligmanns Haus?«
»Mom hat einen. Meinen Sie denn, sie dürfte mal reingucken? Auch wenn er sie nicht drum gebeten hat? Das würde sie bestimmt beruhigen.«
»Sagen Sie Ihrer Mutter, sie soll ruhig in das Haus gehen und nach den Tieren sehen. Und falls Ihr Nachbar später Ärger macht, dann soll er sich an mich wenden.«
»Danke.« Der junge Mann wirkte sehr erleichtert. »Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mom wird bestimmt froh sein.«
Ich nickte ihm zu und wandte mich zum Gehen.
»Wie ist eigentlich Ihr Name?«, rief er mir nach. »Und warum sieht man Sie im Fernsehen?«
»Gerlach«, erwiderte ich über die Schulter. »Ich bin hier der Kripo-Chef.«
Als er ging, bemerkte ich, dass er das eine Bein ein wenig nachzog.
2
Auch Liebekind machte sich Sorgen, ich sah es auf den ersten Blick. Beim letzten Glockenschlag der nicht weit entfernten Lutherkirche hatte ich an seine Tür geklopft.
»Dieser leidige Fall Melanie Seifert«, stöhnte er, als ich vor seinem ausladenden Schreibtisch aus dunklem Holz Platz nahm, der mich immer an einen Beichtstuhl denken ließ. Vielleicht, weil ich nun schon seit Monaten mit seiner Frau schlief und ständig fürchtete, er könnte dahinterkommen. Wie üblich drehte mein Chef zwischen Zeige- und Mittelfinger eine seiner heiligen Zigarren, die er niemals ansteckte, sondern lediglich mit verzückter Miene betrachtete und hie und da ein wenig beschnüffelte. »Die Presse gibt einfach keine Ruhe deswegen.«
»Was sollen wir machen?« Offenbar ging es auch heute nicht um Theresa. Lautlos aufatmend lehnte ich mich in dem altmodischen, bequemen Stuhl zurück. »Die Staatsanwaltschaft hat die Akte geschlossen.«
Der Fall Seifert machte seit Tagen Schlagzeilen in einem bestimmten Teil der örtlichen Presse. Das fünfzehnjährige, ein wenig pummelige Mädchen war kurz vor Mitternacht auf dem Heimweg von einer gut gelungenen und sicherlich nicht ganz alkoholfreien Party gewesen. In der Straßenbahn kam sie mit einem etwa zehn Jahre älteren Mann ins Gespräch. Der hatte ihre Ausgelassenheit und blitzenden Augen falsch gedeutet, war mit Sicherheit auch nicht der Hellste, und am Ende hatte es ein wenig Geschrei gegeben. Zwei beherzte Fahrgäste waren eingeschritten, der Straßenbahnfahrer hatte unverzüglich über Funk die Polizei gerufen, und im Grunde war nichts passiert, was nicht jeden Tag tausend Mal irgendwo geschieht. Ein Mann versucht, an ein Mädchen heranzukommen, sie will nicht und weist ihn ab.
Selbstverständlich hatte der Kerl sich dabei ungewöhnlich dämlich angestellt, aber Melanie hatte sich zu wehren gewusst, und vermutlich wäre alles längst vergessen, hätte nicht ein eifriger Journalist eine Woche später herausgefunden, dass es sich bei dem Möchtegern-Casanova um einen vorbestraften Sexualstraftäter handelte.
Nun war das Geschrei groß. Der Täter hatte im Alter von neunzehn Jahren wegen eines minder schweren Delikts anderthalb Jahre auf Bewährung bekommen. Melanies Verehrer war dumm, das stand außer Zweifel, und er hatte sich gewiss nicht korrekt verhalten. Aber er hatte definitiv nicht versucht, ihr Gewalt anzutun. Der Mann arbeitete als Hilfskraft in der städtischen Gärtnerei und war dort als langsam, aber zuverlässig und harmlos bekannt. Leider hatte das Thema für bestimmte Menschen jedoch beträchtlichen Sex-Appeal. Unschuldige Mädchen, die von schlimmen Männern bedrängt werden, das verkaufte sich eben immer wieder gut.
»Vor allem dieser eine Schreiberling …?« Liebekind schob seine schwere Brille in die Stirn und kniff die Augen zu Schlitzen. »Wie hieß er? Eichendorff?«
Er sah eindeutig noch schlechter als ich, was mir eine kleine, gemeine Befriedigung verschaffte. Seit einem halben Jahr musste auch ich eine Brille tragen, und ich hasste das blöde Ding immer noch.
»Möricke. Jupp Möricke.«
Ärgerlich wedelte er mit einem dreispaltigen Zeitungsausschnitt. »Sie möchten es vermutlich nicht lesen?«
»Danke. Ich kann mir denken, was drinsteht.«
Wie konnten wir ein solches Monster frei herumlaufen lassen? Was musste noch alles geschehen, bis wir diesen Wüstling endlich in Sicherheitsverwahrung nahmen? Das waren die Fragen, die derzeit in Teilen der Presse, genauer im Kurpfalz-Kurier, eifrig diskutiert wurden.
Liebekind, ein Zweimeter-Riese mit silbernem Haarkranz auf dem schweren, runden Kopf, knallte den Artikel verächtlich auf einen seiner Papierstapel. »Mir ist zu Ohren gekommen, dieser Herr Möricke versuche, seine Geschichte ans Fernsehen zu verkaufen. Sollte sich ein Sender finden, der darauf einsteigt, dann helfe uns Gott. Und außerdem fängt er anscheinend an, andere ungelöste Fälle auszugraben.«
»Wir haben Mitte Juni. Die Saure-Gurken-Zeit steht vor der Tür.«
»Der Mann scheint einen regelrechten Krieg gegen uns anzuzetteln.« Mein Chef zeigte mir einen anderen Zeitungsausschnitt. »Das hier ist von gestern. Hier geht es um diesen Bankraub, der leider Gottes noch immer nicht aufgeklärt ist. Nicht eben ein Ruhmesblatt, Herr Gerlach.«
Polizeidirektor Doktor Egon Liebekind war dafür bekannt, seine Worte sorgfältig zu wählen. Diese bedeuteten einen Anschiss erster Klasse, das war mir klar. Dringend Zeit, ein paar Punkte zu machen.
»In der Sache gibt es einen ersten Erfolg. In Südspanien ist gestern ein Geldschein aus der Beute aufgetaucht.«
»Spanien? Wir hatten doch bisher gar keine Spur in diese Richtung?«
»Nein, das ist auch völlig neu. Möglicherweise verstecken sich die beiden Täter irgendwo in der Umgebung von Málaga und warten ab, bis sich hier die Aufregung gelegt hat. Die spanischen Kollegen sind bereits alarmiert. Früher oder später dürfte die nächste Banknote auftauchen.«
Achtsam legte Liebekind seinen überdimensionalen schwarzen Glimmstängel beiseite. Wir kamen noch kurz zu den Themen des Tages. Es waren erfreulich wenige. Abgesehen von dem schon erwähnten Banküberfall, der sich in Eppelheim ereignet hatte, einem westlichen Vorort Heidelbergs jenseits der Autobahn, stand nur der übliche Kleinkram auf meiner Liste. Deshalb beschäftigte sich ein Teil meiner Leute zurzeit damit, ungelöste alte Fälle wieder hervorzukramen und daraufhin zu überprüfen, ob sich eine Wiederaufnahme lohnen könnte.
Die Kriminaltechnik hatte in den letzten Jahren faszinierende Fortschritte gemacht, und schon mancher Mörder, der sich längst in Sicherheit wiegte und seine Tat vergessen glaubte, hatte eines Morgens sehr verdutzt ins Auge des Gesetzes geblickt, als er die Tür öffnete.
»Sie blicken dauernd auf die Uhr«, sagte Liebekind, nun schon wieder freundlicher. »Haben Sie noch einen Termin heute?«
»Elternstammtisch. Die zweitgrößte Katastrophe nach Kindergeburtstag.«
Er brauchte ja nicht zu wissen, dass ich zuvor noch mit seiner Frau ins Bett steigen würde. Theresa, meine Geliebte. Immer wieder und immer noch fühlte ich diesen heißen Stich im Bauch, wenn ich an sie dachte. Ich konnte nur hoffen, dass Liebekind in diesem Moment keine Veränderung in meinem Gesicht bemerkte.
Leider würde unser Abend heute nur kurz sein, denn der Elternstammtisch war nicht erfunden. Es gab irgendein Problem mit der Klasse, welches, hatte ich nicht recht verstanden. Ich hatte auch nicht die geringste Lust hinzugehen, aber meine Töchter lagen mir ständig in den Ohren, ich würde mich viel zu wenig für ihr Fortkommen in der Schule und stattdessen zu sehr für ihre abendlichen Freizeitaktivitäten interessieren.
Ich erhob mich. »Am Montag lasse ich überprüfen, ob der Name Möricke in unseren Akten auftaucht. Vielleicht ist es ja eine Art Rachefeldzug gegen uns, was er treibt. Wenn es so ist, dann können wir den Spieß umdrehen und seinen Kollegen von der Konkurrenz einen kleinen Hinweis zuspielen. Dann wäre er der Blamierte und würde sich vielleicht ein anderes Ziel suchen für seine Attacken.«
Theresa erwartete mich mit dezent indigniertem Blick. Genau wie ihr Mann konnte auch sie es nicht leiden, wenn man sie warten ließ. Aber ich kam nur dreieinhalb Minuten zu spät, und sie war noch nicht wirklich sauer.
»Schimpf mit deinem Gatten«, sagte ich nach einem hastigen Kuss. »Er konnte sich wieder mal nicht losreißen von mir.«
Wie üblich trafen wir uns in der kleinen Wohnung ihrer Freundin Inge in der Blumenstraße, praktischerweise nur ein paar Schritte von meinem Büro entfernt. Ich hatte diese Inge noch nie zu Gesicht bekommen, da sie schon seit über einem Jahr in Sydney arbeitete und lebte. Theresa sah hier ein wenig nach dem Rechten, goss die Pflanzen und missbrauchte in schamlosester Weise Vertrauen, Bett und Bad ihrer ahnungslosen Freundin.
»Egonchen?«, fragte sie milde und knabberte ein wenig an meinem linken Ohr. »Er hat doch nicht etwa Verdacht geschöpft?«
»War rein dienstlich. Und jetzt will ich nichts mehr davon hören. Ab sofort bin ich nämlich im Wochenende.«
Aufatmend fielen wir aufs Bett und begannen unverzüglich, uns gegenseitig zu entkleiden. Wenn nichts dazwischenkam, dann trafen wir uns zweimal die Woche, und diese wenigen Stunden mit Theresa waren kostbar für mich. Aber heute war ich unkonzentriert. Der Beruf war noch zu nah, meine Leidenschaft halb gespielt, und natürlich blieb das meiner Geliebten nicht lange verborgen.
»Was ist?« Sie hörte auf, mich zu streicheln. »Stress im Büro oder mit den Töchtern?«
Ich erzählte ihr Melanie Seiferts Geschichte. Ernst hörte sie zu, während ihre Fingerspitzen über meine Brust strichen.
»Eure Gefängnisse wären vermutlich ziemlich überfüllt, wenn ihr jeden Kerl einsperren wolltet, der in der Straßenbahn ein Mädchen anbaggert.«
»Na ja«, seufzte ich, »ganz so harmlos ist die Geschichte nun auch wieder nicht.«
»Zwischen einem Flirt und sexueller Belästigung liegt eben oft nicht mehr als ein Missverständnis.«
Theresas Fingerspitzen wanderten abwärts. Ich rollte mich auf den Rücken und genoss ihre Zärtlichkeiten mit geschlossenen Augen.
»Ich weiß nicht, wie ich darüber denken würde, wenn einer meiner Töchter so was passieren würde. Sie sind kaum jünger als Melanie, und das ist schon ein verflixt gefährliches Alter. Die Mädchen wissen einfach noch nicht, was sie anrichten können, wenn sie einem Mann schöne Augen machen.«
Unser Gespräch erstarb. Wir konzentrierten uns wieder auf die Sprache unserer Hände. Ich roch Theresas Duft, spürte ihre Haut, die Hitze ihres erregten Körpers, und endlich war mein Kopf nicht mehr im Büro, sondern dort, wo er hingehörte, bei meiner Geliebten, deren Berührungen und Geruch ausreichten, mich in wenigen Minuten die Welt außerhalb dieses Raums vergessen zu lassen. Mit ihr gab es keine gemeinsamen Sorgen, keinen Alltag, zwischen dessen unendlich langsamen aber so elend gründlichen Mühlrädern nicht wenige Beziehungen früher oder später zu Staub zerfielen. Unsere glücklichen Stunden verbrachten wir zusammen, den weniger erfreulichen Rest getrennt.
Theresa war keine Nymphomanin. Sie war nicht süchtig nach Sex, hatte sie mir einmal gestanden, sie war süchtig nach Sex mit mir, und von Liebe wollte sie nichts hören. Aber auf gewisse Weise liebte sie mich dennoch glühend, dessen war ich mir sicher. Vor einiger Zeit war ich zu der Überzeugung gelangt, dass mein Chef impotent war und seine Frau sich bei mir das holte, was sie bei ihm nicht bekam.
Endlich gab es in meinem Kopf keine Polizeidirektion mehr, keine Angst, ihr Mann könnte uns auf die Schliche kommen, keine unbeaufsichtigten, ewig herummaulenden Töchter, sondern nur noch diesen süßen Nebel, der einen jede Vorsicht und Vernunft vergessen lässt. Für eine Weile gab es nur noch zwei Menschen auf der Welt, zwei Körper, vier Hände, Lippen, Wärme, Schnurren, Feuchtigkeit, Stöhnen, Glück.
Später leerten wir gemeinsam die Sektflasche, die noch von Dienstagabend im Kühlschrank stand. Theresa rauchte, und wir sprachen über Belangloses. Sie zeigte mir ihre neue, kostbare Unterwäsche, die ich in der Eile natürlich nicht gebührend bewundert hatte, warf mir mit sanfter Nachsicht vor, ich hätte schon wieder nicht bemerkt, dass sie beim Frisör war. Teure Unterwäsche und immer wieder neue Frisuren waren ihre Leidenschaften. Andere Frauen sammelten Schuhe, Theresa sündhaft knappe Slips aus kostbaren Materialien und edle Büstenhalter, die mehr präsentierten als verbargen.
Der Elternstammtisch, zu dem ich natürlich ebenfalls zu spät kam, war einer jener Anlässe, bei denen man begreift, wie leicht auch der friedfertigste Mensch zum Amokläufer werden kann. Thema des Abends war ein Französischlehrer, der von der Klasse viel verlangte und entsprechend schlechte Noten verteilte. Noch vor meiner Ankunft hatten sich zwei Fraktionen gebildet. Die eine war der unerschütterlichen Überzeugung, der Mann sei im Recht, Kinder müssten gefordert werden, da sie sonst nie die für den Lebenskampf unverzichtbare Härte entwickelten. Klassenarbeiten konnten gar nicht schwer und die Benotung nicht streng genug sein, solange nur ihre eigenen Kinder ordentliche Zeugnisse heimbrachten.
Die zweite Partei, zu der auch ich mich zählte, war der Ansicht, mit vierzehn Jahren habe ein Mensch noch das Recht, hin und wieder ein wenig Kind zu sein. Zu träumen, zu spinnen, sich für andere Dinge zu interessieren als unregelmäßige Verben und Karriere.
Wie erwartet, tobte der Streit ebenso erbittert wie ergebnislos. Ein Kompromiss war schon aus Prinzip nicht möglich, da beide Fraktionen sich im Besitz der Wahrheit wussten, was für sich genommen oft genug Anlass für Mord und Totschlag ist. Und schließlich ging es hier um die Kinder und damit um nichts Geringeres als die Zukunft der Welt.
Mein vorsichtiges Argument, Jugendliche sollten zwar in der Schule fürs Leben lernen, diese könne das Leben aber nur bedingt ersetzen, ging im allgemeinen Tumult unter. Bald bestellte ich mir einen zweiten Spätburgunder und hielt den Mund.
Am Ende wusste niemand mehr, was nun eigentlich das Ziel dieser merkwürdigen Veranstaltung gewesen war, und mir brummte der Kopf, weil die Hälfte der Anwesenden im Gefechtseifer tapfer zu rauchen begonnen hatte. Und selbstverständlich war man zu keinem Beschluss gekommen.
Als ich um halb elf nach Hause kam, lagen meine Zwillinge vor dem Fernseher und guckten einträchtig irgendeine amerikanische Serie, deren Thema einsame Hausfrauen und Sex zu sein schien. Ich setzte mich zu ihnen, stibitzte hin und wieder einen Kartoffelchip aus ihrer Tüte, trank ein Glas Merlot dazu und amüsierte mich zu meiner Überraschung nicht einmal schlecht. Erst als die Sendung zu Ende war, fiel mir auf, dass Sarah etwas mühsam lachte, während Louise und ich uns kugelten, weil wieder einmal ein trotteliger Gatte seine Angetraute zusammen mit seinem besten Freund nackt im Kleiderschrank fand.
»Was ist?«, fragte ich Sarah, als wir den Fernseher ausschalteten. »Schlechte Laune oder schlechte Noten?«
»Nichts ist«, erhielt ich zur Antwort. »Bin bloß müde.«
Doch nicht schon wieder Liebeskummer?
»Zahnweh hat sie.« Louise erntete einen bitterbösen Blick von ihrer Schwester. »Schon seit ein paar Tagen.«
»Dann solltest du vielleicht mal zum Zahnarzt gehen«, schlug ich vor. »Ist nicht gut, so was lange mit sich herumzuschleppen. Das kann sogar lebensgefährlich werden.«
Bei den letzten Worten war meine Stimme leiser geworden. Vera, meine Frau und die Mutter meiner Töchter, war vor nicht einmal zwei Jahren nach einem Zahnarztbesuch wegen eines vereiterten Weisheitszahns völlig überraschend gestorben.
»Wir haben ja gar keinen Zahnarzt«, schimpfte Sarah. »Unserer ist in Karlsruhe, aber von da mussten wir ja weg. Und außerdem ist es schon viel besser. Heute Morgen war die Backe noch ganz dick! Und jetzt – guck mal.«
»Stimmt«, bestätigte Louise. »Heute früh war’s noch viel schlimmer.«
»Das ist mir gar nicht aufgefallen.«
Sarah warf mir einen wütenden Seitenblick zu und sich selbst eine Handvoll Chips in den Mund. »Wann merkst du schon mal was!«
Jetzt erst erkannte ich, dass nicht nur Theresa beim Frisör gewesen war. Beim Frühstück hatten meine Töchter die gerstenblonden, glatten Haare noch lang getragen, jetzt waren die Mittelscheitel zur Seite gerutscht, das Haar ein gutes Stück kürzer, eine raffinierte Strähne fiel übers linke Auge. Die beiden wirkten plötzlich zwei Jahre älter.
»Hübsch«, sagte ich lahm. »Wirklich!«
Ein kurzes Lächeln blitzte in vier wasserblauen Augen. Mir machte es zu schaffen, wie rasch meine Kinder sich in den letzten Monaten zu attraktiven jungen Frauen entwickelten. Anfangs hatten sie noch rührend ausgesehen mit ihren bauchfreien Tops an den mageren Körpern, ihren harmlosen Versuchen, älter zu wirken, als sie waren. Natürlich hatten sie längst ihre Tage, was ich aber nur daran gemerkt hatte, dass auf einmal blassblaue Kartönchen mit Tampons im Bad herumlagen, und ihre Formen wurden von Monat zu Monat fraulicher, reifer, runder.
Ich dachte an mein Gespräch mit Theresa und diese unselige Geschichte in der Straßenbahn. Die Vorstellung machte mir zu schaffen, wie auch meine Töchter, ausgestattet mit Kinderseelen, aber auf einmal mit Körpern heranreifender Frauen, ahnungslos durch die Welt stolperten. Ihr Wissen über Sex und Liebe bezogen sie im Großen und Ganzen aus dem Fernsehen und ihren Bravo-Heftchen. Immerhin wurden dort auch Themen wie ungewollte Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten behandelt, wie ich mich vergewissert hatte. Mehrfach hatte ich versucht, mit ihnen über diese Dinge zu sprechen, aber es war mir nicht gelungen. Obwohl wir sonst über alles reden konnten, diese Themen waren tabu, und ich hätte nicht einmal sagen können, ob das an mir oder an meinen Mädchen lag. Und dabei gab es doch zur Zeit sicherlich nichts Wichtigeres in ihrem Leben.
Sarah fühlte mit der Zunge nach ihrem schmerzenden Zahn und versprach missmutig, gleich morgen alle ihre Freundinnen anzurufen und sich nach einem akzeptablen Zahnarzt zu erkundigen. Und gleich am Montag, ehrlich, ganz bestimmt, würde sie sich um einen Termin kümmern.
»Aber nur, wenn du mitkommst!«
»Sarah, du bist doch kein Kind mehr! Ich bin schon mit zehn allein zum Zahnarzt gegangen!«
»Mama ist aber immer mitgekommen! Und sie hat auch immer Angst gehabt.«
»Und du bestimmt auch«, assistierte Louise. »Du willst es bloß nicht zugeben.«
»Angst ist dazu da, dass man sie überwindet.«
»Quatsch. In der Schule haben wir gelernt, man hat Angst, damit man sich nicht unnötig in Gefahr begibt.«
Manchmal finde ich, die Schule sollte sich nicht um alles kümmern.
»Jetzt guckt erst mal, welcher Zahnarzt euch gefällt, und dann sehen wir weiter, okay?«
»Du hast dann doch wieder keine Zeit, wetten?«, zischte Sarah.
»Habt ihr schon Pläne fürs Wochenende?«
Sie sahen mir beunruhigt ins Gesicht. »Wieso?«
»Wir könnten mal wieder was zusammen machen.«
Ihre Mienen wurden misstrauisch. »Was denn?«
»Ich koche uns was Schönes, und wir essen am Sonntag mal wieder so richtig gemütlich zusammen.«
»Du kochst?«, fragten sie erschrocken.
Jetzt war ich doch ein wenig beleidigt. Gut, es war noch nicht so lange her, dass ich beschlossen hatte, ordentlich kochen zu lernen. Ich hatte mir Bücher gekauft, aus dem Internet Rezepte heruntergeladen, Experimente durchgeführt, und inzwischen fand ich die Ergebnisse meiner Bemühungen gar nicht mehr so übel. Meine Töchter waren in diesem Punkt jedoch hartnäckig anderer Ansicht.
»Ihr dürft aussuchen, was es gibt«, schlug ich vor. »Aber sagt nicht wieder Spaghetti mit Nutella.«
Sie wechselten einen Blick.
»Pizza«, schlug Louise ohne Begeisterung vor. »Pizza geht immer.«
»Oder Döner«, meinte Sarah.
Sie sahen mich an. »Hamburger! Selber gemachte Hamburger, das wär doch mal cool!«
»Mädels, ich hatte nicht vor, einen Schnellimbiss aufzumachen. Ich wollte was Richtiges kochen. Außerdem soll man nicht ständig Fleisch essen. Das ist ungesund.«
»Du hast aber gesagt, wir dürfen uns was wünschen!«
So einigten wir uns schließlich doch auf Pizza. Ein Rezept für den Teig musste ich irgendwo haben, und der Rest konnte kein Problem sein. Um meinem Gewissen etwas Gutes zu tun, würde ich eine große Schüssel Salat dazustellen, den ich aber vermutlich alleine verspeisen würde.
Meine Töchter hassten nun mal alles, was gesund war.
3
Die morgendliche Routinebesprechung am Montag hatte eben begonnen, noch hatten nicht alle meine Mitarbeiter Platz genommen, da klingelte das Telefon. Sönnchen, meine unersetzliche Sekretärin, hatte sich unter zahllosen Entschuldigungen krank gemeldet, deshalb hatte ich unter ihrer telefonischen Anleitung die Gespräche direkt auf meinen Apparat geschaltet. Obwohl der Sommeranfang nicht mehr weit war, grassierte in Heidelberg die Grippe.
Den Namen der Frau verstand ich wegen der Unruhe im Raum nicht. Nur, dass sie mir etwas Wichtiges mitteilen wollte und sehr aufgeregt war. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass weder sie noch sonst jemand in akuter Gefahr schwebte, bat ich sie, in einer halben Stunde wieder anzurufen.
Als sie hereinkam, war mir sofort aufgefallen, dass Klara Vangelis sich übers Wochenende äußerlich sehr verändert hatte. Wie üblich kam sie edel gekleidet, heute in einem Designerkostüm aus sandfarbenem Leinen. Auch dieses hatte sie bestimmt selbst geschneidert, wie die meisten ihrer Sachen, die sie sich von ihrem Gehalt niemals hätte leisten können. Dazu trug sie halbhohe, farblich perfekt abgestimmte Pumps und einen absolut unpassenden, dicken Stützverband ums Genick. Und sie machte nicht die Miene, als wollte sie gefragt werden, was ihr zugestoßen war.
In der üblichen Montagmorgen-Muffeligkeit berichteten meine Leute unter häufigem Gähnen von den bescheidenen Fortschritten ihrer Arbeit. Ich hörte nur mit halbem Ohr zu und war mit meinen Gedanken und Gefühlen noch im Wochenende. Und auf Sylt.
Beim sonntäglichen Mittagessen hatten meine Töchter mir nämlich eröffnet, sie seien ab Mittwoch verreist. Klassenfahrt nach Sylt, sechs Tage lang und zweimal zweihundertneunzig Euro teuer, all inclusive außer Getränke und Privatvergnügen. Einer der Vorteile von Zwillingen ist, dass man über viele Dinge nur einmal nachzudenken braucht. Einer der Nachteile ist, dass alles das Doppelte kostet. Auf meine Frage, wieso um alles in der Welt ich das erst jetzt erfuhr, erhielt ich zur patzigen Antwort, vor ungefähr acht Wochen hätte ich einen Wisch unterschrieben, auf dem alles haarklein erklärt sei, und sie könnten ja wohl nichts dafür, dass ich immer alles vergaß. Am Mittwoch würden sie in aller Frühe fahren und – dieser Halbsatz versöhnte mich augenblicklich – erst am Montagabend zurückkommen.
Ein töchterfreies Wochenende! Welche Möglichkeiten! Wenn ich ein wenig Glück hatte, dann war auch Liebekind unterwegs, was wegen seiner Lehrverpflichtungen an der Polizei-Führungsakademie in Münster gar nicht so selten vorkam, und Theresa und ich konnten noch heute daran gehen, Pläne zu schmieden für zwei herrliche freie Tage.
Ich bemühte mich, nicht an unpassenden Stellen zu lächeln, während meine Leute ohne mich diskutierten.
Die Pizza am Sonntag war mir ganz gut geraten, wenn auch der Teig ein wenig zu dick war, was jedoch nur mich störte. Meine Töchter hatten mehr der Form halber ein wenig herumgenörgelt, weil ich nach ihrer Ansicht mit der Salami zu sehr gegeizt hatte. Den Salat, dessen aufwändige Sauce mich eine halbe Stunde Arbeit gekostet hatte, rührten meine Mädchen – wie befürchtet – nicht an. Sarahs Zahnschmerzen waren schon am Samstag verschwunden gewesen, und natürlich sah sie nicht ein, wozu ein Mensch, dem überhaupt nichts fehlte, einen Arzttermin brauchte.
Das Heidelberger Wochenende war einigermaßen ruhig gewesen, schnappte ich nebenbei auf. Zwei Kneipenschlägereien, eine Festnahme wegen Hehlerei, ein paar Bagatellen, die alle mit Alkohol oder anderen Drogen zu tun hatten. Und mit den Touristenströmen waren natürlich die Taschendiebe zurückgekommen.
Als die Sprache auf den Bankraub kam, den Klara Vangelis und Sven Balke bearbeiteten, meine besten Mitarbeiter, zwang ich mich zuzuhören. Vangelis, eine ebenso spröde wie verlässliche und intelligente Kollegin, war trotz ihrer jungen Jahre schon Erste Hauptkommissarin. Ansonsten war sie griechischer Abstammung, hübsch, stets sehenswert korrekt gekleidet und mit einem Vater gestraft, in dessen gut gehender Taverne sie abends und an den Wochenenden regelmäßig aushelfen musste. Humor war nicht ihre Stärke. Schon gar nicht, wenn sie mit einem Genickverband verunstaltet war, der das Design ihres Outfits gründlich aus dem Gleichgewicht brachte. Ich entdeckte, dass sie auch eine gut überschminkte Beule an der linken Schläfe hatte. Bei passender Gelegenheit musste ich unbedingt ihren Bürogenossen Balke fragen, was da passiert war.
Balke nahm das Leben eher von der leichten Seite. Bis vor wenigen Monaten hatte sein Diensteifer unter seinen ständig wechselnden Liebschaften gelitten. Aber seit er mit seiner Nicole zusammenlebte, wirkte er ausgeglichener, friedlicher und schien sogar ein wenig zuzunehmen. Morgens kam er ordentlich rasiert zum Dienst, und an Montagen wirkte er nicht mehr, als hätte er seit Freitagabend durchgemacht. Dafür achtete er seit neuestem auf die Einhaltung der Dienstzeiten und pünktlichen Feierabend. Balke stammte aus Norddeutschland, was man bei jedem Wort hörte, das er sprach.
»… eine Spur von Bonnie and Clyde«, hörte ich Vangelis sagen.
Ich setzte mich gerade hin.
»Der Saab steht in Málaga auf einem Hotelparkplatz nur wenige Kilometer von der Bank entfernt, wo der erste Schein aus der Beute aufgetaucht ist. Und die zwei – wenn sie es denn sind – haben anscheinend ein Zimmer in diesem Hotel, schreiben die spanischen Kollegen.«
Irgendein Witzbold bei uns hatte das junge Bankräuber-Pärchen Bonnie and Clyde getauft, da wir bisher nicht einmal ihre Namen kannten. An einem frühen Mittwochmorgen vor gut vier Wochen hatten die beiden den Leiter der Eppelheimer Sparkassen-Filiale mitsamt seiner Frau aus dem Bett geklingelt, ihm zwei großkalibrige Pistolen unter die Nase gehalten und ihn sehr rasch davon überzeugt, dass mit ihnen nicht zu spaßen war. Offenbar nur um seine Entschlossenheit zu demonstrieren, schoss der männliche Täter den Filialleiter in den Oberarm. Die Verletzung war zum Glück nicht weiter schlimm gewesen, aber danach erfüllten die Überfallenen jede Forderung des Gangsterpärchens ohne Zögern oder gar Widerspruch.
Die Frau, nach Aussage des Ehepaars höchstens Anfang zwanzig, blieb mit der Gattin im Haus zurück, während der einige Jahre ältere Mann zusammen mit dem Filialleiter zur Bank fuhr. Die ganze Zeit über, fast neunzig Minuten lang, hatten die Täter per Handy in Verbindung gestanden, und ihre Drohung war so unmissverständlich wie glaubhaft gewesen: Wenn während der Fahrt oder in der Bank irgendetwas schiefging, dann war der Filialleiter Witwer.
Es war nichts schiefgegangen.
In der Bank hatte der Täter zusammen mit seiner Geisel einige Minuten auf die Kassiererin warten müssen, da auch der Filialleiter den Safe nicht alleine öffnen konnte, und die beiden dann gezwungen, die Beute in zwei mitgebrachte Müllsäcke zu stopfen. Am Ende schloss er alle beide im Safe ein und wünschte noch einen angenehmen Aufenthalt, und Minuten später waren Bonnie and Clyde mit etwas über anderthalb Millionen Euro im Kofferraum spurlos verschwunden. Fast spurlos.
Den Fluchtwagen, einen klapprigen schwarzen Fiesta älteren Baujahrs, entdeckten Spaziergänger gegen Mittag desselben Tages in einem Wäldchen östlich von Lampertheim. Und am nächsten Morgen hatte sich ein Zeuge gemeldet, ein zappeliger Herr in den Siebzigern, der dort oft seinen afghanischen Windhund spazieren führte. Er behauptete, das Fahrzeug gesehen zu haben, mit dem das Pärchen seinen Weg fortsetzte. Ein zwei Tage zuvor in Koblenz gestohlener Saab sei es gewesen, der fast einen Tag lang einsam in einem Waldweg parkte, ganz in der Nähe der Stelle, wo wir später den Fiesta sicherstellten. Und nun stand dieser Saab also seit über einer Woche unberührt auf dem Parkplatz eines sündteuren Hotels am Strand westlich von Málaga.
»Sie sollen übrigens kaum aus dem Bett kommen, unsere zwei Süßen«, meinte Balke fröhlich. »Wir müssen den Spaniern nur noch bestätigen, dass es die Richtigen sind, und wir haben einen Fall weniger auf der Liste.«
»Und, sind sie es?«
Wortlos reichte er mir einige großformatige Fotografien über den Schreibtisch. Das junge Paar eng umschlungen beim Bummel über irgendeine südliche Einkaufsmeile. Auf dem zweiten Foto saßen sie entspannt plaudernd auf einer Parkbank im Schatten einer großen Platane, auf dem dritten waren sie lachend beim Taubenfüttern, und auf den restlichen Bildern aßen sie königlich zu Abend auf einer Terrasse mit Meerblick und Sonnenuntergang.
Der Mann war groß gewachsen, überschlank und hatte einen mürrischen, leicht hochmütigen Zug um den Mund. Sie dagegen – ein Kind von zwanzig Jahren, das schwarze Haar im praktischen Pagenschnitt, die dunklen Augen voller Staunen und Lebensfreude. Zwei gefährliche Straftäter, beide sicherlich noch immer bewaffnet, strahlend glücklich, sehr verliebt – Bonnie and Clyde.
»Wie soll man da nicht neidisch werden?«, maulte Balke. »Wir sitzen hier im Dauerregen, und dieses Ganovenpärchen macht sich ein lockeres Leben in der Sonne. Manchmal frage ich mich echt, ob ich mir nicht die falsche Seite ausgesucht habe.«
»Fragen Sie sich das übermorgen noch mal, wenn die zwei in U-Haft sitzen«, erwiderte ich. »Hat der Filialleiter die Fotos schon gesehen?«
Vangelis nickte, soweit es ihr Verband zuließ. »Herr Braun hat sie eindeutig identifiziert. Seine Frau mussten wir gar nicht bemühen. Er hat uns gebeten, sie zu schonen. Sie leidet anscheinend immer noch sehr unter den Ereignissen.«
»Unter welchen Namen sind die zwei im Hotel angemeldet?«
»Unter falschen«, erwiderte Vangelis. »Das habe ich gleich abklären lassen. Sie reisen mit gefälschten Papieren. Susanne Bick und Horst Schröder.«
Wieder läutete mein Telefon. Wieder war es diese Frau. Seit ihrem ersten Anruf waren exakt dreißig Minuten vergangen.
Ich legte die Hand vors Mikrofon, wechselte Blicke mit meinen Leuten, Balke sammelte seine Fotos wieder ein.
»Geben sie den Spaniern grünes Licht und bereiten Sie schon mal alles für den Auslieferungsantrag vor.«
Das allgemeine Stühlerücken begann, und ich wandte mich wieder dem Telefon zu. Die Stimme klang hell und jung. Die Frau wirkte nervös und sehr unsicher.
»Mein Sohn, er war am Freitag bei Ihnen, David, Sie erinnern sich? Ich spreche doch mit Kriminalrat Gerlach?«
»Das stimmt. Aber an einen David …«
»Ich bin Ihnen so zu Dank verpflichtet, dass Sie persönlich mit ihm gesprochen haben. Mein Mann sagt ja auch immer, man soll lieber gleich mit den wichtigen Menschen sprechen, wenn man nicht von Pontius zu Pilatus geschickt werden möchte. Deshalb nehme ich mir jetzt auch die Freiheit, mich direkt an Sie zu wenden und …«
»Bitte, Frau … «, im anfänglichen Durcheinander hatte ich ihren Namen wieder nicht verstanden. Endlich wurde es ruhiger. Vangelis war die Letzte, schenkte mir ein notdürftiges Lächeln und zog, wegen ihrer Halskrause streng erhobenen Hauptes, die Tür hinter sich zu. »Könnten Sie mich bitte noch einmal kurz darüber aufklären, worum es eigentlich geht?«
»Ach herrje, da stürze ich wieder einfach so mit der Tür ins Haus. Aber es ist … Ich bin so in Sorge, es geht um unseren Nachbarn, Herrn Seligmann.«
Jetzt erinnerte ich mich. »Ist er immer noch nicht aufgetaucht?«
»Ich komme mir so dumm vor. Sie haben ja gewiss viel zu tun, und nun komme ich und …«
»Was ist denn mit Ihrem Nachbarn?«, fragte ich beruhigend. Es hatte keinen Zweck, sie ausreden zu lassen, sonst würde ich vermutlich vor dem Mittagessen zu nichts anderem mehr kommen.
»Ich habe getan, was Sie mir geraten haben. Erst habe ich mich nicht getraut, aber dann war ich heute Morgen doch in seinem Haus. Die Tiere müssen doch versorgt werden. Nein, ich habe nichts von ihm gehört. Sein Wagen ist auch verschwunden, ich habe in der Garage nachgesehen. Und jetzt möchte ich eine Vermisstenanzeige aufgeben. Man nennt das doch so?«
»Wie war noch mal Ihr Name?«
»Braun«, erwiderte sie. »Rebecca Braun.«
Ich notierte mir die Adresse, damit sie das Gefühl hatte, ernst genommen zu werden.
»Frau Braun«, sagte ich dann ruhig. »Es ist wirklich sehr lobenswert, dass Sie sich so um Ihren Nachbarn sorgen. Wenn es das öfter geben würde, dann müssten manche alten Menschen nicht wochenlang tot in ihrer Wohnung liegen, bis jemand etwas merkt. Aber auf der anderen Seite, bitte verstehen Sie mich richtig, Herr Seligmann ist ein erwachsener Mensch. Er ist nicht geistig verwirrt, hat mir Ihr Sohn gesagt. Und deshalb darf Herr Seligmann verreisen, wohin und so oft er will. Jahr für Jahr verschwinden in Deutschland zigtausend Personen, und die allermeisten tauchen früher oder später kerngesund und in bester Verfassung wieder auf.«
»Aber hier ist es anders, bitte, so glauben Sie mir doch. Ich sagte Ihnen doch, ich war in seinem Haus und …« Ihre Stimme erstarb.
»Haben Sie dort irgendwas gefunden, was Ihre Sorge bestätigt?«
»Ja«, erwiderte sie mit erstickter Stimme. »Blut.«
Jetzt endlich fiel bei mir der Groschen. »Frau Braun, Sie wohnen in Eppelheim in der Goethestraße. Ihr Mann arbeitet doch nicht etwa bei einer Bank?«
»Aber ja. Natürlich.«
Ich drückte die Kurzwahltaste, die mich mit Klara Vangelis verband.
»Lassen Sie alles stehen und liegen. Wir treffen uns unten auf dem Parkplatz.«
Rebecca Braun, eine zierliche, ernste Person, hatte dieselben wachen, dunklen Augen wie ihr Sohn. Die Farbe ihres schlicht geschnittenen Kleids, ein dunkles Grün, harmonierte mit ihrem lockigen, rötlich-braunen Haar, das sie im Nacken zu einem losen Knoten gesteckt hatte. Ihr Alter war schwer zu schätzen. Ihren Sohn hatte ich auf fünfundzwanzig geschätzt, also musste sie die vierzig schon hinter sich haben. Manche beneidenswerten Menschen altern eben langsamer als andere – ich zählte leider nicht dazu.
Das graue Haus ihres Nachbarn in der Eppelheimer Goethestraße war Stein gewordener Durchschnitt. Nicht besonders klein, nicht auffallend groß. Nicht ärmlich, aber auch nicht teuer. Das zweistöckige Gebäude mit spitzem Giebel stammte vermutlich aus der Nachkriegszeit, als Wohnungsnot und knappe Mittel den Baustil diktierten. Ob es schon immer grau gewesen oder nur lange nicht gestrichen worden war, konnte ich nicht erkennen. Von den hölzernen Fensterrahmen blätterte der Anstrich.
Rebecca Braun führte uns über einen halb zugewachsenen Kiesweg zum Hauseingang. Alles wucherte hier, blühte, wie es gerade passte.
Damals hatte man sich noch ordentliche Grundstücke leisten können. Die neueren Häuser in der Umgebung standen auf deutlich kleineren Flächen. Dort wuchsen auch keine riesigen alten Bäume und ungebändigten Rosenbüsche wie hier. Die Familie Braun selbst bewohnte einen ebenso großzügigen wie gesichtslosen Bungalow, dessen regelmäßig gemähter Rasen an die Wildnis grenzte, die wir gerade durchquerten. Weiter hinten schimmerte nebenan bläulich ein Pool.
Hier, bei Seligmann, schimmerte nichts.
Das Wetter war endlich erträglich geworden. Nachdem es in den letzten Tagen fast ohne Pause geregnet hatte, wagte sich heute eine kraftlose Sonne heraus, und ich begann zu schwitzen, obwohl es noch keineswegs warm war. Dieser verwirrte Sommer wusste einfach nicht, wofür er sich entscheiden sollte. Aber das war kein Wunder, er war ja noch jung.
Die Ähnlichkeit unserer Führerin mit ihrem Sohn war selbst von hinten unübersehbar. Auch sie war zart gebaut, hatte dasselbe weiche Haar, dieselbe sympathische Zurückhaltung und leichte Nervosität. Außer dem vielleicht etwas zu breiten Ehering trug sie keinerlei Schmuck. Ihr Parfüm war dezent und frisch wie das einer sehr jungen Frau.
Als sie uns die Tür ihres verschwundenen Nachbarn aufschloss, zitterten ihre schmalen Hände.
»Bitte«, sagte sie so verhalten, als würden wir einen heiligen Ort betreten, und ließ uns den Vortritt. Wir durchquerten einen im Dämmerlicht liegenden, schmucklosen Flur und betraten einen überraschend geräumigen Wohnraum. Hohe Bäume und ewig nicht beschnittene Büsche vor der Terrassentür und den beiden Fenstern verdunkelten das Zimmer. Hier war lange nicht gelüftet worden.
»Puh«, seufzte Vangelis. »Wenn ich in dieser Finsternis wohnen müsste, würde ich auch eines Tages auf Nimmerwiedersehen verschwinden.«
Frau Braun drückte einen Lichtschalter, Energiesparbirnen flackerten auf, und es wurde ein wenig heller. Das Erste, was mir ins Auge fiel, waren die Terrarien, eines neben dem anderen, die ganze Seitenwand entlang. Dort raschelte es hin und wieder, aber Tiere konnte ich aus der Entfernung keine entdecken. Dennoch grauste mir vor diesen gläsernen Gefängnissen.
Der Rest der Einrichtung war schlicht, ein wenig heruntergekommen, jedoch nicht verwahrlost. In weitläufigen Regalen standen und lagen Bücher über Bücher in sehenswerter Unordnung. Eine in die Jahre gekommene, ehemals kostbare Stereoanlage mit riesigen Boxen, achtlos hingeworfen ein guter Sennheiser-Kopfhörer, daneben eine beeindruckende Sammlung von Langspielplatten, auch einige wenige CDs. Ansonsten angenehm wenig Technik. Der Fernseher stammte vermutlich noch aus der Zeit der Außerparlamentarischen Opposition, das grüne Telefon mit schwarzen Tasten hing noch an einer Schnur. In diesem Haus schien die Zeit vor vielen Jahren zum Stillstand gekommen zu sein.
Wir betraten die altmodisch und zweckmäßig eingerichtete Küche.
»Sehen Sie«, sagte unsere Führerin im Flüsterton. »Das ist doch Blut, nicht?« Mit Schaudern deutete sie auf einige große, dunkle Flecken auf den blassgrauen, an vielen Stellen gesprungenen Fliesen. Im Raum hing ein Geruch, als gehörte der Mülleimer dringend geleert.
Vangelis ging mit einem unterdrückten Seufzer in die Hocke. Vielleicht hatte sie auch Verletzungen an Stellen, die man nicht sah?
»Haben Sie irgendetwas angefasst?«, war meine erste Frage an Frau Braun.
Erschrocken verschränkte sie die Arme vor der Brust und schüttelte den Kopf.
»Stimmt.« Meine Kollegin strich sich eine ihrer dunklen Locken aus dem Gesicht. »Das könnte wirklich Blut sein. Es ist schon einige Tage alt.«
Ich zückte das Handy und forderte Verstärkung an sowie die Kollegen von der Spurensicherung. Dann ging ich mit Frau Braun zurück ins Wohnzimmer.
»Sehen Sie nur.« Ratlos wies sie in die Runde. »Sonst ist er so ordentlich.«
Inzwischen hatten sich meine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt. Ein gläserner Aschenbecher lag am Boden, in zahllose Scherben zerborsten. Daneben eine zerbrochene Flasche, die einmal einen Dreiviertelliter billigen Birnenschnaps enthalten hatte, Zeitungen, Bücher, sogar einige Schallplatten ohne Hüllen und schonungslos zertrampelt, was mir fast körperliche Schmerzen bereitete. Auch hier entdeckte ich auf dem matten Linoleumboden die gleichen dunklen Flecken wie in der Küche. Unter einem der Heizkörper schließlich zusammengeknüllt ein kariertes Flanellhemd, das mit Blut besudelt war.
»Ich kenne es«, murmelte Rebecca Braun erbleichend. »Es gehört ihm.«
Erst jetzt fiel mir auf, dass der Teller des Plattenspielers sich noch drehte. Lämpchen glimmten, die Anlage war eingeschaltet. Ich betrachtete die Platte, die da seit Tagen Karussell fuhr. Mozart, das Requiem. Wie passend.
Als ich näher herantrat, entdeckte ich in einem der Glaskästen den Kopf einer großen Schlange, die zusammengerollt halb unter einem Stein verborgen lag. Ich wurde mir nicht klar darüber, ob sie mich beobachtete oder einfach nur im Halbschlaf vor sich hinstarrte. Als ich jedoch einige Schritte zur Seite trat, bewegte sich der Kopf mit. Nach und nach erwiesen sich auch andere Terrarien als belebt. In dem einen lebte eine fette schwarze Spinne, die sensibler veranlagten Menschen wochenlang Alpträume beschert hätte. In einem anderen klebte ein regloses Reptil kopfüber an der Frontscheibe und beobachtete mit äußerster Konzentration etwas, was für den Rest des Universums unsichtbar blieb.
»Hübsch, nicht?«, meinte Frau Braun, als sie meinen Blick bemerkte. »Ich finde das Grün so schön.«
»Na ja.« Ich räusperte mich.
Vangelis kam aus der Küche. Mit leiser Genugtuung bemerkte ich, dass auch sie Abstand zu den Tieren hielt.
»Was halten Sie davon?«, fragte sie missmutig. »Diese längliche Blutspur auf dem Couchtisch, die könnte von einer Messerklinge stammen.«
Während wir auf die Kollegen warteten, besah ich mir den Inhalt der Bücherregale. Xaver Seligmann musste im Lauf seines Lebens ein Vermögen für Literatur ausgegeben haben. Etwa die Hälfte waren Sachbücher. Eine Sammlung, die einem Professor für Zoologie Ehre gemacht hätte. Beim Rest handelte es sich um ein wildes Kunterbunt von Romanen, längst veralteten Reiseführern, Bildbänden und Zeitschriften, alles ohne erkennbares System in die Regale gestopft. Vangelis öffnete die Terrassentür, um Luft hereinzulassen.
Die Plattensammlung verriet Ordnungssinn und Liebe zur Klassik. Sie begann links oben mit Gregorianischen Gesängen, ging durch alle Epochen, um rechts unten mit Orff, Schönberg und Riehm zu enden. Unterhaltungsmusik kam nicht vor. Nicht einmal Jazz. Der Verschwundene musste ein ernster und nachdenklicher Mensch sein.
Draußen bremste der graue Kombi der Spurensicherung.
Rebecca Braun sollte Recht behalten. Schon nach wenigen Minuten war klar, dass es sich bei den Flecken im Haus ihres Nachbarn tatsächlich um Blut handelte. Die Frage war: Hatte er sich – vielleicht bei der Küchenarbeit versehentlich – geschnitten, oder hatte es hier eine Messerstecherei gegeben? Hinweise auf einen Kampf fanden die Kollegen allerdings nirgendwo im Haus. Die Spur auf dem Couchtisch passte zu einem schmalen Ausbeinmesser, das im Messerblock auf dem Kühlschrank fehlte. Es war verschwunden, ebenso wie der Wagen des Vermissten. War er selbst damit gefahren, oder lag er im Kofferraum? Tot oder nur verletzt? Wie immer am Beginn einer Ermittlung sagten wir ziemlich oft »vielleicht« und »vermutlich« an diesem Vormittag.
So wurde Xaver Seligmann, vor seiner Pensionierung Lehrer für Mathematik und Biologie, offiziell als vermisst gemeldet. Auch die Beschreibung seines uralten babyblauen Mazda Coupé wurde in einen Polizeicomputer getippt, und die üblichen Prozeduren begannen, während ich und meine Leute immer noch in Eppelheim waren und nach Spuren, Hypothesen, Erklärungen suchten.
4
»Können Sie sagen, wann Ihr Nachbar verschwunden ist?«, fragte ich die Nachbarin, als wir später im Garten auf einer wurmstichigen und etwas wackeligen Bank Platz nahmen. Wir waren beide froh, an die frische Luft zu kommen. »Ungefähr wenigstens?«
»Ich habe natürlich schon darüber nachgedacht. Vergangenen Mittwoch, da habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Später nicht mehr.«
»Haben Sie in den Tagen davor etwas Auffälliges bemerkt? Unbekannte Besucher? Oder ein Auto, das sonst nie hier parkte?«
Sie schüttelte den Kopf. »Alles war wie immer. Auch Herr Seligmann war eigentlich wie immer.«
»Was genau war an diesem Mittwoch?«
Wenn ich sprach, hing ihr Blick an meinen Lippen, als würde sie ständig fürchten, etwas zu überhören.
»Er hat morgens seine Mülltonne herausgestellt. Wir haben uns über den Zaun gegrüßt. Zum letzten Mal gesprochen habe ich ihn am Montag. Da ging er wie üblich einkaufen, ich hatte im Garten zu tun, wir haben ja so schrecklich viele Schildläuse dieses Jahr, und er hat mir einen Trick verraten dagegen: Spiritus. Es scheint tatsächlich zu helfen.«
»Hat Herr Seligmann Verwandtschaft?«
Sie wandte die Augen ab und betrachtete einen Rosenbusch in der Nähe.
»Über solche Dinge haben wir nie gesprochen. Nur, dass er früher einmal verheiratet war, weiß ich. Aber er ist schon lange geschieden. Die Ehe hat wohl auch nicht lange gehalten.«
Ich machte mir eine Notiz. »Nur zur Sicherheit: Ist er auf Medikamente angewiesen?«
»Er hat es am Herzen. Dagegen nimmt er Tabletten, das hat er mir einmal gesagt. Wenn er die nicht regelmäßig nimmt, dann kann es wohl problematisch werden.«
»Ihr Sohn sagte mir, Ihr Nachbar sei auch früher hin und wieder verreist. Wohin fährt er dann für gewöhnlich?«
»Zweimal die Woche macht er einen Ausflug. Montags und donnerstags, immer nachmittags gegen zwei fährt er los. Ich habe ihn nie gefragt, wohin. Das geht mich ja auch nichts an. Außerdem hatte ich das Gefühl, er mochte nicht darüber sprechen.«
»Wie lange bleibt er für gewöhnlich fort?«
»Abends um sieben, spätestens halb acht, ist er immer zurück.«
Der Platz in Seligmanns Garten war hübsch und angenehm. Wir saßen im Schatten, die Rosen dufteten, eine Amsel sang über uns in einer alten Tanne. Plötzlich verstand ich den Besitzer dieses Dschungels. Auch mir gefiel die Wildnis hier tausendmal besser als die gepflegte grüne Wüste nebenan.
»Den Rasen mäht mein Mann.« Meine Gesprächspartnerin konnte offenbar Gedanken lesen. »Mein Reich ist der hintere Teil. Dort, wo die Rhododendren stehen.«
»Wissen Sie, ob Herr Seligmann auch vergangene Woche seine Ausflüge gemacht hat?«
»Am Montag ja. Ob er am Donnerstag gefahren ist, kann ich nicht sagen. Ich war am Nachmittag in der Stadt. Ich …« Sie spielte eine Weile mit ihren zerbrechlichen Mädchenfingern. »Ich muss manchmal ganz plötzlich fort. Aus diesem Haus. Ich bekomme manchmal regelrechte Erstickungsanfälle seit dieser Geschichte …«
»Als Sie als Geisel gehalten wurden?«, fragte ich vorsichtig.
Sie schloss die Augen und nickte. »Manchmal, vor allem, wenn ich allein bin, muss ich auf einmal an die Luft«, flüsterte sie. »Unter Menschen. Ich kann das Alleinsein so schlecht ertragen, seither. An manchen Tagen geht es schon wieder recht gut. An anderen … Mein Mann arbeitet natürlich tagsüber. Und David ist ja auch nur selten da.«
»Ein sympathischer Junge, übrigens. Was macht er?«
»Er studiert Psychologie, hier an der Universität. Anfangs war er einige Semester in Marburg. Im kommenden Winter macht er Examen.«
Ein kleiner Schwarm Spatzen landete zeternd vor unseren Füßen, ohne uns zu beachten. Die Vögel stritten einen Augenblick herum und stoben wieder davon. Auf der Straße fuhr langsam ein dunkler Mercedes vorbei.
»Wo war Ihr Sohn eigentlich an dem Morgen, als Sie überfallen wurden? Es war noch vor acht. Da finden ja wohl keine Vorlesungen statt.«
Ende der Leseprobe