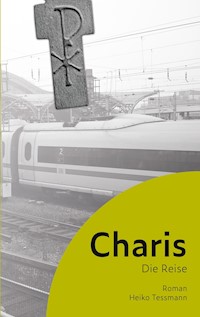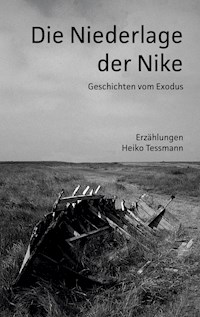6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
^Irgendwann gegen Ende der 60er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Heinrich entdeckt die Welt um sich herum. Und dabei allerlei seltsame Erwachsene, die offenbar - kleinen Irrlichtern gleich - am Rande von Heinrichs Welt umherstreifen oder auch mal mittendurch trampeln. Heinrich muss sich sehr wundern. Doch seine Altersgenossen hinterlassen selten einen besseren Eindruck. Das alles zu sortieren, ist ein enorm schwieriges Unterfangen. Einzig Heinrichs Mutter ist den wirren Situationen ab und zu gewachsen und gibt sich Mühe, den kleinen Kopf ordentlich zu halten. Aber das klappt auch nicht immer. So ist Heinrichs Welt ein Potpourri aus menschlichen Schwächen, schwachen und manchmal starken Menschen, kleinen Leuchtfeuern und tiefen Abgründen. Das Leben eben. Was bleibt dem Kleinen, als sich irgendwie zu arrangieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 1
Heinrich und Opas Krieg
Die Schatten der großen, weißen Juliwolken wanderten bedächtig über den Talboden, legten dunkle Teppiche über Häuser, Straßen, den Fluss und die Menschen, die ich von hier oben gar nicht sehen konnte, nur vermuten. Der Wald um uns herum existierte lediglich noch in Form einer wüst aussehenden Fläche, bestehend aus unzähligen umgeworfenen Tannen und Fichten. Vereinzelt standen hier und da noch zerzauste Reste. Obwohl es von diesem Weg sehr weit war ins Tal hinab, erkannte ich dort ebenfalls die Spuren der Verwüstung; kaputte Dächer, Bäume im Fluss. Ich begriff nicht, wie ein Wind so etwas zustande bringen konnte. Einzig, dass wir nun auf unseren täglichen Spaziergängen der heißen Julisonne ausgesetzt waren und nicht mehr im Schatten des kühlen Waldes wanderten, war für mich existent. Eine Nacht nur, und die Welt um mich herum hatte sich völlig verändert. Ich rutschte auf der Sitzbank ein wenig näher an Großvater heran. Er nahm meine Hand und drückte sie fest, als hielte er mich vor einer Unbedachtheit zurück.
»Weißt du, Heinrich, das hier …«, und seine linke Hand beschrieb einen Bogen um uns, »… das hier erinnert mich an eine Menge ...«
»An was denn, Opa?«
Meine Frage erreichte ihn nicht. Sein Blick war starr auf die Baumwüste vor uns gerichtet.
»Ist das nicht furchtbar, wie es hier aussieht?«
»Mh, alle Bäume sind kaputt. Und da unten die großen Masten, die sind auch kaputt.«
Die Kraft, die meine Hand hielt, ließ ein wenig nach und er rieb sich mit einem Taschentuch über das Gesicht. Schweiß bildete sich auf seiner Stirn, in den schlecht rasierten Grübchen am Kinn, zwischen den Falten an seinem Hals. Er gluckste, dann quollen plötzlich Tränen aus Opas Augen, kullerten die Wangen hinunter und fielen auf sein hellblaues Hemd. Mir stockte der Atem.
»Opa?«
Statt einer Antwort drückte er meine Hand und presste seine Lippen aufeinander. Wieder und wieder schüttelte er seinen Kopf, als wäre er verwundert oder verneinte eine bedeutsame Frage. Dann schluchzte er plötzlich los, ohne Halt, ließ meine Hand frei und drehte sich weg. Ich stand erschrocken auf und ging zum gegenüberliegenden Wegesrand. Da reckten sich Butterblume und Fingerhut in den weiten Himmel. Fingerhut, dachte ich, und rückte ein Stück ab. Vor dem mich Oma immer mit einem ‚Oweh‘ warnte. Wie gern hätte ich einmal diese schönen lilafarbenen Blüten berührt. Aber sofort bei Berührung müsste ich tot umfallen, so war meine Vorstellung. Ich drehte mich zu meinem Großvater, der sich an die Rückenlehne der Bank drückte und tief ein- und ausatmete.
»Opa?«
»Komm her, Heinrich.« Er winkte mich zu sich. »Setz dich wieder neben mich. Dann kannst du mich besser beschützen.«
Ich wusste nicht, wie ich diesen großen Mann beschützen sollte, aber ich setzte mich wieder neben ihn und starrte auf meine gelben Socken, die in kleinen Ledersandalen steckten. Ein kleines Steinchen hatte sich zwischen Fuß und Sohle geschlichen.
»Weißt du, als deine Mama auf die Welt kam, gab es einen großen Krieg. Und ich war da mittendrin.«
»Einen Krieg?«
»Ja, einen sehr großen und schrecklichen Krieg.«
»Was ist ein Krieg?«
Er musterte mich wie etwas, das man nicht alle Tage sah. »Na, du bist erst vier Jahre. Da weißt du natürlich nicht, was Krieg ist. Und ich hoffe, Du wirst es niemals erleben. Da passieren schlimme Dinge, in so einem Krieg. Die Menschen sind keine Menschen mehr.«
»Aber was sind sie dann?«
Ich dachte an so etwas wie Hunde. Spinnen fielen mir ein und Ameisen. Unwillkürlich bekam ich Angst und rutschte näher an meinen Großvater heran.
»Sie sind böse.«
Wieder starrte er hinunter ins Tal. Ich folgte seinem Blick. Da gab es nichts Aufregendes zu entdecken. Dann bemerkte ich seine Worte in meinem Kopf. ‚Sie sind böse‘, sagte er. Die Menschen im Krieg sind böse. Er war doch auch in diesem großen Krieg.
»Warst du auch böse, Opa?«
Er nickte leicht, dann stand er unvermittelt auf.
»Komm, wir gehen wieder zurück. Oma hat bestimmt schon Kaffee und Kuchen auf dem Tisch.«
Ich schüttelte meine Sandale aus, dann marschierten wir los. Die Sonne nun im Rücken, um uns herum all die umgeworfenen Bäume.
*
© by Caroline Dabrunz
Kapitel 2
Heinrich und Mamas Welt
Ein paar Tage später holte mich Mama nach dem Mittagessen vom Kindergarten ab und wir liefen hinunter nach Dillweißenstein. Ich freute mich, denn das hieß, etwas mit ihr zu unternehmen. Was, war mir völlig egal. Sie arbeitete den ganzen Tag in einer Schmuckfirma in Dillweißenstein und kam erst am Nachmittag heim. Ab und zu jedoch gewährte man ihr einen halben Tag frei, wenn gerade nicht so viel zu tun war. Meist nutzten wir diese Zeit, um in die Stadt zu gehen. Wir wohnten auf dem Sonnenberg, am südlichen Stadtrand, oberhalb von Dillweißenstein. Ich empfand einen Besuch der Stadt als aufregend, und es kribbelte jedes Mal in meinem Magen vor lauter Vorfreude. Die Stadt war immer voller Menschen, ich atmete tief ihre unzähligen Gerüche ein und lauschte den absonderlichsten Geräuschen. Alles um mich herum faszinierte mich, und doch schlich sich ebenso eine tiefe Angst in meinen Kopf. Die Furcht war verbunden mit einem Bild, ein Bild mit mir in dieser Stadt, nur ohne meine Mutter, die ich in keiner Ecke dieses Bildes entdecken konnte und die auf ewig darin verschwand. Ich fühlte mich gespalten, so voller Neugier in meiner linken Hälfte, und so voller Angst in meiner rechten. Weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, nahm ich ihre Hand fester zwischen meine Finger und dachte an ein kühles Softeis. Vielleicht spendierte sie mir sogar eine kleine Portion.
Vom Kindergarten an der Kirche war es nicht weit zum Bahnübergang der Nagoldtalstrecke, ab da ging es sehr steil ins Nagoldtal hinab und über die Steinerne Brücke. Ich blieb an der hohen Steinbrüstung stehen, um in den Fluss zu schauen, aber Mutter zog mich weiter.
»Heinrich, komm. Wir dürfen den Bus nicht verpassen. Der nächste kommt erst wieder in einer halben Stunde.«
»Ja, Mama.«
»Erzähl mir, wie es heute im Kindergarten war.«
»Nicht schön.«
Trotzdem der Bus nicht auf uns warten würde, blieb sie stehen und sah mich an. Die Nagold rauschte unter uns vorbei und ich dachte an die vielen Fische darin.
»Was ist passiert?«
»Die ärgern mich.«
»Wer ärgert dich?«
»Die anderen Kinder.«
»Aber doch nicht alle, oder?»
Ich schüttelte den Kopf.
»Komm«, sagte sie, »erzähl es mir im Bus.«
Wir hatten es gerade geschafft, die Hirsauer Straße zu überqueren, als der O-Bus der Linie 3 vor uns hielt. Erschrocken stellte ich fest, dass er voll war bis auf einen Platz. Meine Mutter löste die Fahrkarte und dirigierte mich zu der roten Sitzbank. Sie grüßte die alte Frau, die mit geschlossenen Augen auf der Bank saß und fragte, ob neben ihr noch frei sei. Sie nickte nur, meine Mutter setzte sich, hob mich auf ihren Schoß und umarmte mich fest. Summend und klackend setzte sich der Bus in Bewegung. Ich sah aus dem Fenster und spürte Mamas Mund ganz nah an meinem Ohr.
»Jetzt erzähl mal. Wer ärgert dich denn? Und warum ärgern sie dich?
»Ich darf nie mitspielen.«
»Bei was lassen dich die anderen Kinder nicht mitspielen?«
»Im Sand oder an der Schaukel oder drin bei den Bauklötzen. Aber ich will auch gar nicht mitspielen. Ich will alleine spielen und da lassen sie mich nicht in Ruhe.«
»Was sagt denn das Fräulein Gerber, wenn sie das sieht.«
»Ich darf dann bei ihr was basteln.«
»Schimpft sie denn nicht mit den anderen Kindern?«
»Sie sagt, dass sie mich mitspielen lassen sollen, aber die wollen nicht. Also will ich auch nicht.«
»Bist du wütend auf die anderen Kinder?«
»Mh.«
»Und was machst du, wenn du wütend bist?«
»Ich bin nicht lieb zu ihnen.«
»‘Nicht lieb‘, aha, und was tust du dann?«
»Ich hau sie.«
Der Mund meiner Mutter setzte fast auf meinem Ohr auf und ihr Griff um mich wurde ein wenig fester.
»Ignoriere die anderen Kinder. Die, die böse zu dir sind. Lass sie einfach links liegen. Geh vorbei und tu so, als wären sie gar nicht da. Hörst du? Wenn sie dich auf die linke Backe hauen, halte ihnen die rechte hin. Weißt du, was ich meine?«
»Nein, Mama.«
»Ich hab dir doch schon mal von Jesus erzählt. Weißt du noch?«
Ich nickte und sah kurz auf, in das Gesicht der alten Frau neben uns. Sie schlief.
»Jesus wurde von vielen verleugnet und geärgert und beschimpft. Aber er hat das einfach ignoriert. Sein Herz war viel zu stark, als dass so böse Worte und Lügen ihm etwas ausgemacht hätten. Er hat gesagt, dass man sich ruhig schlagen lassen kann, das sind nur körperliche Schmerzen. Seinen Glauben an den lieben Papa und seine Liebe zu uns Menschen konnte das nicht erschüttern. Und so musst du es machen. Sei stark und denk mal an das, was Jesus gemacht hat, wenn sie dich wieder ärgern. Versprichst du mir das?«
Ich versprach es ihr. Aber wie ich das machen sollte, war mir nicht klar, denn diesem Jesus war ich noch nicht begegnet, kannte ihn gar nicht, nur aus Mamas Erzählungen und denen von Oma. Und ob sein Papa, der liebe Gott, so lieb war, war mir ebenso unklar. Oma drohte mir jedenfalls dauernd, er würde mich bestrafen, denn er sähe alles, auch mein heimliches Nasebohren unter der Bettdecke. Es schien also egal zu sein, wer was erzählte oder wem ich etwas glaubte; ich war in jedem Fall auf mich gestellt.
Am Leopoldplatz stiegen wir aus dem Bus. Vor der Kaufhalle entdeckte ich die Softeismaschine und blickte sehnsüchtig in diese Richtung. Natürlich warteten wir genau vor dieser Maschine auf die Linie 11, die vom Arlinger kam und zum Gaswerk fuhr.
»Heute kann ich dir kein Eis kaufen, Heinrich. Wir müssen diesen Monat so viel sparen, wie nur möglich. Verstehst du das?«
Ich nickte und schaute dem Eismann zu, wie er seine Papiermütze zurechtsetzte und einem alten Mann ein rosafarbenes Erdbeereis in ein Hörnchen laufen ließ, die fünfzig Pfennig nahm und meinen sehnsüchtigen Blick auffing. Er zwinkerte mir zu. Ich drehte mich weg. Ignorieren, hatte Mutter gesagt. Ignorier die Dinge, die du nicht ändern kannst. Der Gelenkbus kam, wir stiegen ein, lösten die Fahrkarte und setzten uns nach ganz hinten.
»Gehen wir nicht in die Stadt?«
»Nein, wir fahren zu Tante Gerlinde. Sie hat Geburtstag. Ich hab gestern noch ein kleines Geschenk gekauft, das bringen wir heute hin und bleiben ein Weilchen. Vielleicht sind ihre Enkelchen da und du kannst ein bisschen mit ihnen spielen. Was meinst du?«
»Ja, Mama.«
Ich sah aus dem Fenster. Es war heiß hinter der Scheibe und kaum ein Luftzug im Bus. Der hintere Gelenkteil schaukelte auf und ab und das kribbelte im Bauch so stark, dass ich grinsen musste. Die Häuser der Östlichen zogen vorbei, bald entdeckte ich den großen Gaskessel. Der Bus fuhr in die Wendeschleife und wir stiegen aus. Das Haus war ein Backsteinbau aus dunkelroten Ziegeln, schmuddelig, heruntergekommen. Zwischen den Häusern hingen Wäscheleinen. Mülleimer und kaputte Fahrräder standen wahllos im Zwischenhof. Mir gefiel es hier ganz und gar nicht. Eine eigenartige Stimmung klebte unsichtbar an den schmutzig-roten Mauern und senkte sich auf mich herab, drückte mich fast zu Boden und nahm mir die Luft zum Atmen. Die Haustür war kaputt und im Treppenhaus roch es nach allem Erdenklichen. Tante Gerlinde wohnte im ersten Stock. Wir stiegen die Waschzement-Stufen nach oben und ich durfte die Messing-Klingel drehen. Es schrillte blechern hinter der Tür. Gerlinde öffnete schweigend und sah uns überrascht an, machte keine Anstalten uns hereinzulassen, sondern blieb einfach wie angewurzelt stehen.
»Hilde?«
Mama nickte und ich spürte plötzlich meine volle Blase, schlang die Beine umeinander und kniff das Becken zusammen.
»Hallo Gertrud, wir wollten dir zum Geburtstag gratulieren. Stimmt’s nicht, Heinrich?«
Ich nickte.
»Mama, ich muss mal ganz arg Pippi.«
Tante Gerlinde sah mich an.
»Na dann, kommt halt rein. Ich war gar nicht auf Besuch eingerichtet.«
Sie trat zögerlich beiseite und ließ uns an der offenen Tür stehen. Meine Mutter schob mich durch und zeigte mir die Toilette.
»Wasch dir die Hände danach«, sagte sie. Ich sah mich um. Ein grünes Bad, schmal, mit einer noch schmaleren Wanne aus Zinkblech, daneben ein zylinderförmiger Kohleofen. Über der Toilette hing der Wasserkasten und auf halber Höhe dazwischen ein Holzgriff mit einer Kette dran. Ich setzte mich auf die schwarze Brille und verrichtete mein Geschäft. Als ich die Hände wusch, fiel mir ein Rasierer rechts neben dem Wasserhahn auf. So einen, wie ihn mein Vater verwendete. Ich betrachtete ihn genauer und setzte den Rasierkopf auf meine Backe. Es fühlte sich kalt an. Schnell legte ich ihn zurück und verließ das Bad.
Mutter und Tante Gerlinde saßen in der Küche. Auf dem kleinen Holztisch lag etwas Rundes, in grünes Geschenkpapier eingewickelt.
»Wie alt ist er denn jetzt, der kleine Heinrich?«, wollte Gerlinde wissen.
»Im Januar wurde er vier.«
»So so, vier Jahre.«
Dann wieder Schweigen am Tisch. Mutter deutete mit ihrer Hand auf den freien Stuhl an der Stirnseite und ich setzte mich drauf.
»Bist du denn schon im Kindergarten?«
»Mh.«
»Und? Gefällt es dir dort?«
»Manchmal. Die sind oft böse zu mir.«
»Böse?« Sie sah mich an mit kleinen, fast schwarzen Augen. Ihr Blick war unheimlich und ich versuchte auf ihre Falten zu schauen, nicht in diese furchteinflößenden dunklen Knöpfe.
»Da gibt es noch mehr, die böse sind. Gar nicht so weit weg von dir.«
»Sag das nicht!«
Ich verstand nicht, was sie meinte, aber an Mamas Tonfall war schon zu erkennen, dass irgendwas an Gerlindes Satz nicht in Ordnung war.
»Was denn, Hilde? Ich kann doch sagen, was ich will und was ich denke! Meine Schwester hätte nicht mehr heiraten sollen. Zumindest jemand anderen.«
Als Bestätigung klopfte sie mit den Fingerknöcheln der rechten Hand auf die Tischdecke. Ich versuchte, in ihrer Küche etwas zu entdecken, was mein Interesse zu wecken imstande war, aber alles hier drin mündete in einer großen Trostlosigkeit. Belanglos. Alles war Zweck. Nichts was Wärme ausstrahlte oder Geborgenheit. Hier drin war es kalt. So kalt wie Gerlindes dunkle Knopfaugen.
»Ich hatte gehofft, Brigitte hier anzutreffen und vielleicht Monika und Andreas. Heinrich hätte sicher gerne mit ihnen gespielt. Wie geht es Brigitte denn?«
Meine Mutter gab nicht auf. Sie war wie ich mir einen Engel vorstellte. Egal wie abstoßend die Umgebung war, sie hatte eine Mission zu erfüllen; nämlich den Menschen Worte, Fragen und Interesse anzubieten. Sie damit aus ihrer Kälte zu lösen, aus der Einsamkeit ans Licht zu holen. Aber die Menschen wollten offenbar nicht.
»Du weißt doch, dass wir nicht mehr miteinander reden. Seit Kurt tot ist, macht sie sich rar. Warum fragst du nach ihr?«
»Es hätte ja sein können, dass an deinem Geburtstag …«
»Nein. Hätte nicht.«
»Ach, Tante Gerlinde …«, seufzte Mama.
»Ich habe meine Tochter nicht weg geschickt. Sie ist von sich aus weg. Und ich brauche niemanden.«
»Natürlich brauchst du jemanden. So wie wir alle. Jeder von uns braucht Menschen zum Reden, zum Kümmern. Ist es nicht so, Heinrich?«
Sie sah mich an.
»Ja, Mama.«
Tante Gerlinde fixierte mich, dann Mama. Für einen kurzen Moment gaben ihre Falten ein wenig nach, wurden weich wie warmes Kerzenwachs. Meine Mutter stieß nach.
»Ich könnte dich öfter besuchen. Jeden Mittwoch habe ich schon um drei Uhr Feierabend, und samstags wäre mir die Uhrzeit egal. Was meinst du?«
Mutters Gesicht leuchtete. Sie war die Sonne in dieser Küche. Aber auf Tante Gerlinde machte das nur kurz Eindruck. Ihr Gesicht verhärtete sich wieder.
»Ich habe leider nichts zu essen da für euch«, sagte sie knapp. »Und vielleicht ist es auch besser, ihr geht jetzt wieder«, fuhr sie fort. So dunkel wie diese Küche, war nun auch ihre Stimme. Mamas Sonnenstrahlen erreichten sie nicht. Es blieb kalt. Mich fröstelte.
»Gehen wir, Mama?«, fragte ich in die Stille.
Gerlinde fixierte mich.
»Der kleine Heinrich hat es verstanden. Es gibt nichts zu reden und nichts zu heilen.«
*
© by Caroline Dabrunz
Kapitel 3
Heinrich und der Garten
Der Pfirsichbaum war groß, die Früchte wie unförmige Bälle über mir. Zwischen den Blättern Ameisenkolonnen, summende Käfer und suchende Fliegen. In meiner Hand hielt ich einen der Pfirsiche, betrachtete ihn eingehend. Am rauen Stiel noch ein Blättchen. Dann biss ich hinein. Fest und saftig, sein Fleisch leicht grünlich, der Duft in meiner Nase war wie das Öffnen einer Schatztruhe. Konnte es etwas Schöneres geben? Ich stellte mir vor, den Baum leer zu essen, eine Badewanne voller Pfirsiche für mich zu haben, aus dem Duft einen Zaubertrank zu machen, wie ihn Merlin benutzte, um das Böse zu bekämpfen. Der Boden unter mir war so warm und weich, das Moos um den Baumstamm feucht und hellgrün. Auf der Wiese brummten die Hummeln vom roten zum weißen Klee, landeten auf Gänseblümchen, die sich unter dem Gewicht bogen; und als die Hummeln, davon ganz überrascht, aufflogen, streckten sich die kleinen Schönheiten erneut dem Licht entgegen.
Ein zweiter Biss. Ich schlürfte den Saft aus der Kuhle, schmatzte und wunderte mich über die vielen winzigen Härchen auf der Pfirsichhaut. Warum spürte ich sie mit dem Finger und nicht mit der Zunge? Ein Schatten verstellte mir den Blick in den Baum. Mein Onkel. Er grinste.
Blitzschnell streckte er mir die zu einer Kugel geschlossenen Hände entgegen, stoppte unmittelbar vor meiner Nase und nahm die obere Hand weg. Ein dicke Spinne mit endlos langen Beinen, Haaren und Klauen am Kopf saß in der anderen Hand. Grau, braun, starrend. Fast konnte ich sie mit der Nasespitze berühren. Ich schrie und krabbelte unter ihm hindurch, kam auf die Beine und rannte, was die Füße hergaben. Ein anhaltendes Rufen stellte klar, dass er mir folgte.
»Die Spinne!«, rief er, »die Spinne kommt!«
»Oma!«, schrie ich und rannte um das ganz Haus, immer wieder. Treppe hoch, an der Hecke vorbei, andere Treppe runter. Meinen Onkel im Nacken. An einer Ecke sah ich zu ihm. Die Spinne hielt er fest und schüttelte den Arm. Dann fiel sie auf den Boden und er hatte nur noch zwei Beine zwischen den Fingern.
»So ein Pech«, sagte er enttäuscht. Ein wenig ungelenk wollte sie fliehen. Mein Onkel zerquetschte sie unter seiner Sandale. Voller Ekel erinnerte ich mich, dass er mit diesen Schuhen schon bei uns in der Wohnung war. Er lachte herzhaft.