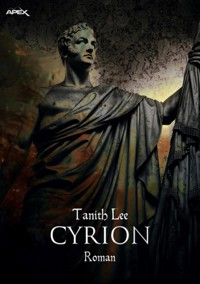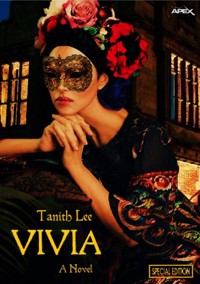8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zu jener Zeit, da die Erde noch keine Kugel, sondern eine flache Scheibe war, hausten Dämonen unter der Oberfläche und suchten Städte und Königreiche heim, um ihre Lust am Bösen zu stillen.
Unter ihnen waren zwei, die noch verwerflicher und mächtiger waren als alle anderen: Ashrarn, der Herr der Nacht, und Uhlum, der Herr des Todes. Ihre erotischen Exzesse, ihre abgefeimten Intrigen und magischen Ränke geißelten die Erdenmenschen, Männer wie Frauen.
In diesem Reigen von Königinnen und Hexen, Herrschern und Beherrschten reifen zwei Knaben zu Männern heran - und die Herrscher der Finsternis treiben ihr grausames Spiel mit ihnen.
Er öffnen sich Abgründe von Hexerei, teuflischer Magie und übernatürlichen Visionen, gegen die die sagenhaften ERZÄHLUNGEN AUS 1001 NACHT zu einem Kindergeburtstag verblassen...
Der fünfbändige Zyklus von der Flachen Erde gilt als Tanith Lees populärste Fantasy-Serie und überdies als Klassiker der Fantasy-Literatur.
»Tanith Lee ist eine der stärksten und intelligentesten Erzählerinnen auf dem Gebiet der Heroic Fantasy.«
(Publisher's Weekly)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
TANITH LEE
Herr des Todes
Zweiter Roman von der Flachen Erde
Tanith Lee-Werkausgabe, Band 8
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
Das Buch
HERR DES TODES
ERSTES BUCH
TEIL EINS: Narasen und Tod
TEIL ZWEI: Das weinende Kind
TEIL DREI: Der Meister der Nacht
TEIL VIER: Sie, die fortlebt
TEIL FÜNF: Granatapfel
ZWEITES BUCH
TEIL EINS: Der Garten der Goldenen Töchter
TEIL ZWEI: Tods Feinde
TEIL DREI: Zhirek, der dunkle Zauberer
TEIL VIER: In Simmurad
TEIL FÜNF: Brand
EPILOG: Das reisende Haus
Die Autorin
Tanith Lee.
(* 19. September 1947, + 24. Mai 2015).
Tanith Lee war eine britische Horror-, Science Fiction- und Fantasy-Schriftstellerin und Verfasserin von Drehbüchern. Sie wurde viermal mit dem World Fantasy-Award ausgezeichnet (2013 für ihr Lebenswerk) und darüber hinaus mehrfach für den Nebula- und British Fantasy-Award nominiert.
Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie über 90 Romane und etwa 300 Kurzgeschichten. Sie debütierte 1971 mit dem Kinderbuch The Dragonhoard; 1975 folgte mit The Birthgrave (dt. Im Herzen des Vulkans) ihr erster Roman für Erwachsene, der zugleich auch ihren literarischen Durchbruch markierte.
Tanith Lees Oevre ist gekennzeichnet von unangepassten Interpretationen von Märchen, Vampir-Geschichten und Mythen sowie den Themen Feminismus, Psychosen, Isolation und Sexualität; als wichtigsten literarischen Einfluss nannte sie Virginia Woolf und C.S. Lewis.
Zu ihren herausragendsten Werken zählen die Romane Trinkt den Saphirwein (1978), Sabella oder: Der letzte Vampir (1980), Die Kinder der Wölfe (1981), Die Herrin des Deliriums (1986), Romeo und Julia in der Anderswelt (1986), die Scarabae-Trilogie (1992 bis 1994), Eva Fairdeath (1994), Vivia (1995), Faces Under Water (1998) und White As Snow (2000).
1988 gelang ihr mit Eine Madonna aus der Maschine (OT: A Madonna Of The Machine) ein herausragender Beitrag zum literarischen Cyberpunk; eine Neu-Übersetzung der Erzählung wird in der von Christian Dörge zusammengestellten Anthologie Cortexx Avenue enthalten sein.
Ihre wichtigsten Sammlungen von Kurzgeschichten und Erzählungen sind: Red As Blood/Tales From The Sisters Grimme (1983), The Gorgon And Other Beastly Tales (1985) und Nightshades: Thirteen Journeys Into Shadow.
Tanith Lee war seit 1992 mit dem Künstler John Kaiine verheiratet und lebte und arbeitete in Brighton/England.
Sie verstarb im Jahre 2015 im Alter von 67 Jahren.
Der Apex-Verlag widmet Tanith Lee eine umfangreiche Werkausgabe.
Das Buch
Zu jener Zeit, da die Erde noch keine Kugel, sondern eine flache Scheibe war, hausten Dämonen unter der Oberfläche und suchten Städte und Königreiche heim, um ihre Lust am Bösen zu stillen.
Unter ihnen waren zwei, die noch verwerflicher und mächtiger waren als alle anderen: Ashrarn, der Herr der Nacht, und Uhlum, der Herr des Todes. Ihre erotischen Exzesse, ihre abgefeimten Intrigen und magischen Ränke geißelten die Erdenmenschen, Männer wie Frauen.
In diesem Reigen von Königinnen und Hexen, Herrschern und Beherrschten reifen zwei Knaben zu Männern heran - und die Herrscher der Finsternis treiben ihr grausames Spiel mit ihnen.
Er öffnen sich Abgründe von Hexerei, teuflischer Magie und übernatürlichen Visionen, gegen die die sagenhaften ERZÄHLUNGEN AUS 1001 NACHT zu einem Kindergeburtstag verblassen...
Der fünfbändige Zyklus von der Flachen Erde gilt als Tanith Lees populärste Fantasy-Serie und überdies als Klassiker der Fantasy-Literatur.
»Tanith Lee ist eine der stärksten und intelligentesten Erzählerinnen auf dem Gebiet der Heroic Fantasy.«
(Publisher's Weekly)
HERR DES TODES
ERSTES BUCH
TEIL EINS: Narasen und Tod
1.
Narasen, die Leopardenkönigin von Merh, stand an ihrem Fenster und sah dabei zu, wie die Pest, die Große Dame, in der Stadt umherging. Lady Pest trug ihr gelbes Gewand: Gelb wie der Staub, der von der Prärie aufwirbelte und die Stadt Merh bedeckte und erstickte, gelb wie der stinkende Schlamm, in den der breite Fluss von Merh sich verwandelt hatte. Und Narasen, die machtlos und wütend war, sagte in ihrem Innern zur Pest: »Was muss ich tun, um dich loszuwerden?« Und die nur schwach sichtbare Frau entblößte ihre Zähne und verzog das Gesicht zu einer Grimasse, als ob sie antwortete: »Du weißt es, vermagst es jedoch nicht zu tun.« Und dann trug der Staubsturm sie davon, und Narasen warf die Fensterläden zu.
Das Schlafgemach der Königin von Merh war in folgender Weise eingerichtet: Glänzende Jagd- und Kriegswaffen hingen an den mit Jagd- und Kriegsszenen bemalten Wänden. Der Boden war mit gefleckten und gestreiften Fellen wilder Tiere bedeckt, die Narasen erlegt hatte, und in dem Bett lag des Nachts oft ein hübsches Mädchen: Narasens derzeitige Liebe. Der König von Merh, Narasens Vater, hatte sie ausgebildet und erzogen, als ob sie eher Sohn denn Tochter sei, um sie darauf vorzubereiten, nach ihm zu regieren, und das war ihrer Neigung sehr entgegengekommen.
Doch sie besaß die Schönheit einer Frau.
Eines Mittags, ein Jahr zuvor, war Narasen mit ihren auserwählten Gefährten über die Prärie geritten, um den Leoparden zu jagen. Ihr Jagdgeschirr war von Gold und Weiß, und ihre weißen Windhunde rannten neben ihrem Streitwagen her wie Schnee auf Beinen. Ein Kopfschmuck aus Golddrähten und Perlen hielt ihr rosenrotes Haar zusammen, damit es ihr nicht ins Gesicht fiel, und ihre Augen glichen dem Tier, das sie jagte. Aber es sollte an jenem Tag keine Leoparden zu erlegen geben. Die Jagdwagen erreichten eine Biegung des damals kühlen und dunklen Flusses, an dessen Ufer große Bäume wuchsen. Als die Hunde tranken, entdeckten Narasens Gefährten einen jungen Mann, der unter einem Baum saß. Er war hübsch und angenehm anzuschauen und saß allein da, ohne Begleitung oder Wache, obgleich er reich gekleidet war. An seiner Seite lag ein Stab aus weißem Holz mit zwei grünen Smaragden im Knauf.
»Bringt ihn her zu mir!«, sagte Narasen, nachdem man ihr berichtet hatte, und er säumte nicht zu kommen. »Nun, was hat das zu bedeuten?«, fragte sie. »Du befindest dich innerhalb der Grenzen von Merh, bist aber, wie ich glaube, kein Einwohner von Merh, und du sitzt hier allein in deinem Staat. Hat dich niemand gewarnt? Wilde Tiere kommen, um hier am Fluss zu trinken, und sie haben eine feine Nase für Menschenfleisch, und Räuber leben in diesem Land wie in jedem anderen, und die haben eine feine Nase für Juwelen.«
Der junge Mann verbeugte sich und starrte sie auf eine bestimmte Weise an, die sie gelegentlich zuvor gesehen hatte, die man nicht missdeuten konnte. Seine Augen wurden dunkler. Doch sprach er höflich.
»Mein Name ist Issak: Ich bin ein Magier und der Sohn von Magiern. Ich fürchte weder Tiere noch Menschen, denn ich kenne Zauber, um sie zu zähmen.«
»Dann bist du wohl ein Glückspilz. Oder ein Aufschneider«, sagte Narasen. »Komm, gib mir einen Beweis!«
Der junge Mann verbeugte sich abermals. Dann hob er den Stab auf, der sich in eine weiße Schlange mit grünen Augen verwandelte, die sich dreimal um seinen Hals wickelte. Danach stieß er einen Pfiff aus, und plötzlich wurde das Wasser des Flusses von tausend glänzenden Klingen durchschnitten, und alle seine glänzenden Fische sprangen in die Höhe. Und dann stieß er einen neuen, anderen Pfiff aus, und Vögel fielen von den Bäumen wie Blätter und ließen sich auf seinen Schultern und Händen nieder.
Narasens Gefährten waren entzückt und applaudierten ihm. Aber Narasen, die sah, wie er sie immer noch ansah, und es nicht mochte, sagte: »Nun bring mir einen Leoparden!«
Sofort flogen die Vögel davon, und die Fische sanken wie Steine. Der junge Mann, der sich Issak nannte, heftete seinen Blick auf sie, wobei er die Stirn runzelte, und pfiff zum dritten Mal. Durch den Schatten der Bäume schritten zehn goldene Leoparden, die mit dem Schatten und ihren eigenen schattenhaften Flecken besprenkelt waren, und jeder hatte die Augen von Narasen. Narasen lächelte und verlangte nach ihren Speeren. Aber als sie ihren Arm zum Wurf zurückbog, zog der junge Mann die Schlange von seinem Hals und warf sie von sich. Sofort wurde die Schlange wieder ein Stab, der mit der Spitze nach unten im Sand der Uferböschung steckenblieb. Die zehn Leoparden verschwanden.
»So war es also nur eine Illusion«, sagte Narasen, »ein Trick. Ich mag es nicht, wenn man mich mit Gaukeleien betrügt.«
Darauf lächelte Issak ebenfalls. Sehr sanft sagte er: »Was immer es auch war, schönste Königin von Merh, ich glaube, dass du es nicht vermagst.«
Daran fand sie keinen Gefallen: erzählt zu bekommen, was sie zu vollbringen vermochte und was nicht. Sie wandte sich ab und sagte zu einem ihrer Wächter: »Gib diesem Gaukler ein paar Münzen. Er sieht ausgehungert aus, und wahrscheinlich ist sein Aufputz auch nur eine Illusion.«
Issak lehnte das Geld ab. Er sagte: »Keine Summe wäre genug. Ich begehre eine andere Belohnung, denn es ist etwas anderes, wonach ich hungere.«
»Und was ist das?«
»Die Königin von Merh.«
Niemals in ihrem Leben hatte ein Mann gewagt, in dieser Weise zu Narasen zu sprechen. Es machte sie wütend, und irgendwo tief in ihrem Inneren wurde ihr unbehaglich.
»Nun,«, sagte sie indessen leichthin, »da du offensichtlich von einem Barbarenvolk abstammst und unsere zivilisierten Bräuche nicht verstehst, werde ich dich nicht auspeitschen lassen.«
»Narasen mag mich schlagen«, sagte er, »aber kein anderer.«
Einer von Narasens Hunden, der ihren Ärger spürte, begann
Issak anzuknurren. Doch Issak, der Magier, streckte die Hand nach ihm aus, worauf der Hund sich stattdessen hinlegte und einschlief.
»Und jetzt«, sagte Issak, »muss Narasen, die Schöne, dies vernehmen. Sie kann ebensoleicht bezähmt werden wie ihr Hund. Trotz deiner Worte, Lady, und ungeachtet deines Standes regt sich bei deinem Anblick Liebe in mir. Heute Nacht werden wir beisammen liegen, und es gibt nichts, womit du es verhindern könntest.« Als er diese Worte sprach, nahm das Gesicht des jungen Mannes jedoch weder Überheblichkeit noch Begierde, sondern einen Ausdruck von Trauer und Schmerz an.
Narasen schnalzte mit den Fingern nach ihrer Wache, die vorschoss, um Issak, den Magier, festzusetzen. Aber irgendwie: Wo ihre Hände hinlangten, dort war er nicht - er schien zu verschwinden, wie es die Leoparden getan hatten, und obgleich Narasens Wache noch eine gute Weile den Weg auf und ab suchte, wurde er nicht gefunden.
Verwirrt kehrte Narasen in die Stadt zurück. Sie war nicht ungerecht, obwohl sie grausam sein konnte; jetzt trug sie Verlangen nach genauer Bezahlung für die Anmaßung des Fremden. Sie glaubte auch, dass er beabsichtigte, sein Versprechen ihr gegenüber einzuhalten, und vermutlich, wenn sie sich ansah, wie geschickt er im Zaubern war, hatte er einige Aussicht auf Erfolg. In ihr war keine Liebe zu den Körpern von Männern, doch wenn er sich ihr auf eine andere Weise genähert hätte, mochte sie sich seiner erbarmt haben. Dann erinnerte sie sich an die wunderliche Tragik, die sich auf seinem Gesicht abzeichnete, den Ausdruck von Verzweiflung und Schmerz... Narasen stieß ihre Bronzetüren mit einem Knall auf und rief nach ihren eigenen Zauberern.
Die Nacht öffnete ihre schwarzen Blüten; unten blühten die Blumen-Gärten-Fenster der von Laternen beleuchteten Stadt. In Narasens Palast wurden die Wachen an den Toren verdoppelt und erhielten den Befehl, nach Fremden Ausschau zu halten. Vor den Gemächern der Königin standen zwei riesige Männer mit Messingkeulen, die sich gegenseitig angrinsten und darauf hofften, dass es Schwierigkeiten geben würde, damit sie Gewalt anwenden könnten. An der Innentür hingen auf Anraten der Palastzauberer der Schädel einer Hyäne und andere abstoßende Amulette. Innerhalb der Räume schwebten unbekannte Räucherdüfte.
Narasen verfiel jedoch, als die Nacht voranschritt und tiefer und stiller wurde, ebenfalls in Schweigen und begann, an sich selbst zu zweifeln. Von den hohen Fenstern herab beobachtete sie das Erlöschen der Blumen-Lichter, jetzt eine scharlachrote Blüte, nun eine goldene, die von blauen Fingern des friedvollen Dunkels gepflückt wurden. Sie dachte an die Zauberer, die im Vorzimmer stümperhaft ihre Sprüche leierten. Sie dachte an das Mahl, das sie mit einem Fluch weggeschickt hatte, und an das Mädchen mit flachsblondem Haar, das in diesem Monat ihr Bett teilte. Und dann dachte sie an Issak, den Magier, und sie lachte vor sich hin, über ihn, seine geschickten Vorspiegelungen, seine Aufschneidereien, seine Begierde. Fast bemitleidete sie ihn.
So ging sie hinaus ins Vorzimmer, und durch den purpurroten Rauch der Kohlebecken sah sie, dass die Zauberer während ihrer Arbeit in Schlaf gesunken waren; der Boden war mit Instrumenten, Knochenstückchen, silbernen Morgensternen und Schnüren aus polierten Perlen übersät. Dann ging sie hinüber zu den Bronzetüren und öffnete sie, und da standen die zwei riesigen Männer, unbeweglich wie alte Bäume, und obgleich ihre Augen weit offenstanden, sahen sie nichts. Im Korridor flog ein grüner Vogel auf und ab. Einen Augenblick, nachdem Narasen die Flügeltür geöffnet hatte, flog der grüne Vogel an ihr vorbei geradewegs ins Vorzimmer. Und dort schüttelte er sein Gefieder und verwandelte sich in einen grünen Edelstein, der zu Boden fiel. Und der Edelstein brach entzwei und ein glänzender Strahl schoss daraus hervor. Als der Strahl sich auflöste, stand dort Issak, der Magier.
Er sah Narasen an, und sein Gesicht war bleich. In seiner Hand trug er eine seltene blaue Rose der Art, von der oft geredet, die aber selten gesehen wurde, und diese bot er Narasen an. Als sie sie nicht annahm, sagte er: »Wenn du Saphire bevorzugst, so soll es sein.«
Narasen war nahezu sprachlos, doch sie sprach nichtsdestotrotz. »Deine Magie ist wahrlich bemerkenswert. Soll ich als nächstes verzaubert werden?«
»Wenn du nicht in meine Liebe einwilligst.«
Narasen betrachtete ihn, sein weißes Gesicht und seine Hände, in denen der Stiel der Rose zitterte.
»Ich lege mich nicht zu Männern«, sagte Narasen.
»Heute Nacht... wirst du es tun.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht«, sagte sie. »Trink mit mir, und wir werden darüber reden.« Dann ging sie - da er keine Anstalten machte, sie zurückzuhalten - zu einem Weinschrank und goss ihm ein reichliches Maß ein, füllte ihren eigenen Becher jedoch mit einem harmlosen Datteltrank. »Nun«, sagte Narasen, während sie ihm zusah, wie er langsam trank, »erzähl mir eines. Deine Zauberkunst ist immens, doch anstatt sie anzuwenden, schmeichelst du mir. Du sprichst von Verlangen und trägst doch in deinem Gesicht die Blässe eines Mannes in Furcht oder Leid. Du umwirbst mich mit Geschenken und beabsichtigst doch, mich zu zwingen, wenn du kannst. Warum nicht das eine oder das andere?«
Issak nahm einen tiefen Zug, und sein bleiches Gesicht rötete sich.
»Ich will es dir sagen, Narasen, du Schöne«, sagte er. »Ich bin, wie du sehr wohl weißt, ein Magier, und ich hatte Verkehr mit Dämonen-Art, besonders mit den Drin, dem hässlichen Zwergenvolk der Unterwelt. Ich wünschte meine Kräfte zu steigern, und diese Drin führten mich zum Haus eines besonderen Magus, weit älter und geschickter, als ich es bin, und sie sagten, er würde mich lehren. Aber die Drin standen mehr auf der Seite dieses Schurken, denn er war der größere Bösewicht. Er handelte mit mir aus, dass er für meine Unterrichtung jede Nacht einmal mit mir schlafen würde. Nun war ich jung und dumm und begierig darauf, mächtig und weise zu werden, und so schien es mir, dass die Wonnen und Missbräuche des Fleisches nichts seien, verglichen mit dieser Macht und Weisheit. So stimmte ich zu, obwohl er verdorben, alt und viehisch war. Darauf erduldete ich ihn jede Nacht. Einen ganzen Monat lang war ich sein Schüler bei Tag, sein Buhle bei Nacht. Es schien schon ein genügend hoher Preis, doch wusste ich nicht, wie hoch der Preis war. Denn jedes Mal, wenn seine Waffe in mir stak, kamen seine Geilheit und seine Sünde ebenfalls, drangen mit seinem Samen in mein Inneres und von da in mein unwissendes Fleisch, meinen Körper und meine Seele. Und jedes Mal, wenn dies geschah, wurde mir ein Jahr seiner üblen Existenz angehängt, und dafür nahm er mir ein Jahr meines Lebens, um seines zu verlängern. Solcherart war sein Zauber, und das erzählte er mir, als ich es auf die Dauer nicht länger hinnehmen wollte. Du verlässt mich, Issak, sagte er, ein Magier, der nun mit einem Teil meiner glänzenden Kunst ausgestattet ist. Aber obgleich deine Erscheinung die eines gesunden Jünglings sein mag und es ja auch deiner Anlage entspricht, ein solcher zu sein, stecken meine Grillen und Laster in dir, und von Zeit zu Zeit wirst du dich in Handlungen ergehen, an denen ich Gefallen fand, wirst ein Mädchenschänder und Menschenräuber. Doch klage nicht, du sollst nicht lange belästigt werden. Dreißig Jahre hast du meiner Lebensspanne hinzugefügt, nur drei Jahre deines Lebens sind dir noch belassen. Sieh nur zu, dass sie fröhlich werdend. Und auf diese Weise«, sagte Issak, wobei er den halbvollen Weinbecher fallen ließ, »ist es mit mir genauso, wie er gesagt hat. Nachdem ich dich gesehen habe, ist es das Vermächtnis seines heißen Eifers, das mich hierherbringt. Die blaue Rose ist allein mein Gastgeschenk bei diesem Besuch.« Dann legte er seinen Kopf auf seinen Arm wie ein Kind und weinte.
Narasen sagte hart: »Du musst dieser Verhexung widerstehen.«
»Ich habe es versucht«, stöhnte Issak. »Es hat mir nichts genützt.«
»Komm, weine nicht!«, sagte Narasen. Mitleid und Verachtung vermischten sich in ihr, und sie vergaß die Gefahr. Sie ging zu ihm und legte auf schwesterliche Art die Hand auf seine Schulter. Zu spät sah sie, dass seine Tränen plötzlich trocken waren, und in diesem Augenblick riss er sie an sich.
Narasen war kein Schwächling und geschmeidig, aber der Jüngling war außergewöhnlich stark. Er zog sie zu Boden. Sein Gesicht war verändert, blutvoll, erhitzt wie das Gesicht eines Trinkers oder eines Verrückten, und durch die ungetrübten Augen schienen die Augen eines anderen zu starren.
Mit eiserner Hand hielt er sie fest, und mit der anderen Hand riss er ihr die Kleidung weg, als ob sie aus Papier wäre. Und nun hechelte er wie ein Hund, und sein Speichel tropfte auf ihre Brüste.
Aber Narasen war nicht so unschuldsvoll zum Weinschrank gegangen, wie es geschienen hatte, denn in dem Schrank hatte sie ein scharfes kleines Messer, mit welchem sie die Siegel der Weinkrüge aufzubrechen pflegte. Und als der junge Mann sich auf ihrem Körper wand und darum kämpfte, in sie einzudringen, änderte Narasen ihre Haltung, als ob sie dahingeschmolzen sei.
»Oh, so habe ich weitaus größeres Gefallen an dir«, sagte sie, »nicht winselnd, sondern beherrschend. Komm sei mein Meister, mein Liebling! Lass nur meine Hände los, und ich werde dir ins Tor helfen.«
Issak ließ jedoch nur ihre linke Hand frei und hielt die andere fest. Daraufhin küsste sie sein Gesicht und streichelte ihn, so dass er kurz darauf vergaß, sie festzuhalten. Da zog sie ihr Messer aus dem Ärmel und stach ihn damit durchs Ohr.
Laut schreiend vor Schmerz fiel er von ihr auf die Seite, aber Narasen kannte nun keine Gnade mehr. Sie lief zur Wand, riss einen ihrer Jagdspeere herunter und trieb ihn mit solcher Gewalt durch sein Herz, dass die Spitze seinen Körper durchbohrte und unter ihm in den Boden drang.
Er starb nicht auf der Stelle. Stattdessen fand eine unangenehme Veränderung mit ihm statt. Er wurde welk und verfault, und seine Anmut rann von ihm ab wie Wasser aus einem zerbrochenen Gefäß. Dies war, wozu sein Mentor ihn gemacht hatte; nur die klugen Zaubereien, die Issak gelernt hatte, hatten ihm den Anschein von Jugend und Schönheit bewahrt, die von Rechts wegen sein gewesen wären. Nun, da er abscheulich anzusehen war, schien der abscheuliche Charakter jenes anderen vollständig von ihm Besitz ergriffen zu haben. Als ob er keinen Schmerz litte, grinste er und frohlockte gegenüber Narasen:
»Also, meine armseligen drei Jahre enden auf deinem Palastboden. Du bist ein liebloser Handlanger des Schicksals. Aber nun werde ich dir dein eigenes Schicksal verkünden, Narasen von Merh, denn ich habe gerade noch die Kraft, dich mit meinem Fluch zu belegen, und du kannst mich nicht zum Schweigen bringen. Du liebst es nicht, mit Männern zu schlafen, und diese Abneigung soll dir große Freude bescheren. Tatsächlich soll das Land Merh innerhalb des kommenden Jahres viele Freuden kennenlernen. Zuerst werden die Sturmwinde kommen, und sie werden die drei Dürren nach Merh blasen, welche die Menschheit am meisten fürchtet: Dürre des Wassers, Dürre der Milch der Herden und Dürre der Fruchtbarkeit in den Leibern aller weiblichen Wesen. Ein unfruchtbarer Ort wird dies dann sein, ausgehungert und trocken, seine Flüsse in Schlamm verwandelt und gelber Staub auf den Lippen und in den Augen, und kein Kind, das neu geboren wird, und kein Tier. Unfruchtbar wie der Leib der Königin soll Merh werden. Hungersnot und Pest werden in den Straßen sitzen und um die Leben der Sterblichen würfeln. Die Menschen werden nach Omen flehen, werden die Götter anflehen, sie zu erlösen, sie zu unterweisen, wie sie die Leiden, von denen sie befallen wurden, abwenden können, ihnen zu verkünden, wann das Verderben enden wird. Und das Orakel wird ihnen antworten: Merh wird Narasen sein. Wenn Narasen, die Schöne, ein Kind gebären wird. Wenn Narasen aufhört, unfruchtbar zu sein, wird das Land wieder blühen. Wenn Narasen fruchtbar ist, dann wird das Land Frucht tragen. Und dann, oh, Königin, werden sie kommen und an die Palasttore hämmern und verlangen, dass du mit Männern schläfst. Und dann, oh, Königin, wirst du zu deiner Demütigung und deiner Schande und deinem Ekel unter all den Männern liegen, du wirst dich in deiner Verzweiflung wie eine Hure jedem Mann hingeben, dem Prinzen, dem Gemeinen, dem Schweinetreiber, dem vorbeiziehenden Fremden. Alle werden an deine Türe kommen und eintreten, aber kein Andenken hinterlassen. Denn hier sitzt der Stachel im Schwanz dieses Fluchs. Dein widerstrebender Leib wird sich niemals von dem Samen irgendeines lebenden Mannes beleben lassen. Unfruchtbar wirst du bleiben, und mit dir wird das Land unfruchtbar bleiben. Niemals wirst du vom Samen irgendeines lebenden Mannes Frucht tragen, und dein Königreich wird untergehen. Merh wird Narasen sein. Und wenn dein Volk dich nicht erschlägt, wirst du als Ausgestoßene über die Erde wandern. Und wenn du dahinwanderst, denk an Issak!«
Dann schien er nach hinten in den Boden hinein zu versinken, und in seinen Augen regte sich eine unerwartete Bitterkeit, und er flüsterte: »Doch es war das Gift meines alten Lehrers, das mich dazu brachte, dich zu verfluchen. Issak allein würde dich niemals verflucht haben, Geliebte, nicht einmal mit deinem Speer in seinem Herzen.«
Darauf floss Blut Lippen anstelle von Worten von seinen Lippen, und sein Leben floss hinterher.
Als sich das Verderben ankündigte, war Narasen zuerst vollkommen niedergeschlagen. Aber sehr bald schon vergrub sie die Erinnerung an den Fluch in ihrem Innern, wie die Leiche Issaks schon bald in die Erde gesenkt wurde. Es war ein unbezeichnetes Grab, an einer Stelle jenseits der Stadtmauern, wo man die Leichen der Verbrecher hinwarf. Aber das Begräbnis des Fluches in der Seele Narasens hinterließ seine Spuren. Teile von ihr vergaßen nicht, und kurz darauf hatte sie guten Grund, sich daran zu erinnern.
Innerhalb eines Monats kamen die in den ockerfarbenen Staub der Prärie gekleideten Winde, und die Stadt Merh verwandelte sich in eine kleine Hölle. Und nach den Winden trank die Dürre die Flüsse leer, und die Herden konnten nicht mehr getränkt werden, und die Euter der weiblichen Tiere wurden schlaff. Und als nächstes konnten die Frauen ihren Neugeborenen keine Milch mehr geben, und dann gab es keine Säuglinge mehr, die die Milch hätten gebrauchen können, denn alle die noch geboren wurden, waren Totgeburten, und danach schwoll keiner einzigen Frau mehr der Bauch in ganz Merh. Noch gab es Regen. Die Hitze des Jahres schwoll an, und es gab nur Missernten. Hungersnot hielt Einzug, und die Pest tanzte in Merh, einmal in ihrem roten, dann wieder in ihrem schwarzen Gewand.
Das Volk flehte seine Götter an wie Issak es vorausgesagt hatte. Und wie Issak es vorausgesagt hatte, schienen die Götter zu antworten, oder es war vielleicht nur die instinkthafte Ahnung der Priester. Schließlich antworteten die Orakel aus ihren Höhlen voll Rauch oder aus den trockenen Brunnen, wo einst grün und überschwänglich das Wasser geflossen war. Die Orakel sagten: »Merh wird Narasen sein. Wenn erst einmal die Königin von Merh ein Kind gebiert, wird das Verderben ein Ende haben. Wenn Narasen fruchtbar ist, dann wird das Land Früchte tragen, aber solange sie trocken ist, wird das Land trocken sein wie ein Knochen und trockener als ein Knochen.«
Also hämmerte das Volk an die Palasttore, und ihre Gesichter glichen heißen Steinen, und sie bleckten die Zähne wie Wölfe.
Es war eine merkwürdige Sache, vielleicht ein Teil der Verwünschung selbst, dass die Strafe genauso ausfallen musste, wie Issak - oder das Wesen, von dem er besessen war - es vorhergesagt hatte. Sie musste alles tun. Zum Teil glaubte sie daran, dass in dem Fluch ein kleiner Spalt offengeblieben war, wenn sie ihn nur ausfindig machte, irgendein winziger Fehler, mit dessen Hilfe sie sich vor dem Tod ihres Landes und dem Hass ihres Volkes retten könnte. Denn wenn sie irgendetwas liebte, dann war es, Königin von Merh zu sein. Wenn ihr Schmach zugefügt werden musste, damit sie Merh halten konnte, würde sie die Schmach erdulden und sich dieser Schande nicht schämen.
Narasen öffnete ihre Türen. Jetzt standen keine Riesen mehr an den Portalen, um ihre Person zu schützen. Eine Schlange von Männern stand da, einige waren Grünschnäbel, andere waren in der Blüte ihrer Jahre, und einige waren verlegen, und andere waren dreist und schätzten sie ab, wie der Bulle die Kuh ansieht. Wahrlich eine passende Strafe, doch sie wollte nicht darüber nachsinnen. Sie nickte ihnen höflich zu. Jeder besaß einen Ruf von besonderer Art. Sie ließ sie ein, und sie fanden Eingang in ihre Räume und fanden Eingang in Narasen. Sie litt es, und ihr Volk pries sie, und als sie nicht empfing, sandte es aus seiner Mitte seine Potentesten und Besten, um sie zu begatten. Später wurden Fremde zugelassen.
Das Jahr versengte zu einer gelben leeren Hülse. Und Narasen, die in der Flamme dieses Jahres geröstet wurde, wurde ebenfalls verbrannt und ausgedörrt. Aber nur ihre Seele ward versengt. Ihre Schönheit blieb; sie kettete sie an sich. Wie konnte sie den Samen der Männer anlocken ohne ihre Schönheit? Und ihr Stolz blieb. Sie war stolz, obgleich man inzwischen in fernen Ländern von ihr sprach als der Dirne von Merh - denn keiner glaubte, dass sie sich an ihrer Aufgabe nicht ergötzte oder zumindest Bezahlung nahm. Die Schmerzen schwanden, die sie zerrissen hatten. Sie war aus Bronze gemacht. Sie kleidete ihre Bronze in Schwarz, denn es glich dem Schatten einer unbarmherzigen Sonne. »Nimm dich in Acht«, sagten die Reisenden, »wenn du durch Merh kommst, oder die Dirne wird deinen Phallus fressen. Es ist wohlbekannt«, sagten sie, »sie hat immer Hunger, und das Land verhungert auch.«
Der Winter kam. Es war ein brauner, harter Winter. Das Land ringsumher erschien wie der Trümmerhaufen eines verlorenen Ortes, der von einem Meer aus Feuer aufgeworfen und zurückgeblieben war. Der Schnee lag noch auf den Bergen, aber er wurde schwarz. Selbst der Winter wurde krank in Merh.
Narasen zog über das Hochland. Sie legte sich zu den Schäfern und zu den Männern des Hirtenvolkes. Wenn sie entblößt vor ihnen stand, waren jene verzaubert von ihrem Honigfleisch und ihrem rosenroten Haar. Sie bildeten sich ein, eine Göttin sei gekommen, und sie träumten von Söhnen aus ihren Lenden. Es gab keine Söhne, aber das wussten sie nicht. Sie schlief mit Räubern. Einer versetzte ihr einen Schnitt mit seinem Messer, und sie tötete ihn. Ein wenig tat es ihr gut, sich an diesem einen Manne gerächt zu haben. Keine Frauen mehr in ihrem Bett, keine Leoparden auf ihrem Speer. Männer in ihrem Bett, sie der Leopard für deren Speere. Sie empfand gar nichts mit ihnen. Sie lebte in einem Zustand der Trance. Sie war nur dies: Stolz, Schönheit, das schamlose Ertragen von Scham. Aber sie war auch unfruchtbar, und das Land starb.
Der Winter, froh zu gehen, verließ Merh. Der Frühling kam mit Stürmen, der Sommer mit gelbem Staub. Pest, die eine Weile geschlafen hatte, zog ihr Gewand aus gelbem Fieber an, ging in den Straßen auf und ab und klopfte an die Türen.
Und dann, ohne dass sie wusste warum, erwachte sie eines Tages aus ihrer Trance, in der sie gefesselt war. Aus ihren Fenstern starrte sie auf den furchtbaren Schrecken, zu dem Merh geworden war, und dachte: Was ich auch getan habe, es taugt nichts. Ebenso gut hätte ich meinen Körper für mich behalten können, denn es hat mir nichts eingebracht, dass ich ihn auslieh. Ich war die Beute, nun muss ich jagen gehen. Und sie sah der Pest ins Gesicht und dachte: Was muss ich tun, um dich loszuwerden? Und die Pest sagte: »Das weißt du wohl, doch du kannst es nicht tun.« Worauf Narasen die Fensterläden zuwarf über dem Staub und dem üblen Gestank von Merh.
In diesem Augenblick hörte sie, wie im Inneren des Palastes eine Frau zu weinen und zu kreischen anhob: »Oh, mein Geliebter ist am Fieber gestorben! Mein Geliebter ist tot!«
Als sie das hörte, spürte sie, wie die scharfen, glänzenden Bruchstücke ihres alten Ich sie zermalmten, und sie ballte ihre Fäuste, denn endlich hatte sie den kleinen Spalt gesehen, durch den sie hindurchschlüpfen konnte.
2.
Bei Nacht schritt Lord Uhlum über ein Schlachtfeld. Der Platz war ziemlich ruhig, die Schlacht längst beendet (wie alle Spiele, selbst die besten, schließlich einmal enden müssen), die Sieger waren mit ihrer Beute gen Norden geritten, und nur die Toten blieben zurück. Ziemlich ruhig. Nach der Schlacht war die Nachhut gekommen; in der Dämmerung hatten sich die Krähen versammelt. Nun liefen die Schakale zwischen den Haufen und Dünen und aufgetürmten Bergen stummen und bewegungslosen Fleisches umher, um ihren eigenen Krieg zu beginnen. Hier und da erleuchtete ein kleiner Feuerfleck die Schwärze, doch auch diese Zufallslaternen erstarben. Nur die Sterne warfen ihren festen, unveränderten Schein. Als hätte es auch dort oben eine Schlacht gegeben, und Leichen lägen herum, nur dass diese Körper schön waren und strahlten.
Es waren die Sterne, die Lord Uhlum das Schlachtfeld zeigten und auch ihn verrieten, falls jemand übrig war, der noch etwas sehen konnte.
Er war schwarz, und er war Uhlum, samtschwarz wie Pantherhaut oder glänzend schwarz wie ein polierter schwarzer Edelstein. Und aus reiner Schwärze schien er gemeißelt zu der Gestalt eines großen und schlanken Mannes. Doch sein Haar war lang und weiß wie Elfenbein und seine Kleidung wie Elfenbein, und sein weißes Haar und sein weißer Mantel wallten und flackerten hinter seiner Schwärze auf wie Rauch hinter einer dünnen schwarzen Flamme, während er dahinschritt. Sein Gesicht war ungewöhnlich, unbegreiflich und trostlos. Seine Augen, von der Farbe eines schimmernden Nichts, waren trostlos. Die Menschen erblickten sein trostloses Gesicht und konnten sich hinterher nicht mehr daran erinnern. Es entschlüpfte ihrem Gedächtnis, wie Wasser durch die Finger rinnt, wie Brandung vom Strand beim Wechsel der Gezeiten. Doch wer ihn jemals sah, auch wenn er sich nicht erinnerte, behielt irgendwie im Gedächtnis, dass es da etwas gab, was er vergessen hatte. Lord Uhlum.
Auf dem Schlachtfeld gab es eine Stelle, an der ein flacher Bach floss. Hierher waren einige der Verwundeten gekrochen, um zu trinken, bevor sie starben, und jetzt lagen sie mit Gesichtern und Händen im Wasser, und der Bach war dunkel vom Blut, das sie in ihm vergossen hatten. Einen Schritt weit vom Bach lag ein Krieger, der nicht tot war. Es war sein Ziel gewesen, das Wasser zu erreichen und zu trinken, doch er hatte nicht die Kraft gehabt. Durch den Schleier seiner Pein hindurch erblickte dieser Krieger plötzlich Uhlums großen Schatten zwischen sich und den Sternen, und er schrie auf. Seine Stimme war schwächer als jedes andere Geräusch der Ebene, doch Uhlum wandte sich um.
Dieser letzte Krieger war sehr jung; seine Sehkraft war geschwächt, doch schien er Uhlum klar und deutlich zu erkennen. Der junge Krieger flüsterte seine dringende Bitte, und Uhlum neigte sich nah zu ihm herab, um zu hören.
»Wenn du Mitleid hast, bring mir Wasser!«
»Ich habe nicht unbedingt Mitleid«, antwortete Uhlum. »Außerdem ist das Wasser des Baches verdorben.«
»Suchst du nach Angehörigen?«, flüsterte der Jüngling. »Am Morgen werden die Frauen kommen und weinen und unter uns suchen. Unsere Feinde werden sie gewähren lassen. Meine Mutter wird kommen und meine Schwestern. Sie werden nehmen, was die Schakale von mir übriggelassen haben, und es heimtragen. Ich werde diese Ernte sicherlich nicht mehr erleben.«
»Dies ist die Ernte«, sprach Uhlum. Seine großen Augen waren schwermütig, ihre helle Klarheit war wie ein Brunnen unvergessener Tränen.
»Bring mir Wasser!«, sagte der Jüngling. »Oder irgendeinen anderen Trank, süß oder bitter.«
»Ich habe einen Trank, den ich dir wohl geben kann«, sagte Uhlum sanft, »aber der würde dir vielleicht nicht gefallen. Bedenke doch! Vielleicht wirst du bis zum Morgen leben.«
»Die Nacht ist kalt, und ich bin durstig.«
»Nun denn«, sagte Uhlum. Aus den Falten seines Umhangs zog er eine bauchige Flasche und einen Becher aus glattem gelblich-weißem Knochen hervor. In den Becher goss er einen Trunk. Dieser hatte weder Farbe noch Geruch und auch keinen bestimmten Geschmack. Uhlum bettete den Kopf des jungen Mannes auf seinen Arm und zeigte ihm den Becher. »In drei Stunden«, sagte Uhlum, »wird der Morgen dämmern.«
»Die wilden Tiere würden mich finden«, sprach der Jüngling, »und ich kann diesen Durst nicht ertragen.«
»So trink denn!«, sprach Uhlum und setzte den Becher an die Lippen des jungen Mannes.
Er trank, der Krieger. Er sagte: »Es hat den Geschmack von Sommergras.« Und dann sagte er: »Nun dürstet mich nicht mehr.« Und er schloss seine Augen für immer.
Während Uhlum weiterging, kam eine kleine Gruppe von Frauen über den Hügel. Sie trugen keine Lampen bei sich, denn sie hatten sich früh hinausgestohlen, voll Furcht vor dem Feind aus dem Norden und gegen dessen Befehl. Sie hatten sich in Dunkelheit gehüllt wie in einen Mantel, und als sie Uhlum sahen, schraken sie stöhnend zusammen. Doch als er an ihnen vorbeiging, verlor eine Frau ihre furchtbare Angst und rief ihm nach: »Dich kenne ich, du Schakal!« Und sie spuckte auf den Boden, dorthin, wo er vorbeigegangen war.
3.
Fünf Meilen von der Stadt Merh entfernt gen Osten erstreckte sich ein Wall von Bergen; sie zu überqueren, nahm sieben Tage in Anspruch. Jenseits davon lag ein unfruchtbares Tal und am Ende des Tals ein Wald aus uralten toten Zedern. Dieser Teil der Reise dauerte zwei Tage. Jenseits des Waldes öffnete sich ein wildes Land, wo viele Dinge wuchsen, doch unkontrolliert und aus einem reinen Wachstumstrieb heraus. Hier blühten Rosen mit riesigen Dornen, die gefleckt waren wie Katzen im Heidekraut, die Äpfel waren wie aus Salz und die Früchte des Quittenbaums wie Wermut. Grelle Vögel lebten im Dickicht, doch sie hatten keine Lieder. Die einheimischen Tiere waren wild, doch sie machten nicht oft Jagd auf Menschen, denn Menschen taten ihnen nicht oft den Gefallen dorthin zu kommen. Drei Meilen weiter östlich in dieses Land hinein lag ein Obstgarten voll wilder Granatäpfel. Die Früchte waren giftig und hatten die hektische Farbe roten Giftes, und in der Mitte des Obstgartens stand ein blaues Haus. Dieses Gebäude, das als Haus des Blauen Hundes bekannt war, war der Wohnsitz einer Hexe.
Da Narasen ganz besonderes Wissen suchte, hatte sie ihre eigenen Zauberer gefragt und auch jeden anderen dieses Berufes, der ihre Stadt betrat. Ihr Volk hatte die Geduld mit ihr verloren. Auch sie hatten angefangen, sie Dirne zu nennen. »Sie kann nicht empfangen, weil ihre Wollust die Fruchtbarkeit ihres Schoßes ausgebrannt hat.« Einige rannten wie Horden von Hyänen durch die Straßen von Merh, andere malten ihren Namen in schmutzigen Sprüchen an die Wände. Einige brachen bei Nacht in den Palast ein und versuchten, sie zu erschlagen. Zuletzt, als sie sah, dass sie außerhalb der Stadt suchen musste, ging sie verkleidet und auf dunklen Wegen hinaus. Nur eine Wache von zehn Männern begleitete sie, der Rest blieb zurück in Merh, um Ordnung zu halten und den Palast zu bewachen. Mit ihrer kleinen Eskorte überquerte sie die Berge und das Felsental, und sie ritt durch den erstarrten Zedernwald und hinein in das wilde Land jenseits davon. Am elften Tag ihrer Reise erreichten sie die Wiesen, die an den Obstgarten grenzten. An dieser Stelle stieg Narasen ab und ging allein weiter. Sie wanderte eine halbe Meile über das üppige Gras und durch die Granatäpfelbäume, bis sie zum Haus der Hexe kam.
Obgleich es erst Nachmittag war, lag der Obstgarten in dunklem Schatten. Das Haus des Blauen Hundes erhob sich plötzlich aus dieser Düsternis, als hätte es dort geschlafen. Zwei Pfeiler aus Indigo säumten eine eherne Tür, vor der in einer hohen Lampe aus blauem Glas ein rosafarbenes Feuer brannte.
Narasen ging zur Tür und klopfte mit ihrer Reitgerte an. Sofort öffnete sich die Tür. Auf der Schwelle stand ein Hund. Sieben Hände hoch war er und aus blauem Email. Er öffnete seinen Rachen und bellte sie an, aber sein Bellen war Sprache.
»Wer bist du?«, bellte der Hund.
»Eine, die deine Herrin braucht«, antwortete Narasen.
»Das ist selbstverständlich. Doch ich befasse mich mit Namen.«
»Dann befasse dich mit diesem! Ich bin Narasen, die Königin von Merh.«
»Wer hier lügt, stirbt bisweilen«, knurrte der Hund.
»Dann erzähl keine Lügen und lebe!« herrschte sie ihn an. »Komm, bring mich zu deiner Hexen-Herrin. Ich will nicht von einem Köter ausgefragt werden.«
Bei diesen Worten wedelte der Hund mit dem Schwanz, als gefalle ihm ihr Hochmut, und er leckte ihre Hand mit einer Zunge wie von trockenem, heißem Glas.
»Folge mir bitte!«, sagte der Hund und sprang ins Haus.
Innen war alles blau. Der Hund führte Narasen eine Treppe aus Lapislazuli hinauf und in einen Raum mit vielen blauen Lampen, in denen rosafarbene Feuer brannten.
»Nimm Platz!«, sagte der Hund. »Soll ich eine Erfrischung bringen?«
»Ich werde hier nichts essen und nichts trinken«, sagte Narasen. »Jene, die von deiner Herrin sprechen, sagen, dass sie so weise ist, dass nur wenige es wagen, ihr Haus zu betreten. Doch mehr gehen hinein als herauskommen.«
Der Hund lachte darüber, ganz gewiss ein seltsames Geräusch, als rasselten Tonziegel in einem Schornstein. In diesem Moment wehte ein Vorhang zur Seite, und die Hexe selbst trat ins Zimmer.
Nun hatte Narasen mit vielen über die Herrin des Blauen Hauses gesprochen, denn viele wussten von ihr, doch kaum jemand hatte sie je gesehen. Einer sagte, sie nähme die Gestalt eines Basilisken an, und ihre Augen seien Feuersteine; ein anderer sagte, sie wäre ein altes Weib, tausend Jahre alt oder älter. Narasen aber sah dies: ein junges Mädchen von fünfzehn Jahren oder jünger, schlank wie eine Seidenschnur, das allein in ihr malzbraunes Haar gekleidet war, das ihr bis auf die Knöchel fiel. Gelegentlich lugte ein schlanker weißer Arm aus diesem Haarschleier hervor oder ein weißer Fuß oder Schenkel oder zwei Brüste wie die Knospen einer Wasserlilie. Und obwohl Narasen begriff, dass das, was sie sah, nur ein Zauber sein konnte, war sie wider ihren Willen erregt. Und die junge Hexe durchquerte das Zimmer und setzte sich zu Narasens Füßen nieder und blickte lächelnd zu ihr auf, mit einem Mund, der dem ersten rosenfarbenen Strahl der Dämmerung glich.
»Nun erzähl mir alles, ältere Schwester!« sprach die Hexe. »Denn du bist weit gereist, um mich zu finden.«
Und so stählte sich Narasen. Sie beachtete weder den blauen Hund, der lächerlicherweise mit offensichtlichem Vergnügen auf einem blauen Porzellanknochen herumkaute; noch beachtete sie das silbrige Fleisch der Hexe, das ihr durch den Haarschleier zu blinkte. Narasen sprach von ihrem Kummer, von Issak und der Begierde seines Mentors, von dem Fluch und der Pest und dem dürren Tod Merhs, wie Merh keine Frucht tragen könne, bis sie selbst, die keinen Wunsch danach hege, ein Kind gebäre.
»Dann wirst du dich zu Männern gelegt haben«, sagte die Hexe.
»Das habe ich in der Tat, obgleich ich kein Liebhaber der Waffen männlicher Tiere bin. Ich gab mich dem Mann-Stier und dem Ziegen-Mann hin, dem Straßenesel und dem stinkenden Räuber - zu allen habe ich mich gelegt und mich selbst nicht geschont. Doch noch immer trage ich kein Kind, denn der Skorpion- Stachel des Fluches war folgendes: dass mein Schoß niemals vom Samen eines lebendigen Mannes befruchtet würde.«
»Wahrhaftig«, sagte die Hexe, »das ist ein gerissener Fluch. Den Weg aufzeigen und dann den Zugang dazu versperren. Aber Fluch ist Fluch, und der Fluch eines solchen Magiers, wie dieser Issak einer war, wird schwerlich gebrochen werden können. Warum hast du mich aufgesucht, oh, Königin?«
Narasen sah trotz ihrer Worte einen hinterhältigen Schimmer in den Augen der Hexe. Sie denkt wie ich, sagte Narasen zu sich selbst. Und zur Hexe sprach sie: »Ich suchte dich auf, weil ich hörte, dass die Herrin im Hause des Blauen Hundes gelegentlich mit einer mächtigen Persönlichkeit verkehrt, mit keinem Geringeren als einem Herrn der Finsternis.«
»Und wenn dem so ist, was hilft dies Narasen von Merh?«
»Folgendes: Da ich nun schon, um Merh zu retten, geschwängert werden muss, muss ich noch einmal mit einem Mann schlafen. Aber es muss nur noch ein einziges Mal sein und mit einem einzigen Mann, vorausgesetzt, dass er nicht lebendig ist.«
Eine Weile sprach die Hexe nichts, doch dann lächelte sie wieder.
»Die Königin von Merh ist auch weise«, sagte die Hexe schließlich. Sie erhob sich und warf ihr Haar zurück, und sie enthüllte Narasen ihre ganze blasse Lieblichkeit, die in ihrem Haar verborgen gewesen war, und zeigte ihr auch einen Gürtel aus kleinen weißen Fingerknöchelchen um ihre Taille, die auf eine Goldkette aufgezogen waren. »Nun,«, sagte die Hexe, »ich gebe zu, dass ich einen Herrn der Finsternis herbitten kann, einen, der dir helfen könnte, wenn er wollte. Ich kann ihn rufen, und er mag kommen oder auch nicht, denn er wartet nicht auf meinen Ruf, ich bin nicht mehr als seine Dienerin. Es ist jedoch möglich, dass er kommt - und dann sei auf deine eigene Furcht vorbereitet, denn selbst jene, die weit von ihm entfernt sind, fürchten ihn im Allgemeinen. Um Nichtigkeiten zu erfüllen, sollte man ihn nicht rufen. Außerdem muss, wie du dir denken wirst, ein Handel abgeschlossen werden.«
»Davon habe ich gehört«, sagte Narasen.
»Du kannst dich weigern«, sagte die Hexe, »selbst in seinem Angesicht kannst du dich weigern. Er zwingt niemanden. Dennoch ist es nicht leicht, sich zu weigern. Wünschst du noch, dass ich ihn rufe?«
»Ich wünsche es«, sprach Narasen.
Da erzitterte die Hexe, ob vor Schrecken oder vor Freude, war nicht klar, vielleicht vor beidem oder vor keinem von beiden. Sie pfiff, und der Hund lief davon, und die Feuer in den Lampen sanken in sich zusammen. Dann ging sie zu einem Tisch und öffnete einen Elfenbeinkasten, der dort stand. In dem Kasten war eine Trommel, so klein, dass ein Baby damit hätte spielen können. Doch die Trommel war aus Knochen gemacht, und die Haut, mit der sie bezogen war, stammte vom Körper eines schönen jungfräulichen Mädchens.
Noch einmal setzte sich die Hexe zu Füßen Narasens nieder und begann mit schnellen kleinen Schlägen auf die Trommelhaut zu schlagen. Nun bemerkte Narasen etwas, was sie vorher nicht gesehen hatte, nämlich dass der dritte Finger der linken Hand der Hexe an seinem obersten Glied abgetrennt war. Und Narasen erinnerte sich der Fingerknochen um die Taille der Hexe, aber genau in diesem Augenblick erloschen die Feuer in allen Lampen.
Was nun herabkam, war mehr als die Finsternis eines Hauses. Es war das Dunkel einer weiten schwarzen Muschel im Innern der Erde, ein hohles Dunkel. Und es klang wider von dumpfem Flüstern, Schnaufen und Seufzen und dem erbarmungslosen Schlagen der Hexentrommel.
Es war Sonnenuntergang, und in dessen rotem Licht stand Uhlum neben der Tür einer elenden Hütte, und eine junge Frau verneigte sich vor ihm.
»Bitte verfügt über mein Haus!«, sagte sie. Doch da gab es nicht viel, über das man verfügen konnte. Ein verkommenes Loch war es, und auf einem zusammengeflickten Bett saßen mehrere Kinder, feierlich wie Eulen. Auf dem anderen Bett lag ein weibliches Kind von drei oder vier Jahren. »Ich habe meinen Mann nach einem Doktor geschickt«, sagte die junge Frau, »aber mein Mann ist nicht zurückgekommen. Seid Ihr schon vorausgegangen, Herr?«
»Ja«, sagte Uhlum, während er über die Schwelle trat. Er schien eine tiefe Ruhe mit sich zu bringen. Diese legte sich über das kranke Kind, dessen Augenlider sich entspannten. Die Mutter aber erschauerte.
»Es tut mir leid«, sagte sie, »wir haben nichts, womit wir Euch bezahlen können. Aber ich verspreche Euch das ganze Geld aus dem Erlös für die Ferkel, sobald unsere Sau geworfen hat.«
Uhlum beugte sich über das kranke Kind. Der karge und erbärmliche Raum war von einer Art frostiger Atmosphäre erfüllt, wie graues Zwielicht - durch die Tür aber leuchtete der Himmel rot.
»Wartet, Herr!«, sagte die Mutter. »Sagt mir, wer Ihr seid!«
»Du weißt es«, sagte Uhlum.
Die Mutter rang die Hände.
»Ich dachte, Ihr wärt der Doktor. Ich habe mich geirrt«, sagte sie. »Ich bitte Euch, geht!«
»Aber du meinst es nicht«, sagte Uhlum. »Drei Nächte lang hast du gebetet, dass dir wenigstens eines dieser vielen Mäuler, die du zu füttern hast, abgenommen wird und einer dieser kleinen Leiber, die gekleidet und gewärmt sein wollen.«
»Das habe ich«, murmelte die Mutter. »Die Götter werden mich für meine Schlechtigkeit vernichten.«
Aber sie weinte und verbarg ihr Gesicht. Und Uhlum beugte sich dicht zu dem Kind auf dem Bett und berührte ganz leicht dessen Herz und wandte sich ab. Und als er die Hütte verließ, fielen zwei leidenschaftslose, eisige Tränen von seinen Wimpern auf die wilden Blumen, die neben der Tür wuchsen, und die wilden Blumen erstarben.
Die meisten anderen Kinder aber plapperten miteinander, denn ihnen kam es vor, als sei der Abendwind ins Zimmer gekommen und sei kälter wieder hinausgegangen, als er hereingekommen war. Das kranke Kind war still.
Uhlum folgte der Sonne, ging ihr nach, während sie sank. Nicht immer war die Stunde der Dunkelheit die seine, trotz seines Reiches und seiner Herrschaft. Er schritt schnell dahin, schneller als ein Mensch. Seine weitausgreifenden Schritte fraßen das Land, und so war die Sonne vor ihm immerzu im Sinken begriffen, immer untergehend, rot wie Henna, am Rande der Welt, doch noch nicht ganz verschwunden. Da jedoch zu jener Zeit die Erde flach war, geriet er schließlich doch noch, wenn auch erst nach langer Zeit, der Sonne gegenüber ins Hintertreffen, und sie entschwand seinen Blicken.
Uhlum blieb stehen, während die Nacht sich aus den Winkeln der Erde her dichter zusammenzog. Und als ihn die Nacht erreichte, kam ein Klang aus ihr hervor, der sich leicht ausbreitete, jetzt wie Regentropfen, die auf sonnendurchglühten Boden tropften, dann wieder wie Flügel einer Motte, die während des Fluges aneinanderschlagen - ein Klang, zu schwach für sterbliche Ohren, doch Uhlum hörte ihn. Aber nun glich es dem Klang von zwei Daumen und sieben Fingern, die auf das Fell einer Trommel prasselten.
Uhlum stand und überlegte. Seine Augen mit ihrem Vorrat an gefühllosen Tränen wandten sich ostwärts. Von seinem Gesicht konnte man nichts ablesen. Er drückte damit nichts aus. Eher war seine gesamte Person der Ausdruck seiner Stimmung, seiner Funktion. Vielleicht hatten die Götter ihn einst geschaffen, vor langer Zeit, in den Tagen der ungestalteten Dinge und des Chaos. Oder vielleicht war er auch nur gekommen, um dabei zu sein, weil man ihn brauchte, ihn oder seinen Namen. Doch da war er, und er stand da auf dem Rücken der Welt und lauschte nachdenklich dem, was ihn so flehentlich rief.
Die junge Hexe hielt den Atem an, doch sie hörte nicht auf, die Trommel zu bearbeiten. Rings um ihre schmale Taille begannen die Knochen an ihrer Kette zu klappern. Dann ergoss sich ein Schattenglanz in die lichtlose Höhle, in die sich das Haus des Blauen Hundes verwandelt hatte, ein Schattenglanz der alles erleuchtete, aber nichts erwärmte.
Am äußersten Ende des Zimmers stand ein magerer bleicher Hund von bläulich-weißer Farbe. So erblickte Narasen das, was dem Haus in Wirklichkeit seinen Namen gab.
Die Hexe saß an ihrer Trommel. Sie erhob sich, und die Knochen rasselten an ihrer Taille. Sie kniete vor dem Hund nieder, und ihr Haar bedeckte den Boden.
»Mein Gebieter«, sagte sie, »vergib deiner Magd, dass sie nach dir rief!«
Der Hund näherte sich. Er war edel, aber entsetzlich. Manche waren diesem Hund begegnet und hatten sich gefürchtet, aber Narasen fürchtete sich nicht vor ihm. Dann war er verschwunden, und an seiner Stelle stand ein Mann, schöner als jeder Mann, den Narasen zuvor gesehen, und fremdartiger als irgendein Mann, in einen weißen Mantel gehüllt, mit weißen Haaren und schwarzer Haut und mit Augen wie Phosphor. Und Furcht wuchs in Narasen. Nicht vor dem Manne, nicht genau vor ihm. Auch war diese Furcht nicht wie irgendeine andere. Sie war wie die düstere Traurigkeit, die in den Stunden kommt, da die Nacht verebbt; Furcht, die eher einer Verzweiflung glich; ein Abgrund, unvermeidbar, alldurchdringend, schmerzlos.
Er schaute nicht auf Narasen, er starrte hinunter auf das Gesicht der Hexe. Irgendwie hatte er das Aussehen eines Blinden. Mit einer sehr, sehr ruhigen Stimme sagte er:
»Ich bin hier.«
»Mein Gebieter«, sagte die Hexe und erwiderte seinen starren Blick, »ich habe eine hier in diesem Raum, die sich dir mit einem Anliegen nähern möchte.«
»Bring sie her!«, sagte er.
Wieder erhob sich die Hexe. Sie winkte Narasen zu, und Narasen verließ ihren Platz und trat vor, bis sie dicht vor dem Mann im weißen Mantel stand. Und dann blickte sie ihm mutig entgegen, wenn auch seine bodenlosen Augen, die sich auf sie hefteten, sie einzusaugen und zu trinken schienen.
»Wie du merkst, Herr«, sagte Narasen, »ducke ich mich nicht vor dir, denn letztendlich gibt es niemanden, der dir ausweichen kann. Verehrung und Grüße, Lord Tod.«
Tod - dessen selten ausgesprochener Name Uhlum war -, einer der Herren der Finsternis, sagte bloß: »Sag mir, was du willst.«
Narasen sagte zu ihm: »Um mein Land und meine Krone zu erhalten, muss ich ein Kind austragen. Man hat mich verflucht, ich kann dies Kind von keinem lebenden Mann empfangen. Ich muss aus der Umarmung eines toten Mannes empfangen. Und die Toten sind dein Volk, mein Gebieter.«
Die Hexe klatschte einmal in die Hände. Ein steinerner Stuhl erschien, mit weißem Samt drapiert. Die Armlehnen waren aus Gold, und wo die Hände lagen, grinsten zwei Hundeschädel, auch sie aus Gold und mit Perlen in den Augenhöhlen. Tod setzte sich in diesen Stuhl. Er schien über das nachzudenken, was Narasen ihm erzählt hatte. Kurz darauf sagte er: »So kann es geschehen. Aber wirst du solch eine Umarmung aushalten können?«
»Schon mit irgendeinem Mann zu schlafen, ist mir verhasst«, sagte Narasen. (Dies sagte sie, obgleich Tod in der Gestalt eines Mannes vor ihr stand.) »Einem toten Manne beizuwohnen, macht keinen Unterschied und mag sogar besser sein.«
»Und kennst du den Preis?«
»Dass ich, wenn ich sterbe, für gewisse Zeit deine Sklavin werden muss. Ich hatte geglaubt, dass es der ganzen Menschheit so ergeht.«
»Nein«, sprach Tod, der Lord Uhlum. »Ich bin der König eines leeren Königreiches. Doch ich will dir vieles zeigen. Folgendes sollst du sofort erfahren: Dass du für tausend sterbliche Jahre bei mir bleiben musst. Ich verlange nicht mehr und nicht weniger.«
Die bleiche Narasen wurde noch bleicher. Aber grimmig sprach sie:
»Das ist in der Tat eine ganze Weile. Und wozu brauchst du mich, dass es tausend Jahre erfordert, dich zufriedenzustellen?« Tod sah sie an. Narasens Herz schrak zusammen, aber sie ängstigte sich nicht wirklich vor ihm, obgleich ihre Furcht absolut war. »Nun«, sagte sie, »bitte zögere nicht, es mir zu sagen.«
Etwas glitt über Uhlums Gesicht; kein Ausdruck, kein Schatten, doch Etwas.
»Das Leben hat dich nicht zertreten«, sagte Lord Tod. »Von denen, die mich suchen, sind die meisten die Opfer ihres Lebens, und sie erliegen ihrer Pein, bevor sie sich mir ergeben. Aber du bist aufgeflammt, durch Schmutz und Übel hindurch, welche auf dein Feuer geworfen wurden. Ich sollte mich über deine Gesellschaft freuen. Denn das ist es, Frau, was du mir für tausend Jahre verkaufst. Nicht dein Fleisch. Wenn du erst einmal tot bist, ist dein Fleisch in jedem Falle mein. Es gehört mir, dein Fleisch, und in der Erde liegt es, bis es zu Erde wird. Auch deine Weiblichkeit will ich nicht, Tod paart sich nicht. Bedenke, Lady, welcher Spott darin läge, wenn Tod fruchtbaren Samen hervorbrächte. Nein. Deine Seele möchte ich behalten, sie in deinem Körper zurückhalten und beide bei mir behalten, meine tausend Jahre lang. Und wenn die tausend Jahre vergangen sind, steht es deiner Seele frei, mich zu verlassen.«
»Wohin?«, fragte Narasen schnell und ungestüm.
»Frag mich nicht nach Neuigkeiten aus einem Leben-nach- dem-Leben«, sagte er.
Narasen sprach: »Zeig mir dein Königreich, und zeig mir einen Weg, ein Kind zu empfangen, und ich werde dir sagen, ob ich mit deinen Bedingungen einverstanden bin oder nicht.«
Aus dem Schatten hinter dem Stuhl zischte die Stimme der Hexe: »Du forderst zu viel! Berichtige dich.«
Uhlum aber murmelte ihr ein paar Worte zu, die Narasen nicht verstand. Und die Hexe seufzte und sagte nichts mehr.
Dann erhob sich Uhlum aus dem steinernen Stuhl. Sein weißer Mantel schien anzuschwellen wie eine weiße Woge, und Narasen wurde darin eingehüllt. Das Zimmer der Hexe fiel zurück. Narasen fand sich in das weiße Blatt eingewickelt, das Tods Mantel war; sie hing in schwarzer Luft über der Erde. Die Lichter der Menschen brannten unter ihr und über ihr die Lichter der Sterne. Weit war der Mantel von Tod und riesengroß. Fest hielt er sie, doch mit Tods Person hatte sie keinerlei Berührung.
»Wohin jetzt?«, fragte Narasen.
»Nach Innererde«, sagte Tod, »meinem Königreich.«
Tod und sein Mantel wirbelten zur Erde hinunter. Ein weites Tal lag vor ihnen, tauchte plötzlich aus der Dunkelheit auf, und als sie hineintauchten, streckte Tod seine Hand aus, und das Tal teilte sich vor ihm. Dies aber ist wahr, dass, wo immer Tod gewesen, er dorthin zurückkehren konnte und dort die Herrschaft hatte. Und die ganze Welt war ein einziger Friedhof, denn auf jedem Fleckchen war früher oder später einmal etwas gestorben, Vogel oder Tier, Mann oder Frau, ein Baum, eine Blume, ein Grashalm. Sogar in den Meeren, die ihre eigenen Gesetze und ihre eigenen Herrscher hatten und die ohne entsprechenden Lohn nicht einmal den allerbesten Magiern des Landes halfen, sogar dort starben Wesen, die Fische der oberen Meeresschichten oder die Ungeheuer der Tiefe; so konnte auch dort Tod kommen und gehen, ganz wie es ihm beliebte, ohne dass ihm jemand widersprach. Gehorsam öffnete sich demzufolge das Tal, und der Fels streckte sich weit, und hindurch sank Tod mit Narasen von Merh, die in seinen Mantel gehüllt war.
Der Weg war unsichtbar und zum Teil wie der Obergang in den Schlaf, denn Gesichter und Illusionen fluteten durch Narasens Hirn, wenn auch nicht vor ihren Augen. Einmal jedoch schien es, als überflutete sie das trübe Wasser eines bleiernen Flusses, in welchem ganze Horden von Phantomwesen schwammen und sich gegenseitig anrempelten; doch dieser Eindruck verblich, und Tods Mantel trug sie weiter und weiter hinunter, bis sie sanft zur Ruhe kam, und dann gab es nur noch Stille und Dunkelheit.
Narasens Furcht, an die sie sich fast gewöhnt hatte, sprang sie plötzlich an und wurde scharf und deutlich.
»Ist dies ein Grab, in welchem ich mich befinde?«, schrie sie gellend.
»Hab' Geduld«, sprach Uhlum, Lord Tod. »Sogleich wirst du sehen und hören, was immer in diesem meinem Reiche zu sehen und zu hören ist. Weil du diesen Ort als Lebende betrittst, bist du für den Moment wie erblindet. Wie der Geist eines Toten, der sich nicht selbst von der Welt freimachen kann, zurückkehrt, um die Erde zu besuchen, und dort keinen Leib hat, so bist du hier ein Geist in der Welt der Toten.«
Woraufhin Narasen wieder Umrisse sah und auch ihren Hörsinn wiedererlangte. Doch konnte sie weder irgendetwas riechen noch mit ihren Händen erfühlen, auch keinen Geschmack auf ihrer Zunge empfinden. Sie war, ganz wie er sagte, ein lebendes Gespenst im Land der Toten.
Aber Narasen genügte es, dass sie sah und hörte, und vielleicht sogar von beidem zu viel. Sie erschauerte bis ins Innerste ihres Herzens, sie, die furchtlos Schlachten geschlagen hatte in den Gefilden der Menschen.
Sie standen auf einer Klippe, um sie herum dehnten sich Ebenen und Hügel, hier und da weitere Klippen und linker Hand eine düstere Gebirgskette. Die Farbe dieses Landes war grau; die Klippe sah aus wie von Blei, und aus ihr wuchsen Büschel einer grauen Vegetation, nicht wie Gras, sondern eher dünn und brüchig wie das Haar einer alten Frau, dazu trat Moos in einem dunkleren Grau aus den Felsspalten hervor. Die Ebene darunter war wie eine graue Staubwüste, die Hügel aus Stein, und wo ihre Schatten hinfielen, da waren sie schwarz. Darüber der trostlose und trübweiße Himmel von Innererde. Keine Sonne, kein Mond und keine Sterne erhellten ihn. Er veränderte sich nicht, nur gelegentlich wehte eine Wolke über ihn hinweg wie eine Handvoll ausgeglühter Kohlen. Soviel für die Augen. Zu hören gab es eine taube Leere, die durch Ausbrüche eines donnernden Windes gestört wurde. Und obgleich der Wind donnerte und die Wolken vor sich hertrieb, hatte er dennoch keine Kraft, denn die Wolken glitten langsam dahin, und die Gräser bewegten sich nie, und sogar Tods großer Mantel hing schlaff, als seien die hängenden Falten voller Gewichte.
Als Tod ihren Schauder bemerkte, sagte er zu Narasen: »Dies ist nicht dein Land. Warum fürchtest du es?«
»Hierher würdest du mich kommen lassen. Hierhin müssen alle Menschen kommen, wenn sie sterben.«
»Geh mit mir durch dieses Land«, sagte Tod, »und wenn du irgendeinen Menschen siehst, dann sag es mir.«
Tod stieg von der Klippe herunter, und Narasen mit ihm. Tod warf einen pechschwarzen Schatten, nicht jedoch Narasen. Sie bewegten sich über das traurige Land, durch die Staubwüste, über die steinernen Hügel. Ein Wald erschien auf der anderen Seite, aber die Bäume waren wie Türme grauen Schiefers. Moose tropften von ihnen herab. Der Wind rasselte vorüber und störte nichts auf. Sie kamen an einen Fluss. Er spiegelte den Himmel wider und war weiß, und Narasen konnte nicht hineinsehen, nur seine Oberfläche erblicken, aber nichts kräuselte die Oberfläche oder bewegte die Tiefen.
Sie gingen eine ganze Weile. Der Himmel veränderte sich nicht. Es gab keine bestimmte Zeit. Narasen, ein Gespenst des Lebens, fühlte keine Müdigkeit. Noch eine lange Weile gingen sie, und weiter. Und wo sie auch hinschaute und spähte und lauschte, hörte sie doch keinen Schrei von Mensch oder Tier. Die steinernen Bäume hatten keine Vögel. Der Wind brachte keine Stimmen. Offenkundig, unleugbar wohnte hier niemand.
»Einer«, sagte Uhlum, denn er hatte ihre Gedanken gelesen. »Ich. Manchmal andere. Andere, die einen Handel mit mir abgeschlossen haben, tausend Jahre im Tausch für einen Gefallen, den nur der Tod gewähren kann.«
Narasen schaute Tod an.
»Ist es dann wahr, dass die Seelen der Toten anderswo hinreisen und nicht eingesperrt werden können? Wenn dem so ist, dann hast du mein Mitleid«, sagte sie frostig, »denn selbst Merh ist mir nicht dieses Gefängnis wert.«
»Warte«, sagte Uhlum, »bis du alles gesehen hast.«
Sie gingen weiter, und Narasen, die Leopardin, die Mutige, beobachtete ihn trotz ihrer schrecklichen Furcht vor Uhlums Ausstrahlung mit Verachtung und Geringschätzung.
Dort gab es einen Palast aus Granit. Er besaß keinerlei Schönheit. Hohe Felssäulen trugen ein Dach aus Schatten. Es gab keine Fenster und keine Lampen, aber drinnen war es nicht finster, zumindest herrschte hier nur eine laue Dunkelheit. In einer Halle wartete ein granitener Stuhl ohne jeden Schmuck darauf, dass Tod sich auf ihn setzte. Tod setzte sich. Er stützte das Kinn auf die Hand. Er starrte in die Leere der Halle, und ohne jeden Kummer noch jegliches Geräusch fielen Tränen von seinen Wimpern. Dies war das Symbol seiner selbst, zu dem er geworden war. So hatten ihn die Götter oder die Alpträume der Menschheit gemacht. Trübsinnige Verzweiflung inmitten der Steinöde.
Und dann hörte Narasen Musik. Das ließ sie auffahren; schnell drehte sie sich um. Durch die vielen Bogengänge, die in die Halle führten, näherten sich Männer und Frauen, und die Musik stahl sich mit ihnen herein und ertränkte das Gebrüll des schwachen Windes. Wie die Männer und Frauen so die Halle erfüllten, geschah in einem Augenzwinkern eine Veränderung, und nichts war mehr dasselbe.