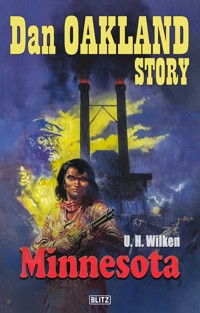4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Horror Western
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die Nacht der BestienAuf einem Viehtrieb verschwinden Cowboys. Die Spur der Vermissten führt in eine mysteriöse Geisterstadt. Jim und Andie müssen gegen Dämonen und Höllenkreaturen kämpfen. Ihr Leben ist nichts mehr wert, denn die Bestien versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass die beiden aus der Stadt der Toten fliehen können.Canyon der lebenden TotenDer Squaw-Monument-Felsen birgt ein düsteres Geheimnis. Vor vielen Jahren fand hier ein grausamer Mord an einem unschuldigen Kind statt. Ein Überlebender schwört den Mördern Rache und verbindet sich mit den Mächten der Hölle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Ähnliche
Horror Western
In dieser Reihe bisher erschienen
3801 Ralf Kor Blutmesse in Deer Creek
3802 Earl Warren Manitous Fluch
3803 Ralph G. Kretschmann Im Sattel saß der Tod
3804 Ralph G. Kretschmann Der Fluch des Mexikaners
3805 Ralph G. Kretschmann Leben und Sterben in Virginia
3806 U. H. Wilken Die Nacht der Bestien
U. H. Wilken
Die Nacht der Bestien
Ein Horror-Western
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: iStock.com/IMOGISatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-286-8Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Teil 1 - Die Nacht der Bestien
Bösartig hallte das heisere Krächzen vom lichtlosen Himmel. Mit rauschenden Schwingen zogen die Totenvögel ihre Kreise über der weiten Prärie. Wolkenfetzen trieben von den sandigen Hügeln herüber. Dumpf murrend drängten sich die Rinder zusammen. Schon seit Tagen folgten die Aasgeier der Herde.
An diesem Abend waren Männer los geritten, um nach einem Wasserloch zu suchen. Auch Lucky war unterwegs. Weitab der Herde lenkte er das Pferd zwischen die Felsklippen. Suchend blickte er umher, überall türmte sich das Gestein, und Staub wirbelte über die kahlen Anhöhen. Im Zwielicht verschwammen die Konturen.
Plötzlich hörte er leises, verhaltenes Knurren. Sein Pferd wurde unruhig und prustete. Hart schlugen die Hufe auf der Stelle. Im trockenen Gestrüpp vor Lucky raschelte es. Ein grauer Schatten huschte davon. Weiche Pfoten schnellten durch den Sand. Sekundenlang konnte Lucky das Tier sehen. Er erschrak. Noch niemals hatte er einen so großen Wolf gesehen!
Hinter den toten Bäumen und abgestorbenen Strauchgruppen richtete das Untier sich halb auf und blickte zu ihm herüber mit grün schimmernden Augen, die wie zwei Lichtpunkte durch die Dämmerung stachen. Irgendwie hatte dieser Wolf einen menschlichen Blick, einen furchtbar kalten und abschätzenden Blick, als wüsste er, dass Lucky sterben musste.
Als Lucky zum Gewehr griff und es aus dem Scabbard riss, verschwand der Wolf. Pfeifend atmete Lucky aus, zog die Schultern an und spürte es kalt über den Rücken kriechen. Er war ein einfacher Mann, und wie alle Cowboys, so war auch er abergläubisch. Er zwang sich, weiterzureiten. Die Rinder brauchten Wasser. Sie würden elendig verrecken, wenn die Männer kein Wasser fänden.
Langsam trug das Pferd ihn um die Felsklippen. Er hielt das Gewehr im Anschlag und stierte umher. Die Schatten der Nacht krochen über das öde Land. Aus den Tiefen der Canyons kam es kalt und dunkel hervor. Grüne Lichtpunkte tanzten vor Lucky in der Dämmerung. Er schoss und fluchte. Patronenhülsen fielen in den Sand. Die Hufe schlugen über Geröll hinweg.
Vor Lucky öffnete sich ein Tal. Vielleicht würde er hier auf Wasser stoßen. Noch grollte das Echo der Schüsse in der Wildnis, als er in das Tal hinunterritt. Er schlug die Zähne aufeinander, blickte ständig umher und hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Am Talrand heulten plötzlich Wölfe durchdringend und schaurig. Struppige Körper bewegten sich hin und her. Der Wind kam aus der Wüste. Die Wölfe konnten die ferne Herde nicht wittern.
Auf einmal vernahm Lucky einen leisen Pfiff. Es klang wie das Pfeifen einer Ratte. Die Wölfe verstummten. Nur das Rascheln der Sträucher war zu hören.
Vor Lucky buckelten sich die Felsmassen eines Höhenzuges. Er wusste nicht, was sich hinter jenem Höhenzug befand. Unruhig riss er am Zügel, verhielt und sah durch das Tal. Hinter verkrüppelten Bäumen am Talhang ragten die Umrisse einer Hütte empor. Lächeln zuckte über sein angespanntes Gesicht.
„He“, rief er, „ist da jemand?“
Niemand antwortete. Nur das Echo seiner Stimme hallte im Tal. Immer wieder sagte Lucky sich, dass er weitersuchen müsste. Es ging um das Leben der Treibherde. Sie hatten die Rinder aus Mexiko geholt und befanden sich jetzt im öden Grenzland. Ein Sandsturm hatte das Wasserloch begraben und unsichtbar gemacht. Keiner der Cowboys wusste so recht, wo sie sich eigentlich befanden. Sie waren während des Sturms vom Weg abgekommen, hatten die Route verlassen und die Orientierung verloren.
Das Wasser war für alle lebenswichtig.
Und darum fand Lucky auch den Mut, langsam zur Hütte empor zu reiten, denn der Bewohner jener Behausung konnte ihm bestimmt sagen, wo das nächstgelegene Wasserloch zu finden wäre.
In Luckys Phantasie wurden all diese schaurigen Geschichten lebendig, die man sich nachts an den Lagerfeuern erzählte. Er dachte auch an Jim, an den Freund, und er wäre sehr froh darüber gewesen, wenn er Jim jetzt bei sich gehabt hätte.
„Zum Teufel!“, krächzte Lucky, trieb das Pferd hart an und hielt vor der Hütte.
Die Tür war geschlossen. Alte Gardinen hingen vor dem staubblinden Fenster. Die Äste der toten Bäume rieben knarrend aneinander. Winselnd strich der Wind über die Hütte hinweg.
Lucky wusste, dass manche Hütte direkt über einem Wasserloch errichtet worden war. Darum rutschte er vom Pferd und betrat die Hütte. Hinter ihm schwang die Tür in trockenen Holzangeln. Durch die Wolkenfetzen sickerte bleiches Mondlicht und fiel über die Türschwelle. Im kalten Licht erkannte Lucky einen Tisch und eine alte Lampe, deren gläserner Zylinder rußgeschwärzt war.
Steif ging er am Tisch vorbei. Im alten steinernen Kamin röhrte der Wind. Schwach bewegten sich die mürben alten Gardinen. Ein verrosteter Blechtopf stand auf dem kleinen Herd. Auf dem alten Schlaflager lagen bleiche abgenagte Knochen und eine faulende Decke. Es stank nach Staub und Verwesung in der Hütte.
Krachend fiel die Tür zu. Erschreckt ächzte Lucky auf, wirbelte herum und hatte die Winchester auf die Tür gerichtet. Nichts geschah.
„Ich blutiger Narr“, flüsterte er. „Was ist los mit mir? Gut, dass Jim nicht hier ist. Er würde mich auslachen. Ich bin so nervös wie ein altes Weib.“
Der Wind musste die Tür zugeschlagen haben, nur der Wind.
Durch das Fenster sickerte das Mondlicht, und Lucky erkannte auf dem staubigen Boden die Spuren von Wölfen. Die Pfoten hatten im Staub und Sandbelag Eindrücke hinterlassen. Sie mussten erst vor kurzem in dieser Hütte gewesen sein. Steif und gekrümmt stand Lucky in der Hütte. Er sah nicht, wie draußen ein Körper entlang schlich, wie plötzlich ein furchtbares Gesicht draußen am Fenster auftauchte. Sein Pferd wieherte schrill, stampfte heftig und galoppierte weg. Fluchend warf sich Lucky herum. Das Gesicht war verschwunden.
Er rannte zur Tür und wollte sie öffnen, doch sie ließ sich nicht aufstoßen. Er wich zurück, nahm einen Anlauf und warf sich mit voller Wucht gegen die Tür. Sie hielt ihm stand. Seine Schulter schmerzte. Er hämmerte mit dem Gewehrkolben gegen die Tür und stöhnte auf. Nur allmählich wurde er ruhiger.
Der Wind hatte die Tür zugedrückt, und der Riegel musste von allein draußen in die Halterung gefallen sein. Tastend suchte er nach dem Riegel auf der Innenseite der Tür und fand ihn, riss ihn hoch und trat die Tür auf. Keuchend rannte er hinaus. Sein Pferd war verschwunden!
Das konnte doch nicht die Wirklichkeit sein! Wieder waren diese unheimlichen Wolfsaugen da. Wieder stierte Lucky in diese ausdruckslosen Augen, die einen so menschlich wissenden Ausdruck hatten. Im Dämmerlicht verschwanden die Augen, der Körper des Wolfes löste sich auf.
„Nein!“, stöhnte Lucky. „Ich bin doch nicht verrückt!“
Er hatte Angst vor dem Verrücktwerden, und es war gerade diese Angst, die ihn irre machte. Er rannte in die Hütte zurück, stieß gegen den Tisch und starrte hinaus.
„Jim! O Jim!“
Doch der Freund war nicht hier. Er ritt mit anderen umher und suchte wie er nach Wasser.
Unendlich langsam schwang die Tür zurück. Wieder schlug sie zu. Diesmal versuchte Lucky nicht, sie zu öffnen. Er wusste ja, wie sie geöffnet wurde. Trotz der unheimlichen Wölfe musste er sein Pferd suchen. Zu Fuß würde er während der ganzen Nacht unterwegs sein und erst am morgigen Mittag die Herde und die anderen Cowboys erreichen.
Während er noch überlegte, begann es an der Tür zu kratzen.
Wolken schoben sich vor den Mond. In der Hütte wurde es stockdunkel. Das Kratzen wurde heftiger und wilder. Lucky wich zurück und krampfte die Hände um die Winchester. Steif beugte er sich vor, stierte durch die Dunkelheit und lauschte diesem Kratzen. Draußen vor der Tür musste ein Wolf sein. Das Raubtier hatte ihn gewittert und wollte ihn töten.
Er feuerte mehrere Schüsse durch die Tür. Das Blei zerfetzte das Holz. Pulverrauch wallte in der Hütte. Draußen ertönte kein Klagen, kein Winseln. Er musste den Wolf erschossen haben. Hart lud er durch, zerrte den Türriegel weg und drückte mit dem Gewehrlauf die Tür auf.
Er sah keinen Wolf. Das Tal vor ihm war leer. Die Büsche bewegten sich im Wind wie trunkene Wesen. Reglos wie erstarrte Wächter standen die Kakteen am Talhang und streckten ihre fleischigen Arme zum Himmel empor. Durch eine Wolkenlücke zuckte Sternenlicht. Langsam trat er hinaus. Mit flackernden Augen blickte er umher.
Plötzlich stieß er mit dem rechten Stiefel gegen irgendetwas. Er senkte den Blick, starrte auf einen bleichen Totenschädel und beugte sich hinunter. Leere Augenhöhlen glotzten ihn an. Er konnte nicht schnell denken, er überlegte, ob dieser Schädel schon vorher hier gelegen hätte, aber dann hätte er ihn doch sehen müssen!
Es war der Schädel eines Menschen. Und Blut war daran noch zu erkennen.
Lucky wollte aufschreien. Er war fertig mit den Nerven. Er wollte schreien, flüchten, nur weg von hier!
Doch er kam nicht zum Schrei und nicht zur Flucht.
Jäh spürte er eine kalte Knochenhand im Nacken. Eine Klauenhand entriss ihm das Gewehr. Er stieß einen gurgelnden Laut aus. Er versuchte, sich zu wehren, doch der Unheimliche hatte entsetzliche und tierische Kraft. Die Knochenhand würgte ihn, umschloss seinen Hals. Vor Luckys Augen tanzten blutige Schleier. Er wurde zurück gerissen, über die Türschwelle geschleift. Er röchelte, griff mit zuckenden Händen umher, wurde mit erbarmungsloser Gewalt rücklings auf den Tisch gepresst.
Ein teuflisches Gesicht war über ihm.
Das Gesicht eines Toten. Riesengroß und furchtbar. Nichts war in den Augenhöhlen. Ein fauchender Laut tönte durch die Hütte. Heißer Atem traf Luckys Gesicht. Er wollte zur Seite weg, wollte diesem Ungeheuer entrinnen, doch der Unheimliche ließ nicht los, presste Lucky erbarmungslos auf den Tisch, kam mit den Zähnen immer näher.
Verzweifelt suchte Lucky nach dem Colt, doch das Gewicht des Unheimlichen presste ihm den Arm gegen den Körper. Er konnte sich nicht bewegen. Seine Augen weiteten sich. Er öffnete den Mund zum Schrei, holte Luft, da gruben sich die Zähne des teuflischen Wesens in seinen Hals und bissen zu.
Nach Sekunden trat der Unheimliche zurück, blutbesudelt und keuchend.
Leblos rutschte Lucky vom Tisch und fiel schlaff zu Boden.
Schreckliches Gelächter tönte durch das Tal. Schaurig antwortete das Echo und erstarb mit einem geisterhaften Geflüster. Blut tropfte vom Tisch. Knochige Hände packten den Cowboy. Die Füße des Toten rutschten über den Boden und über die Türschwelle. Plötzlich ertönte dumpfer Hufschlag.
Drüben am anderen Talrand tauchten drei Reiter auf. Cowboys. Sie verhielten und horchten.
„Das war doch eben ein Schrei!“
„Ja, ich habe ihn auch gehört! Da hat jemand furchtbar geschrien!“
„Hörte sich an wie Gelächter“, flüsterte der dritte Cowboy.
„Seid mal still“, raunte Jim. Steif, angespannt und wachsam saß er im Sattel. Sein schwarzes Haar glänzte im Mondlicht wie das Gefieder eines Raben. Das schmale braungebrannte Gesicht verriet höchste Anspannung. „Da drüben ist doch was!“
„Ja, da bewegt sich was!“, hauchte der blonde junge Andie. „Siehst du das nicht, Scott?“
Sie ritten in das Tal und suchten. Ewiger Flugsand wehte über den Höhenzug. In der Ferne heulten die Wölfe der Berge. Der Nachtwind winselte um die Felsen und raschelnden Sträucher.
Mitten im Tal zügelten sie die Pferde.
„Lucky!“, schrie Jim.
Das Echo verzerrte den Klang seiner Stimme.
„Andie zitterte und zeigte zwischen die Bäume und Felsen am Talhang.
„Da ist Luckys Pferd!“
Sie trieben die Pferde an und ritten den Hang empor. Scott entdeckte die Hütte und hielt darauf zu. Jim und Andie erreichten das Pferd. Es war mit dem Zügel festgebunden.
„He, Lucky, wo steckst du?“, rief Andie mit spröder, belegter Stimme. „Mann, antworte doch endlich!“
Scott saß vor der Hütte ab. Langsam ging er in die Knie und tastete über die Pfoteneindrücke eines Wolfes hinweg. Nachdenklich hob er den Blick an und starrte in die dunkel gähnende Hütte hinein.
Jim und Andie kamen mit Luckys Pferd herangeritten, hielten an und saßen ab.
„Vielleicht hat der Gaul Lucky abgeworfen“, sprach Scott schleppend. „Hier ist ein Wolf entlanggelaufen. Das Pferd wird gescheut haben, und Lucky liegt jetzt irgendwo bewusstlos zwischen den Felsen.“
„Yeah, schon möglich.“ Jim nickte. „Wir müssen ihn suchen.“
Er ging zur Hütte, hielt die Winchester im Anschlag, drehte sich neben der offenen Tür halb herum und blickte über den Boden. Verschwunden war der Totenschädel. Die Tür knarrte überlaut in die lastende Stille hinein. Dumpf schnaubten die Pferde. Eine Schleifspur führte von der Hütte weg und zwischen die abgestorbenen Bäume.
„Hier gibt es keinen einzigen Tropfen Wasser“, flüsterte Andie und zerrte unruhig an seinem strohblonden Haar. „Wenn wir nur wüssten, wo Lucky ist!“
Jim schob sich über die Türschwelle. Er roch die Verwesung, den Staub, die Knochen. Noch immer war auch der beißende Geruch des verbrannten Pulverschleims in der Hütte wahrzunehmen. Patronenhülsen lagen am Boden, von einem Winchestergewehr ausgestoßen. Blei hatte die Tür durchschlagen.
Noch hatten Jims Augen sich nicht an das Dunkel gewöhnt. Er ging weiter. Die linke Hand glitt tastend über den Tisch. Etwas Feuchtes klebte an den Fingerkuppen. Er stieß gegen die Lampe am Boden und drehte sich um, wischte die Hand am Hosenbein ab und verließ die Hütte.
„Lucky ist nicht da.“
Andie stierte auf Jims Hosenbein.
„Du blutest ja am Bein, Jim.“
„Wer? Ich? Nein.“ Jim sah auf die Hose und erschrak, blickte seine linke Hand an und schluckte schwer. „Das ist nicht mein Blut, Andie“, flüsterte er.
Sie sahen sich an, und jetzt zog Scott seinen Coltrevolver aus der Halfter.
„Du bist in der Hütte gewesen, Jim. Los, kommt!“
Wachsam und entschlossen betraten sie die Hütte. Scott riss ein Holz an. Die Flamme warf zuckendes Licht auf den Tisch. Die Cowboys sahen jetzt das Blut auf dem Tisch, am Boden und am Fenster. Andie schrie röchelnd auf, zeigte zu Boden und torkelte hinaus. Draußen übergab er sich.
Fluchtartig verließen sie die Hütte, standen draußen dicht beisammen und starrten umher. Schatten von Wolken wischten durch das Tal und über die Hänge hinweg. Das Wolfsgeheul war verstummt. Kalt war der Wind, der sich gedreht hatte und nun von der fernen Prärie herüberkam.
„Es sieht so aus, als wäre jemand abgestochen worden“, meinte Scott leise.
„Nein“, widersprach Jim, „so nicht. Vielleicht war ein Wolf in der Hütte!“
„Aber wer ist dann totgebissen worden?“, stöhnte Andie.
Die Blicke der Gefährten besagten genug. Entsetzt wandte Andie sich ab und schüttelte den Kopf. Die Angst würgte ihn. Sie brauchten viel Zeit, um den Schock zu überwinden.
„Warum sollte das nicht so sein?“, sagte Scott gedehnt und um Beherrschung ringend. „Lucky wurde von einem Wolf angefallen und totgebissen.“ Sie sahen auf die Schleifspur, krampften die Hände um die Waffen und folgten der Spur, zogen die Pferde hinter sich her und ließen sie schließlich zwischen den Felsen zurück. In der Ferne grollte es dumpf.
Sie blieben stehen und lauschten. Windstöße fauchten herüber. Sandwolken trieben durch das öde Land. Im Süden verdunkelte sich der Himmel. Graue Wolken ballten sich über dem Rio Grande zusammen. Ein Unwetter zog von Mexiko herauf. Regen. Und Wasser für die Rinder.
„Kehren wir doch um!“, bat Andie. „Wir brauchen doch nicht mehr nach Wasser zu suchen!“
„Aber nach Lucky“, knurrte Scott. „Ich will wissen, wohin diese Schleifspur führt!“
„Du hast Nerven!“, ächzte Andie. „Der Teufel wird uns alle holen!“
„Glaubst du an den Teufel?“ Scott verzog das Narbengesicht. „Es gibt keinen Teufel und keine Hölle! Alles, was hier geschieht, hat nichts mit Teufeln zu tun, Amigo!“
„Ja, nicht wahr?“ Andie lachte gepresst und zitternd auf. „Das alles ist ganz natürlich! Wir finden einen herausgebissenen Kehlkopf in einer blutigen Hütte und diese Schleifspur. Wirklich, das alles ist ganz natürlich!“
„Soll wohl ein Witz sein, wie?“, knurrte Scott.
„Ja, Compadre! Du wolltest den Witz hören.“
„Halt’s Maul. Hier mache ich die Witze“, brummte Scott. „Los, weiter. Es gibt keine übernatürlichen Dinge,
keine unheimlichen Wesen, keinen Höllenschlund.“
„Aber Menschen und Tiere, Scott“, sagte Jim leise, „und manchmal sind die schlimmer als die Hölle.“
„Ja“, wisperte Andie. „Ich habe mal von einem Untier gehört, das im Rio Grande gelauert hatte. Es soll in einer Höhle unter dem Wasser gehaust haben, und wenn Tiere an den Fluss kamen, um zu saufen, dann hat diese Riesenschlange sie ins Wasser gerissen und verschlungen!“
„Quatschkopf“, knurrte Scott. „So was Irres!“
Sie bewegten sich auf der Schleifspur weiter. Die Spur führte um die Felsen und durch das Gestrüpp. Immer wieder sahen sie Blut im Sand. Dann erreichten sie eine kleine Mulde. Hier war der Abdruck eines Menschen ganz deutlich zu erkennen. Neben dem liegenden Mann hatte jemand gekniet. Die Eindrücke waren verwischt und undeutlich. Graue Haarbüschel lagen im Sand. Sie sahen aus wie Wolfshaare.
Die Spur führte aus der Mulde und zwischen die Bäume am Hang des Höhenzuges.
Wieder grollte es dumpf. In der Ferne blitzte es fahl durch die Schwärze des Himmels.
In diesem Landstrich war Regen selten. Vielleicht regnete es nur zweimal im Jahr. Hier konnte niemand leben und existieren. Der Sandboden gab nichts her. Ewiger Flugsand bedrohte die Prärie und erstickte immer mehr Gras.
Fauchend stieß der Wind zwischen die Felslücken. Trockene Äste fielen von den Bäumen. Die Sträucher wippten und schlugen hin und her. Heiser schreiend, flogen die Totenvögel über die Felstürme hinweg und verschwanden im Dunkel der Nacht.
Die drei Cowboys wagten sich weiter. Lucky war ihr Kamerad, ihr Gefährte, und sie wollten Gewissheit über sein Schicksal bekommen. Mit feuerbereiten Waffen stapften sie um die Bäume. Holz fiel ihnen in den Nacken. Zweige schlugen nach ihnen. Jäh blieben sie stehen. Vor ihnen lag Lucky.
Er lag auf dem Rücken, Arme und Beine ausgestreckt. Sein Gesicht war eingefallen. Jacke und Hemd waren aufgerissen worden. Der Oberkörper war zerkratzt wie von Krallen oder langen Fingernägeln. Blutige Streifen führten über den Körper.
Lucky war tot.
Aber sein Tod erschreckte die Cowboys nicht so sehr wie der Anblick. Es war ein grauenvoller Anblick, der das Blut gefrieren lassen könnte.
In Luckys Körper befand sich kein Tropfen Blut mehr.
Andies Zähne schlugen klappernd aufeinander. Ein Schüttelfrost überkam ihn. Er zitterte und atmete kaum noch.
Scott stand reglos da. Er schien vereist worden zu sein. Für ihn hatte es keine Untiere aus den Tiefen der Hölle gegeben, keine Ungeheuer. Aber was er hier sehen musste, ließ ihn zweifeln und trieb ihm den Schweiß auf das aschgraue Gesicht.
Jim krümmte sich, als hätte jemand ihn in den Bauch getreten. Er presste das Gewehr an sich und konnte den Blick nicht von Lucky lösen.
„Das … das war kein … Wolf!“, stöhnte er. „Die saugen … nicht das Blut aus!“
Sie zitterten.
Das Unwetter tobte im Süden. Graue Wolkenfetzen wirbelten über den Nachthimmel.
Scott schrie unterdrückt auf. Sein Gesicht verzerrte sich und wurde zu einer hässlichen Fratze der Wut.
„Habt ihr Schiss?“, brüllte er. „Wollt ihr jetzt umkehren? Lucky ist tot! Er wurde grausam umgebracht von irgendeinem Vieh! Ich will dieses Vieh vor den Lauf bekommen, ich will es in Stücke schießen! Das muss ich für Lucky tun!“
Er stieß die Freunde an, zerrte an ihren Schultern, rüttelte sie und ließ sie los, warf sich herum und rannte an Lucky vorbei. Seltsame Eindrücke im Sand führten ihn vor eine Felsenwand. Dunkel klaffte ein Höhleneingang. Genau dort endete die unheimliche Spur.
„Kommt her!“, schrie er und winkte heftig. „Kommt doch!“
Sie rissen sich gewaltsam zusammen und folgten ihm. Zu dritt verharrten sie vor der Höhle.
„Wir haben Waffen“, flüsterte Jim. „Wir müssen hinein. Das sind wir Lucky wirklich schuldig. Andie, du kannst hierbleiben! Geh zu den Pferden zurück und bewache sie! Aber pass auf, Andie!“
Er und Scott drangen in die Höhle ein. Andie starrte ihnen nach, dann hastete er zurück und erreichte die Pferde, legte den Arm um den Hals seines Tieres und wartete voller Furcht. Das Unwetter übertönte das Rascheln der Sträucher, die heftig ausschlugen. Ächzend bogen sich die toten Bäume. Staub wirbelte über den Hang und hüllte Andie und die Pferde ein.
Unheimliches Wimmern drang zu ihm. Es hörte sich an, als würde irgendwo in diesem Staub ein Mensch elendig sterben. Diese Klagelaute zerrten an Andies Nerven, sie brachten ihn an den Rand des Wahnsinns. Seine Lippen zuckten, er betete und wünschte sich weit fort.
Schatten geisterten um ihn herum, Gestalten, die sich immer wieder auflösten, dann erneut erschienen und verschwanden. Vielleicht waren es Wölfe auf der Flucht vor dem Unwetter, vielleicht Dämonen aus dem Reich der Toten. Die Welt der Knochen stieg vor Andie auf. Skelette tanzten. Die Mäuler, knochig und bleich, waren weit geöffnet, sie schrien lautlos, sie wollten gehört werden, doch sie brachten nur tierische Laute hervor, sanken nieder und fielen zu tausend Knochen auseinander. Augen leuchteten in der Sturmnacht, gierten umher und suchten nach Opfern. Blitze zuckten über das Land hinweg. Dumpfes Dröhnen ließ die Erde erzittern.
Die Schatten verwischten, und Andie begriff, dass er mit offenen Augen einen schrecklichen Traum geträumt hatte.
Doch die unheimliche Welt blieb, sie umgab ihn kalt und fauchend. Er zitterte und fröstelte, hielt das Gewehr bereit und spürte, wie der aufgewirbelte Sand in sein Gesicht hineinschlug.
Die Pferde wieherten und keilten aus, zerrten an den Zügeln, stampften und wüteten.
Luckys Pferd riss sich los und jagte davon. Die Steigbügel schlugen gegen den Bauch, der Schweif flatterte, und schon war das Pferd verschwunden.
Mühsam hielt Andie ihre Pferde fest. Er hatte Angst, sehnte sich nach der Nähe der Gefährten, doch sie waren nicht mehr zu sehen. Verschwunden in der dunklen Höhle, die der Eingang zur Hölle zu sein schien.
Krachend schlug ein Blitz hinter den Hügeln ein. Jäh stand ein abgestorbener Baum in Flammen. Die Pferde wieherten laut, die Zügel zerrissen, die Hufe knallten gegen die Bäume, Andie stürzte zur Seite, fiel gegen einen Felsen, verlor das Bewusstsein. Schon rasten die Pferde weg.
Jim und Scott wussten nicht, was draußen geschah.
Vor ihnen gähnte es dunkel. Eine geheimnisvolle unterirdische Welt tat sich vor ihnen auf. Irgendwo vor ihnen fiel zuckend das Licht der Blitze durch die Felsspalten und erhellte sekundenlang die Grotten. Draußen wütete der Sturm. Wolken jagten über den Himmel. Die Sterne warfen ihr kaltes Licht auf die Prärie. In den Grotten blieb es länger hell.
Skorpione krochen vor ihnen entlang, den Schwanzstachel zum Todesstreich bereithaltend. Sand fiel wie Mehl von den steinernen Decken. Der Donner erschütterte die Felsmassen.
Auf dem steinigen Boden war nichts von einer Spur zu entdecken. Der Unheimliche war verschwunden.
Die beiden Cowboys standen geduckt und steif in der ersten Grotte und lauschten angespannt. Schauriges Winseln hallte durch die Grotten. Das grollende Unwetter übertönte alles. Dann wurde es draußen still.
Kühl und feucht wehte es Jim und Scott entgegen. Irgendwo vor ihnen im Dunkel tropfte es von der Felsendecke. Das monotone Geräusch hallte durch die Finsternis. Mondlicht fiel in Streifen herein.
Wagemutig bewegten sie sich weiter. Die Waffen gaben ihnen das Gefühl der Überlegenheit. Sie würden sofort schießen und sich jeden Gegner vom Leib halten, ob Tier oder Mensch.
Leise klingelten die Sporen an ihren alten brüchigen Stiefeln. Ihre Schatten wischten verschwommen über die Wände. Sie setzten tastend die Schritte und stierten umher.
Die nächste Grotte lag vor ihnen. Im Hintergrund sickerte das Mondlicht herein. Irgendetwas bewegte sich vor ihnen. Dumpfes Knurren war zu hören.
Jim biss sich fast die Lippen blutig, so angespannt war er, so wachsam und entschlossen.
Scott, älter als Jim, war äußerlich ruhig. Er verbarg die aufkeimende Furcht hinter einem starren und steinernen Gesicht. Wieder blitzte es. In den Felsmassen rumorte es dumpf, als würde eine Heerschar von unheimlichen Wesen das Gestein bearbeiten.
Dann sahen sie einen Wolf.
Die Wölfin kam gerade hoch. An den Zitzen hingen die Kleinen, rutschten ab und rollten zurück. Mit großen Sprüngen schnellte das Tier auf sie zu, und die Pfoten tappten schwer über den Boden.
Jim feuerte zwei Kugeln in den Rachen hinein. Das Blei warf die Wölfin zurück. Scotts Schüsse schleuderten den Tierkörper hoch. Zuckend fiel der Körper gegen die Felswand.
Das Echo der Schüsse tobte durch die Grotten, hin und her, und verebbte nur langsam.
„Verschwinden wir, Jim!“
Sie wollten umkehren. Wieder krachte es.
Von den Felsvorsprüngen in der Grotte rollten zwei Totenschädel herunter. Die Erschütterung hatte sie gelöst. Sie fielen vor Jim und Scott auf den harten Boden und zerbrachen. Die Zähne rollten gegen ihre Stiefel. Ein klagender Laut tönte durch das Labyrinth. Irgendwo tappte es.
Ganz in der Nähe des Höhenzuges fuhr ein Blitz zwischen die Felsmassen. Krachend lösten sich die Felsbrocken vor der Höhle und verschütteten den Ausgang.
Gesteinsstaub schlug ihnen entgegen, hüllte sie ein. Hustend warfen sie sich herum, packten sich an den Händen und rannten durch die Grotte, vorbei am toten Wolf und an den Welpen, flüchteten durch die Höhlen, durch das helle Mondlicht, erreichten eine gewaltige Grotte.
Überall lagen Schädel und Gebeine.
Graue Schatten huschten davon, noch bevor Jim und Scott sie erkennen konnten.
Jim feuerte. Nur sekundenlang verlor er die Nerven. Sie durchquerten die Grotte und sahen vor sich Sternenlicht. Viele Gänge führten aus der Grotte. Hier hatte sich vor Jahrtausenden das wilde Wasser einen Weg gesucht. Der Gang führte leicht bergan. Die kalte Luft der Nacht kam ihnen entgegen. Sie erreichten den Ausgang.
Vor ihnen lag ein großes weites Tal, umgeben von zerklüfteten Felsen. Hier war die andere Seite des Höhenzuges.
Schauriges Gelächter wurde laut.
Sie zuckten zusammen, rannten weiter, hielten keuchend und außer Atem oben auf dem Höhenzug an.
„Gerechter!“, ächzte Jim. „Glaubst du noch immer nicht an Teufel und Gespenster, Scott?“
Scott antwortete nicht, sein Gesicht war spröde und grau wie kalte Asche. Kalter Schweiß lief über sein Gesicht.
„Komm!“, flüsterte er nur.
Sie arbeiteten sich um die Felsen. Fahle Blitze fuhren über den Nachthimmel. Steine lösten sich unter ihren Stiefeln. Sie erreichten den Abhang und suchten nach Andie. Die Pferde waren verschwunden. Andie war nicht zu sehen. Sie hatten Angst um ihn.
Und sie rannten abwärts, stolperten und stürzten, rollten in das Gestrüpp hinein, hielten krampfhaft die Waffen fest, erreichten endlich das Tal, riefen wieder nach Andie.
Er gab keine Antwort. Sie suchten weiter. Sie kamen dorthin, wo sie ihre Pferde zurückgelassen hatten, wo Andie bewusstlos gelegen hatte. Der Gefährte war verschwunden.
„Ich werde noch wahnsinnig!“, stöhnte Jim. „Wir müssen Andie finden, Scott! Wenn ich daran denke, dass auch ihm das Blut ausgesaugt werden könnte, dann …“ Er brach dumpf ab und folgte Scott, der vorauslief.
Sie verließen das Tal. Immer wieder riefen sie nach Andie. Ihre Stimmen verloren sich in der Unwetternacht. Kläglich wiehernd, stand eins der Pferde abseits des Tals. Der Zügel hatte sich verfangen. Keuchend blieben die Männer neben dem Pferd stehen.
„Weiter!“, stöhnte Jim.
Sie gaben nicht auf. Sie stiegen beide auf das Pferd und ritten umher. Wenig später entdeckten sie zwei weitere Pferde und konnten sie einfangen.
„Wenn Andie uns gefolgt sein sollte“, krächzte Scott, „dann steckt er jetzt noch in den Grotten!“
Sand schlug in ihren Nacken. Der Sturm orgelte über das Land. Ausgerissene Sträucher hüpften über die Prärie.
„Komm schon“, rief Jim durch das Toben, „wir müssen Andie finden! Eher kehre ich nicht um, Scott!“
Wieder lag das Tal vor ihnen mit dem unheimlichen und zerklüfteten Höhenzug, unter dem sich die Grotten des Todes verbargen. Wieder suchten sie im Sturm nach dem jungen blonden Cowboy.
Es war sinnlos.
Erschöpft sackten sie im Sattel zusammen und schlossen die Augen. Schweigend zerrten sie die Halstücher vor Mund und Nase, um sie vor den wirbelnden Sandmassen zu schützen. Wie verloren blickte Jim über das Tal. Langsam ritten sie um die toten Bäume. Sie erreichten die Stelle, wo sie Lucky gefunden hatten. Auch der blutleere Körper ihres Freundes Lucky war spurlos verschwunden. Der Sand bedeckte alle Spuren.
„Luckys Pferd fehlt noch, Jim“, sagte Scott heiser. „Vielleicht ist er zur Herde zurückgeritten.“
Jim konnte nicht daran glauben. So groß Andies Angst auch gewesen sein mochte, er hätte sie nicht im Stich gelassen.
Sie gaben den Pferden die Sporen und jagten aus dem Tal. Überall bogen sich die knarrenden Bäume. Eine Staubwand zog auf sie zu. Tief beugten sie sich hinab und ließen den Staub über sich hinweg wirbeln.
Noch einmal schrien sie nach Andie.
Der Sturm zerriss ihre Stimmen.
„Nicht aufgeben, Jim!“, rief Scott. Er ist bestimmt bei der Herde! Vielleicht kommen die anderen uns entgegen geritten!“
Jim machte ein Gesicht, als hätte er für immer und ewig das Lachen und Lächeln verlernt.
Es begann zu regnen.
Sie kämpften gegen den Sturm an. Der Regen prasselte in ihre Gesichter, durchnässte die Kleidung. Die Kälte der Nacht machte die Hände klamm. Hinter ihnen wuchteten die Felsmassen drohend in den Nachthimmel. Noch konnten sie nicht ahnen, dass sie einer grauenvollen Zeit entgegen ritten.
Weit draußen schlugen die Flammen eines Campfeuers flach über den Boden.
Regennacht auf der Prärie.
Gebeugt saßen Männer im Sattel und umritten die brüllende Herde. Die Rinder waren unruhig, drängten umher, schoben sich durcheinander, stießen sich mit den langen Hörnern. Jeden Augenblick konnten die mexikanischen Longhorns in eine Panik geraten. Das Unwetter zog vorbei. Unablässig prasselte der Regen auf die Plane, hinter der die Männer hockten. Vor ihnen sammelte sich das Wasser in den flachen Mulden. Die Rinder hatten genug zu saufen. Langsam kehrten die Reiter an das Feuer zurück. Heftig schlug die zwischen den Bäumen aufgespannte Plane hin und her. Über dem Feuer verdampfte das Wasser.
In ihre langen Wettermäntel gehüllt, kauerten die Männer am Feuer und stierten über die dunkle Prärie.
„Sauwetter“, sagte einer.
„Aber gut für die Herde“, meinte ein anderer. „Was willst du noch mehr, Buddy? Wir brauchen nicht mehr nach Wasser suchen zu lassen. Die Jungs kommen bald zurück, und morgen treiben wir die Herde weiter nach Norden. In ein paar Tagen sind wir zu Hause. Dann ist alles vergessen.“
Mit nassen Wettermänteln setzten sich die Männer der Herdenwache in den Windschatten der Plane. Einer füllte die Blechbecher mit Kaffee. Der Flammenschein ließ die Mäntel glänzen.
Allmählich ließ auch der Sturm nach. Die Rinder beruhigten sich, standen still im Regen und murrten dumpf. Der Leitstier trottete hin und her. Zwei Cowboys wachten noch über die Herde.
Gespräche machten am Feuer die Runde. Geschichten wurden wieder lebendig. Das Wimmern des Nachtwindes ließ alte Legenden in den Hirnen der Männer spuken.
„Wir sind doch hier in dem Gebiet, wo damals die Spanier einen ganzen Indianerstamm ausgerottet hatten“, meinte ein alter Cowboy. „Das war noch lange vor der Zeit, als ihr noch in die Windeln gemacht hattet, damals, als Texas noch zu Mexiko gehörte. Ich habe mal einen Oldtimer gehört. Hier soll irgendwo ein Goldschatz der Spanier liegen.“
„In dieser miesen Gegend?“ Ein anderer Cowboy lachte leise auf. „Hier gibt es nichts als Felsen und Wüste!‘
„Wo, du Narr, glaubst du denn, Gold zu finden, he?“, grollte der Alte. „Das Geld liegt immer in der Einsamkeit, irgendwo versteckt. Sonst wäre es längst gefunden worden.“
„Das wäre ein Knaller, was?“, grinste ein Cowboy. „Wir würden Gold finden! Wir wären dann reicher als unser Boss!“
Die Herdenwache rief.
Am Feuer wurden die Männer aufmerksam. Von den Stetsons tropfte das Regenwasser herunter. Draußen auf der Prärie wieherte ein Pferd. Die Männer langten nach den Gewehren. Wenig später tauchten Jim und Scott mit Andies Pferd am Zügel auf. Sie kamen an das Feuer geritten, rutschten von den Pferden und blickten wie im Fieber umher.
„Wo ist Andie?“, krächzte Scott.
„Ist er nicht bei euch?“, knurrte der Vormann. „Ihr habt ja sein Pferd! Wo, zum Henker, bleibt Lucky? He, was macht ihr für Gesichter, was ist los mit euch? Ihr seht ja aus wie ein paar Leichen!“
Jim schluckte würgend.
„Andie ist nicht hier?“
„Nein, das siehst du doch! Mann, rede schon! Was ist passiert?“
Die Männer am Feuer richteten sich auf. Alle blickten Jim und Scott starr an.
„Sag du es ihnen, Scott.“
„Sie werden es uns doch nicht glauben“, flüsterte Scott. „Aber wir sind nicht wahnsinnig geworden, Jungs! Wir haben Lucky gefunden. Er lag tot vor uns. Das Herz war ihm aus der Brust gerissen worden. Irgendein Tier hatte ihm die Kehle durchbissen. Er war völlig ausgesaugt, er hatte nicht einen einzigen Tropfen Blut mehr im Körper!“
„Ihr seid wirklich verrückt“, entgegnete der Vormann. „So was gibt es nicht!“
„Lucky ist tot!“, schrie Jim. „Begreift ihr das nicht? Tot! Und ausgesaugt! Irgendein Vieh hat sein Blut gesoffen!“
Sie standen reglos vor ihnen. Ihre Gesichter verfärbten sich. Kalt kroch es ihnen über den Rücken. Ihre Augen flackerten heftig. Der Vormann wollte sich keine Blöße der Angst geben, denn er als Vormann war für alles verantwortlich und musste Vorbild sein für alle.
„Also gut“, sagte er gepresst, „Lucky ist tot. Vielleicht ist er vom Pferd gefallen und ...“
„Und hat sich das Herz selber ’rausgerissen, wie?“, unterbrach Scott heiser. „Irgendein Wesen, das es gar nicht gibt, hat ihm dann das Blut aus den Adern getrunken. Ja, ganz natürlich ist das, völlig natürlich! Wir brauchen darüber gar nicht weiterzusprechen. Das geschieht schließlich alle Tage, nicht wahr?“
„Macht mich nicht wahnsinnig!“, keuchte der Vormann. „Redet, aber erzählt alles ganz langsam! Keine Gedanken dazu, sagt nur, was ihr gesehen habt.“
Scott sprach. Die Männer wurden blasser. Einer bekreuzigte sich. Niemand unterbrach Scott. Die Herdenwache kam heran und hörte zu. Der Regen prasselte monoton hernieder. Die Rinder murrten. Das Feuer loderte. Der rote Flammenschein geisterte über die Gesichter. Es war still. Scott schwieg.
Über den Bergen zuckten die grellen Blitze, tauchten das bizarre Land der Hügel und Ebenen, Canyons und Höhenzüge in fahles Licht.
„Andie ist nicht hier“, krächzte der Vormann, „und der alte Buck ist nach Westen geritten, um dort nach Wasser zu suchen. Wir können die Herde nicht allein lassen! Miller, Cash, ihr kommt mit mir! Wir suchen nach Andie! Ihr anderen bleibt bei der Herde.“
„Ja, Logan.“