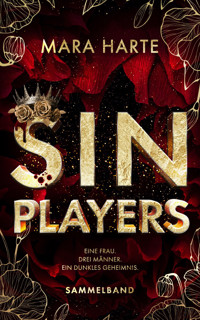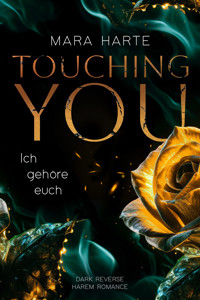3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manche Geheimnisse sollten verborgen bleiben. Doch drei Männer zwingen mich, meines zu enthüllen. Malice Kincaid istanders. Das flüstern die Leute hinter ihrem Rücken, und sie können nicht wissen, wie recht sie haben. Denn Malice hört, was andere verschweigen wollen – die intimsten Gedanken, die dunkelsten Geheimnisse. Ein Schriftstellerkurs an Schottlands rauer Küste soll ihr eine Flucht vor der Welt bieten. Stattdessen gerät sie zwischen drei Männer, die ihr keine Ruhe lassen. Und eine Bedrohung aus den Schatten, die sie bis ans Ende der Welt jagt. Zwischen Verlangen und Verrat, zwischen Vertrauen und tödlicher Gefahr.Malice muss sich entscheidenoder könnte alles verlieren. TOUCHING YOU– Eine dunkle Reverse-Harem-Romance über eine Frau mit verbotener Gabe, drei Männer, die ihr Schicksal werden, und die Frage: Kann Liebe existieren, wenn Gedanken keine Geheimnisse bleiben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ICH BERÜHRE EUCH
TOUCHING YOU
BUCH EINS
MARA HARTE
ÜBER DAS BUCH
Drei Männer – dunkel, hinreißend und verlockend.
Dorian Barnes, der mit einer Schwäche für mich kämpft.
Jamie Gray, der mich schwach macht.
Und Ezra Frost, dessen Geheimnisse größer sind als meine.
Ich bin sonderbar, sagen die Leute.
Ich wünschte, ich könnte behaupten, sie lügen.
Alles, was Malice Kincaid glücklich macht, sind ihre Familie und ihre Geschichten. Ein Schriftstellerkurs in Schottland soll die nötige Ruhe bringen, ihren Traum vom Schreiben zu verwirklichen.
Wenn da nicht drei Männer wären, die den kreativen Rückzugsort in ein wahres Tollhaus verwandeln. Und eine dunkle Gefahr, die sie bis ans Ende der Welt verfolgt.
Süße Verführungen an Schottlands Küste. Eine Chance auf Liebe und Vertrauen?
Oder am Ende nur Verrat und Schmerz?
TOUCHING YOU: Eine unverwechselbare Reverse-Harem-Dilogie von Mara Harte über eine besondere Frau, die in ihrem Bestreben, normal zu sein, über sich hinauswächst. Malice Kincaid verliebt sich in drei Männer gleichzeitig. Und glaube mir, auch du könntest dich nicht entscheiden …
Love is the only prayer, I know.
Liebe ist das einzige Gebet, das ich kenne.
~ Marion Zimmer Bradley
Für dich, weil du einzigartig bist.
* * *
PLAYLIST
Time in a Bottle – Jim Croce
* * *
PROLOG
»Wenn unter der allgemeinen Schönheit die besondere hervorsticht, darf man zweimal hinschauen. Wenn sie sich auch unter anderen Aspekten als besonders schön hervortut, darf man zugreifen, oder?«
Henry Wotton
Unter den zahlreichen zweifelsfrei wunderschönen Frauen, die mich umgaben und mir jeden Wunsch von den Augen abzulesen vermochten, stach die eine hervor.
Das The Royal Purple unterschied sich von allen anderen Nightclubs, die ich kannte, in seiner gewissen Exklusivität der Mitarbeiterinnen. Sowohl die Tänzerinnen als auch die Kellnerinnen waren spärlich gekleidet. Nun, genauer gesagt waren sie von den mit Pailletten besetzten Quasten auf ihren Nippeln und den fadenscheinigen Röckchen, die kurz genug waren, um die perfekten Rundungen der perfekten Ärsche mehr als nur erahnen zu lassen, nackt. Und jede, wirklich jede von ihnen hätte auf der Titelseite eines internationalen Modemagazins zu sehen sein können. Makellose Figuren, anmutige Rundungen, wallendes Haar, volle Lippen … Ich könnte die Vorzüge aller Mädchen stundenlang aufzählen. Und doch … und doch stach die eine hervor.
Mit schwankenden Hüften kam sie auf mich zu. Schöne Hüften. Wunderbar rund und ein bisschen voller als die der anderen, aber ganz genau nach meinem Geschmack. Schwarzes langes Haar schmiegte sich über ihre Schultern, ihre Titten … Herrgott, diese Titten wippten bei jedem Schritt und versetzten die Quasten auf den Nippeln in hypnotisierende Schwingungen. Was mich jedoch vom Hocker haute, war ihr Lächeln. Ein ehrliches Lächeln, das ihre dunklen Augen strahlen ließ und ihre hohen Wangenknochen hervorragend zur Geltung brachten.
Sie gehört nicht hierher!
Zum wiederholten Mal schoss mir heute Abend dieser Gedanke durch den Kopf. Und er machte mich seltsam unruhig und … bekümmert. Denn bei aller Exklusivität und der Tatsache, dass ein Glas Scotch hier fünfundachtzig Pfund kostete und nur erlesene Kundschaft aus der umliegenden Elite Londons anzog, wie man sie in Knightsbridge direkt am Hyde Park zuhauf fand, blieb das The Royal Purple am Ende ein Nachtclub.
»Du siehst nicht glücklich aus.« Ihre Stimme klang sanft und leise, dennoch hörte ich sie im Lärm der Musik und anderen Gäste. Sie beugte sich vor, um das Glas abzustellen. Die Wölbungen ihrer Brüste kamen mir gefährlich nahe und ich konnte mein Gehirn nicht davon abhalten, mir Bilder von meinen Lippen auf dieser blassen, weichen Haut zu schicken.
Nicht glücklich?
Wie kam sie darauf? Ich dachte an nichts anderes, als diese magische Schönheit in meinem Bett zu haben.
»Ich bin glücklich, so lange du mir meine Drinks servierst.« Ich setzte mein Flirtlächeln auf, schlug ein Bein über das andere und lehnte mich zurück. Kurz erwog ich, nach dem Glas zu greifen, bevor sie wieder verschwand, in der Hoffnung, vielleicht eine weitere Berührung ihrer Finger zu erhaschen. Ich dachte sogar daran, durch eine bewusste Bewegung die Manschette meines Hemdes verrutschen und meine auffällige Panerai hervorlugen zu lassen. Aber irgendetwas verriet mir, dass eine Frau wie sie mit einer protzigen Uhr nicht zu beeindrucken wäre.
Sie errötete. Das gefiel mir. Trotz der Umstände, die mich in diesen Laden geführt hatten, konnte es nicht schaden, an später zu denken. Irgendwann hätten wir beide doch Feierabend.
»Wie ist dein Name?«, fragte ich also in der Hoffnung, sie würde noch bleiben. Anderenfalls hätte ich den Scotch herunterkippen und gleich einen neuen bestellen müssen. Was nicht unbedingt zielführend gewesen wäre, denn für das bevorstehende Gespräch mit meinem Kontaktmann brauchte ich einen klaren Kopf.
»Ich heiße Angel.« Okay, das mit dem klaren Kopf war reines Wunschdenken. Sie strich sich eine lange Strähne hinters Ohr und knabberte auf ihrer Unterlippe herum und mein Schwanz zuckte. Natürlich hätte ich fragen können, wie ihr echter Name lautete, denn Angel war sicher nur ihr Künstlername in diesem Etablissement. Doch ich ließ es. Sie würde ihn mir ja doch nicht verraten.
»Wie soll ich dich nennen … Sir?«, fragte sie und stemmte eine Hand in die Hüfte.
Mir lief das Wasser im Mund zusammen. Ich wollte sie unbedingt.
»Henry Wotton.« Kurzerhand beschloss ich, auch nur meinen Codenamen zu nennen, unter dem mich jeder im Job kannte.
»Henry Wotton, ja?« Mit einer marginalen Bewegung legte sie den Kopf in den Nacken und entblößte die weiche Haut ihres Halses, der wie geschaffen für meine Lippen und Zähne war – zarte, sensible Haut, die ich markieren und an der ich mich laben wollte.
»Henry Wotton, exakt!«
»Freut mich, Sir Henry Wotton. Frönst du auch der Schönheit und Sinnlichkeit wie dein Namensvetter?«
Jetzt verschlug es mir tatsächlich die Sprache. Sie war nicht nur schön, sondern auch klug. Jetzt hatte sie mein ehrliches Lächeln verdient. »Wie kommt es, dass ein Mädchen, das Oscar Wilde gelesen hat, in einem Laden wie diesem arbeitet? Ich meine …«
»Ist das ein Scotch?«, unterbrach uns Winston – mein Kontaktmann. »Ich nehme auch einen.«
Zu meinem größten Bedauern verschwand Angel mit einem Nicken und überließ mich dem traurigen Ernst meines Jobs.
»Warum treffen wir uns hier?«, fragte ich Winston. Sonst trafen wir uns immer an ungewöhnlichen … nein, an absolut gewöhnlichen Orten. Auf der Tower Bridge zum Beispiel, als Touristen getarnt, oder als Besucher einer Ausstellung in der Modern Tate, manchmal auch als Geschäftsleute im The Gōng im Shard. Das minimierte die Chance, von unliebsamen Augen beobachtet und als verdächtig eingestuft zu werden. Aber ein exklusiver Nachtclub mitten in London? Das war neu.
Winston sank in den Sessel neben mir und strich sich das feuchte Haar zurück. Es regnete heute schon den ganzen Tag. Er zog einen Briefumschlag aus der Innenseite seiner Jacke und überreichte ihn mir. Auffällig unauffällig. Je natürlicher und ungezwungener wir uns verhielten, desto geringer war die Gefahr, dass uns jemand für Spione des Secret Service hielt.
Dennoch steckte ich den Umschlag sofort in den Bund meiner Hose. Ich würde mir die Details später ansehen.
»Wir treffen uns hier, weil es um sie geht«, erwiderte Winston und nickte in Angels Richtung.
MALICE KINCAID
»Darf man die ausgetretenen Pfade des Alltags verlassen, wenn sich eine Chance auftut, die geeignet ist, den Verlauf deines weiteren Lebens positiv zu beeinflussen? Darf man das Risiko eingehen – auch, wenn es nur ein Versuch und der Erfolg nicht absehbar ist?«
Dank eines ausgefallenen Zuges dämmerte es bereits, als ich an diesem Morgen meinen müden Hintern nach Hause schleppte. Ich war spät dran – oder eigentlich früh. Nicht einmal mehr Amber und die anderen Mädchen standen unten an der Ecke, dabei schickte Vaughn seine Ladys doch beinahe rund um die Uhr auf die Straße. In die dunkelsten Gassen Hackneys verirrte sich auch um sieben Uhr in der Früh gelegentlich ein Freier. Nur heute offenbar nicht.
Die Melancholie dieses verregneten Novembermorgens erfasste alles und jeden. Die Straßen waren ruhig. Nur das Rascheln des Mülls, der vom Wind über die Straße und in die verwaisten Hauseingänge geweht wurde, unterbrach die morgendliche Stille. Und der kurze endgültige Todesschrei einer Maus, die in die Fänge einer streunenden Katze geraten war.
Mein Schlüssel glitt ins Schloss und ließ sich wie immer nur nach einigen Versuchen drehen. Ich öffnete die Haustür mit dem üblichen Quietschen der Scharniere. Jede Stufe in die erste Etage erklomm ich mit einem obligatorischen Stöhnen. Nach einer Zehnstundenschicht und geschlagenen zweieinhalb Stunden, die ich wegen des Zugausfalls länger nach Hause gebraucht hatte, fühlten sich meine Füße an, als wären sie in einen Häcksler geraten.
Vielleicht würde ich mir heute Abend ein Uber gönnen. Auch wenn der Londoner Verkehr meist mit dem Auto beschwerlicher zu bewältigen war, kam man mit einem Uber oder Taxi wenigstens voran, wenn die blöde Bahn mal wieder streikte. Mit dem opulenten Trinkgeld der letzten Nacht konnte ich mir diesen Luxus ausnahmsweise leisten. Vor allem ein Gast war äußerst spendabel gewesen und noch dazu überaus attraktiv.
Wie hatte er sich genannt? Ach ja, Henry Wotton – wie der gebildete Dandy aus Oscar Wildes berühmten Roman Das Bildnis des Dorian Gray. Und ehrlich gesagt hatte ich mir beim Lesen diesen Lord Henry Wotton genauso vorgestellt: unverschämt gut aussehend, groß, kräftig, kantiges Kinn, markante Nase, das dunkle Haar etwas länger und betont unperfekt gestylt. Ein typischer Look aus der Mens Health, für den Männer vermutlich Stunden im Bad verbrachten. Allerdings wirkte besagter Mann nicht unbedingt so, als würde er mit unnötigem Tand seine Zeit vertrödeln. Sein Look mochte lässig wirken, aber ich spürte eine Stringenz, eine dunkle Gier hinter der Dandy-Fassade, die mich tatsächlich noch mehr interessierte als sein Äußeres. Ich hatte ihn beobachtet – heimlich, von der Bar aus. Was nicht einfach gewesen war, denn er hatte mir unentwegt verheißungsvolle Blicke zugeworfen. Allem Anschein nach hatte er mit mir geflirtet und ich wäre einem spontanen Abenteuer am Ende meiner Schicht nicht abgeneigt gewesen.
Aber dann war dieser Kerl aufgetaucht, die beiden hatten sich in ein Gespräch vertieft, und obwohl ich heiße Blicke unverändert auf mir gespürt hatte, war Mister Wotton am Ende meiner Schicht verschwunden. Das Einzige, was er hinterlassen hatte, war ein exorbitantes Trinkgeld.
Na ja, immerhin. Und ganz ehrlich: Welcher Mann brachte die Geduld auf, bis vier Uhr morgens auf einen One-Night-Stand zu warten?
Wenigstens war ich jetzt zu Hause. Ich sehnte mich nach einer ausgiebigen Dusche und meinem Bett. Die nächste Schicht begann in knapp elf Stunden, ich konnte mich also ausschlafen und meine Pläne für den heutigen Tag umsetzen.
Dachte ich! Dass daraus vorerst nichts werden würde, erkannte ich bereits vor der Tür zu meinem Apartment.
Sie warteten da drin auf mich.
Verdammt! Heute war der siebte November.
Ich seufzte. Okay, dann los!
Wie erwartet, empfing mich ein jauchzendes »Überraschung!«, als ich in den Flur meines Apartments trat.
Rebel war die Erste, die auf mich zustürmte und ihre Arme um meinen schmerzenden Nacken schlang. »Happy Birthday, Schwesterherz!« Sie drückte mir zahlreiche Küsse auf die Wangen, die Stirn und sogar auf den Mund. »Wir warten schon seit Ewigkeiten auf dich. Alles, alles Gute! Warte, bis du siehst, was wir für dich …«
»Eins nach dem anderen. Jetzt lass mich erst mal …«, unterbrach mein Dad die Euphorie meiner Schwester und zog sie von mir weg. Statt Rebel zog er mich jetzt in eine väterliche Umarmung, die mir richtig guttat. Ich grinste über das gesamte Gesicht und sog den vertrauten Duft nach Tabak und Old Spice tief in meine Lungen. Der Geruch nach Heimat, nach Liebe, Zuneigung und Geborgenheit, in dem ich mich geliebt und sicher fühlte, seit ich damals mit Rebel der Hölle entfliehen konnte.
»Sieh dir mein kleines Mädchen an! Vierundzwanzig, du liebe Güte! Wo ist die Zeit geblieben? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!« Ich lehnte mich an Dads starke Brust, während er einen Kuss auf meinen Scheitel drückte und ähnlich an mir schnüffelte, wie ich es gerade bei ihm getan hatte.
»Jetzt bin ich dran. Lass mich zu unserem Kind, Edward!« Und schon wurde ich weitergereicht, an den zweiten Mann, ohne den ich heute nicht mehr am Leben wäre. Weder ich noch Rebel. Mein anderer Dad zog mich in eine ebenso innige Umarmung, wenn auch nicht so fest wie die vorherige. »Du arbeitest zu viel, mein Herz. Ich liebe dich so sehr und wünsche dir alles Gute – nur das Beste. Geh deinen Weg und verwirkliche deine Träume!«
»So ist es, Richard. Das ist unser Stichwort.«
Endlich ließen die zwei von mir ab und ich konnte wieder atmen. Alle Müdigkeit war verflogen, als ich in die aufgeregten Gesichter meiner Familie, deren Wangen vor Aufregung gerötet waren, blickte, und in die erwartungsvollen Augen, in denen nichts als Liebe glänzte.
Eine Sekunde gewährte ich mir und suhlte mich in der Zuneigung, der Geborgenheit und bedingungslosen Liebe. Gefühle, die ich von meinen leiblichen Eltern nie erfahren durfte, mir aber von diesen beiden Männern seit neunzehn Jahren aufopferungsreich geschenkt wurden. Mir und Rebel.
Unseren leiblichen Vater hatten wir nie kennengelernt. Ob unsere Mutter noch lebte, wussten wir nicht. Es war uns egal. Rebel und ich hatten mit dem Thema schon vor Jahren abgeschlossen. Uns fehlte nichts, obwohl das Leben in London … das Überleben nicht gerade einfach war. Wir hatten uns, mehr brauchte ich nicht. Falls es notwendig gewesen wäre, hätte ich auch zwischen Mülltonnen oder unter einer Brücke gehaust, um diesen wunderbaren Menschen nahe zu sein.
»Jetzt gib es ihr doch endlich, Richard!« Meine Dads schienen aufgeregter zu sein als bei meinem Schulabschluss.
»Jaja, geht schon los!« Daddy Richard beugte sich über den runden Holztisch, der den Großteil des Wohnzimmers einnahm. Ein Erbstück und sein ganzer Stolz, wie er nicht müde wurde zu erwähnen.
»Oh, ich bin so gespannt, was sie sagt.« Rebel freute sich wie ein kleines Kind am Weihnachtsmorgen, klatschte vor lauter Freude in die Hände und wippte auf den Fußballen.
»Das hier ist ein Geschenk von uns allen«, sagte Daddy Edward feierlich, während mir Daddy Richard einen weißen Umschlag überreichte und so tat, als befänden sich darin die Kronjuwelen des Königs. »Wir haben alle zusammengelegt, weil wir glauben, dass wir dir so eine Freude bereiten können. Hoffentlich freust du dich. Es ist alles bezahlt. Du musst nur deine Tasche packen, dann geht es am Wochenende los. Wir werden dich vermissen, glauben aber, dass es das ist, was dir …«
Daddy Edward seufzte und brachte seinen langjährigen Lebenspartner und mittlerweile sogar Ehemann damit zum Schweigen. »Jetzt quatsch nicht rum, Richard! Gib ihr den Umschlag, Herrgott!«
Ich fuhr mir mit beiden Händen übers Gesicht, um die Müdigkeit zu vertreiben. Ich wollte jetzt nicht an Schlafen denken. Zu überwältigt fühlte ich mich. Es war ja nicht so, dass ich nicht mit einer Überraschung gerechnet hatte. Und selbstverständlich würde ich mich freuen – egal, was in diesem Umschlag war. Wir beschenkten uns alle gern und regelmäßig. Geburtstage waren in dieser Familie eine große Sache, ebenso Weihnachten, der Hochzeitstag meiner Dads, der Tag unserer Adoption und der Valentinstag. Doch die Aufregung, die allen dreien ins Gesicht geschrieben stand, und die Tatsache, dass sie alle um sieben Uhr morgens auf den Beinen waren, um mich zu überraschen, toppte alle meine Erwartungen.
Was hatten sie nur ausgeheckt?
Etwas, wofür ich meine Tasche packen musste.
Die Neugier war kaum noch auszuhalten, also griff ich nach dem Umschlag.
Mein Griff ging ins Leere, als mein Dad seine Hand schnell zurückzog. Ich lachte. »Hey!«
Sein Blick wurde ernst. »Keine Ausreden, Mali! Du ziehst durch, was wir dir schenken.«
»Ihr macht es verdammt spannend.« Erneut griff ich nach dem Umschlag. Erneut ohne Erfolg.
»Versprich es!«
»Ich weiß doch gar nicht, was es ist. Wie kann ich dann etwas versprechen?«
»Es wird dir gefallen«, versprach meine Schwester. »Aber du musst aus deiner Komfortzone raus.«
Meiner was?
Ich blinzelte verwirrt. Was redete sie denn da? Ich schuftete die Nächte durch, um meinen Teil zum Überleben der Familie beizutragen, und konnte mir selbst mit dreiund… vierundzwanzig Jahren immer noch keine eigene Bude leisten, also welche Komfortzone?
Bevor ich den Mund öffnen und meiner Entrüstung über Rebels unsensible Äußerung Ausdruck verleihen konnte, drückte Daddy Richard mir den Umschlag in die Hand.
»Mach auf!«
»Ich … danke euch und werde mich bemühen, nicht mehr zu sehr in meiner Komfortzone rumzugammeln.« Den spitzen Seitenhieb konnte ich mir nicht verkneifen, während ich die Lasche öffnete und ein Blatt weißes Papier hervorholte. Behutsam faltete ich es auseinander. Festes weißes Papier, auf einer Seite beschrieben. Mein Blick fiel auf ein verschnörkeltes Emblem in der Mitte des oberen Randes – oval, mit Goldprägung, zwei hübsch ineinander verschlungene Buchstaben, D und C, mit einer Distel, Ornamenten und Ranken verziert. Darunter die Worte: Dreich McCulloch.
Klang schottisch.
»Was ist das?«
»Lies!« Die Aufforderung kam unisono aus den Mündern meiner Väter.
Noch einmal ließ ich den Blick über die drei Gesichter wandern, die mich so voller Erwartungen anstarrten, und konzentrierte mich dann auf das Schreiben.
Okay! Da stand etwas von Schreibimpulsen und literarischem Handwerk, von Kursen für Kreativität, Coaching für Pitch und Exposé. Aha! Das hier war die Einladung zu einem Schreibkurs in einem schottischen Schloss mit dem wundervoll mystischen Namen Dreich McCulloch.
Verblüfft las ich alles noch einmal.
»Ihr schenkt mir einen Schreibkurs?«
Wieder klatschte Rebel in die Hände und hüpfte vor lauter Aufregung. »Jaaa, wir schenken dir einen Schreibretreat! Ist das nicht toll?«
DAS SCHLOSS
»Sonderbar – das ist es, wofür mich die Leute halten. Umso besser, mal dem Alltag entfliehen zu können und in einer fremden Umgebung mit gleichgesinnten Menschen Kontakte zu knüpfen.«
Die Nacht war tiefschwarz. Trotzdem erblickte ich mein Ziel schon von Weitem. Dreich McCulloch war ein altes Schloss aus dem sechzehnten Jahrhundert. Einst hatte es einem schottischen Lord gehört, heute war es Teil einer großen Hotelkette und ein beliebter Ort für Seminare, Veranstaltungen … und Schriftstellerkurse. Korrektur: Schreibretreats.
Die Vokabel hatte ich bei Google nachgelesen. Schreibschaffende Profis zogen sich bisweilen zu sogenannten Schreibretreats zurück, um ihre Ideen und Gedanken zu sortieren und ohne Ablenkung an ihren Geschichten zu arbeiten. Für mich war das neu, schließlich träumte ich bisher nur davon, Schriftstellerin zu werden. Aber der Ort schien perfekt zu sein.
Das Schloss stand direkt an der Atlantikküste, etwa fünfzig Meilen nördlich von Glasgow. Am Ende der Welt – im wahrsten Sinne. Bis Fort Williams hatte mich der Zug gebracht, von dort hatte ich mir ein Taxi nehmen müssen.
Ich blickte staunend aus dem Fenster und entdeckte über dem Meer das gelegentliche Aufblitzen eines Lichtkegels, vermutlich ein Leuchtturm. Sonst nur Schwärze. Und Sterne, jede Menge Sterne. Wow, war das schön!
Der schweigsame Taxifahrer bog irgendwann ab und steuerte eine Kiesauffahrt entlang, vorbei an beleuchteten Brunnen, die von Buchsbäumchenreihen gesäumt waren, direkt vor einen opulent beleuchteten Eingang. Korrektur: ein Portal. Geschmückt mit Wasserspeiern und Steinskulpturen führte eine geschwungene Treppe zu einer doppelflügeligen Holztür, an der das Symbol der schottischen Distel, wie es auf dem Schreiben abgebildet gewesen war, und ein anderes mit einem Löwenkopf und einer Blüte prangten.
Ich bezahlte den Taxifahrer und schluckte schwer bei der Summe, die er verlangte, rief mir aber gleich ins Gedächtnis, dass ein Mietwagen noch teurer gewesen wäre. Ich würde mich einfach in den kommenden zwei Wochen nicht vom Platz rühren, die Umgebung allenfalls zu Fuß erkunden und ansonsten nur schreiben. Das war schließlich Sinn und Zweck eines Schreibretreats, soweit ich wusste.
Meine Dads und Rebel hatten sich wirklich ins Zeug gelegt, um mir diesen Wunsch zu erfüllen, den ich in dieser Form nie laut geäußert hatte. Umso mehr freute ich mich und war meiner Familie unendlich dankbar. Die drei glaubten so sehr an mich und meine Geschichten. Ich schrieb, seit ich wusste, welche Magie die Aneinanderreihung von Buchstaben auslösen konnte. Aber es war nie mehr als ein Hobby gewesen. Deshalb fiel es mir schwer, nicht daran zu denken, dass ich zwei Wochen Verdienst und Trinkgelder verlor, während ich mich meinem Traum hingab, das Schreiben als Handwerk zu erforschen. Das war purer Luxus!
Mein Herz klopfte, als das Taxi wendete und in der Dunkelheit verschwand. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch drückte ich die schwere Klinke des Portals nach unten und betrat eine unbekannte Welt.
Die riesige Holztür knarzte laut und ließ sich nur schwer aufschieben. Ein modriger Geruch schlug mir entgegen, der wohl typisch für so alte Gemäuer war. Die Absätze meiner Boots hinterließen eigentümliche Geräusche auf den dunklen Steinplatten einer großen Halle. Sie wirkten wie Störenfriede. Hinter mir schlug das Portal mit einem lauten Gebrüll zu. Erschrocken zuckte ich zusammen und konzentrierte mich auf das Interieur, das aus der Zeit gefallen zu sein schien … nein, alles um mich herum wirkte, als wäre ich aus der Zeit gefallen. In einem mannshohen Kamin zu meiner Linken brannte das Feuer, als täte es seit fünfhundert Jahren nichts anderes. Über mir hing ein hölzerner Kronleuchter, der dort ebenfalls seit vielen Generationen den Raum erhellte. Mit Goldfäden gewirkte Bezüge auf antiken Ohrensesseln, zwei gekreuzte Schwerter auf einem Naturstein über dem Kaminsims, daneben ein abgenutzter Gobelin-Wandteppich, vor dem Fenster eine rostige Ritterrüstung. Nichts deutete darauf hin, dass wir das einundzwanzigste Jahrhundert erreicht hatten.
Bis auf den Tresen am Fuße einer gigantischen Treppe, auf dem ein Computerbildschirm stand. Dahinter hieß mich ein junger Mann mit schwarzem, akkurat frisiertem Haar und einem warmen Lächeln willkommen.
»Als würde man durch die TARDIS gehen, was?« Sein Lächeln wurde breiter.
»Hm?« Merkwürdige Begrüßung. Wovon redete der Kerl?
Mein fragender Blick und die fehlende enthusiastische Erwiderung auf seine originelle Begrüßung taten dem Frohsinn in seinem Gesicht allerdings keinen Abbruch. Er nickte in Richtung Eingang. »Die TARDIS? Doctor Who?« Der Rezeptionist lachte noch breiter. »Entschuldigen Sie. Ich meinte, es ist ein bisschen so, als würde man in ein vergangenes Jahrhundert springen.«
»Ach so! Doctor Who, natürlich.« Ich lachte, als es endlich bei mir im Oberstübchen klingelte. »Wie eine Zeitreise. Daran dachte ich gerade, ja.«
Meine Antwort schien ihm zu genügen, denn er nickte und machte sich an das Prozedere des Check-in. Er verlangte nach meinem Pass und meiner Kreditkarte – nur zur Sicherheit, sagte er, es wäre bereits alles bezahlt. Während ich eincheckte, spürte ich es …
Einen Lufthauch. Die Härchen auf meinen Unterarmen stellten sich auf, meine Fingerkuppen summten. Der Geruch nach Bitterorange manifestierte sich in meiner Nase.
So war das immer.
So stellte sich das … Wissen, die Ahnung ein.
Ich konnte dem Drang nicht widerstehen, meinen Kopf zu drehen und in die dunkle Nische zu starren, von wo aus eine Treppe mutmaßlich in den Keller führte.
»Alles in Ordnung, Ma’am?«, fragte der Rezeptionist und verfolgte meinen Blick, während er einen Schlüssel von einem altmodischen Brett mit Haken hinter sich holte und über den Tresen schob. Insgesamt zählte ich achtzehn Haken … nein, siebzehn, denn der dreizehnte war ausgespart worden.
An meinem Schlüssel hing ein Messingschild mit der Nummer sieben.
Super! Meine Lieblingszahl.
»Ähm, ja, ähm, ich …« Stotternd nahm ich den Schlüssel und blickte noch einmal verhalten zurück. »Ich dachte nur … Ach, nichts.«
»Verzeihen Sie die Anmaßung, Miss Kincaid. Geht es Ihnen gut? Aber Sie sehen so aus, als sollten Sie sich setzen.«
Warum? Wie sah ich denn aus?
»Nein, danke … ich … Nein!« Herrje, wenn ich jetzt noch mehr stotterte, hielt er mich für eine Verrückte. Trotzdem kam ich nicht umhin, mich noch einmal umzudrehen.
»Die Treppe führt in unser Gewölbe.« Offenbar fühlte sich der Rezeptionist durch mein seltsames Verhalten genötigt, mir eine Erklärung zu liefern. »Sie finden dort eine Bar und den Weinkeller. Frühstück gibt es im Rittersaal am Ende des Flurs.« Er zeigte auf einen Gang gegenüber vom Tresen, dann hinauf zu der gigantischen Treppe. »Ihr Zimmer befindet sich im dritten Stock. Einen Aufzug gibt es leider nicht. Brauchen Sie Hilfe mit dem Gepäck?«
Aus Angst, es würden wieder nur Bruchstücke meinen Mund verlassen, schüttelte ich stumm den Kopf, hob zur Bestätigung meine Reisetasche an, die ich bequem über der Schulter tragen konnte, und bedankte mich mit knappen Worten. »Vielen Dank, ich schaff das allein.«
»Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Dreich McCulloch, Miss Kincaid!« Die Erleichterung, dass ich mich abwandte, konnte der Rezeptionist nicht aus seinen Worten halten.
Sonderbar!
Tja, so war ich eben. Die Leute reagierten bisweilen seltsam auf mich. Vielleicht lag es auch an diesem Schloss. Es war alt, verwinkelt, voller Schatten und zugiger Ecken. Seltsam war also noch harmlos ausgedrückt.
DAS MEER
»Fehlende Worte, speiende Übelkeit und eine spontane Ohnmacht – es gibt schönere Möglichkeiten, einen umwerfenden Mann kennenzulernen.«
Bei jedem Schritt versanken meine Zehen in dem plüschigen Teppich, als ich an diesem Morgen und nach einer erstaunlich erholsamen Nacht an das mindestens zwei Meter hohe Fenster schlich. Die Vorhänge waren zugezogen – waren sie gestern Abend schon gewesen, als ich das Zimmer betreten und nach einer heißen Dusche nur noch halbtot ins Bett gefallen war. Mit beiden Händen zog ich erst die eine Seite, dann die andere Seite des Stoffes zur Seite, der sicher einen halben Zentner wog – jeweils.
Es dämmerte – großzügig ausgedrückt. Der Himmel nahm langsam eine bläuliche Färbung an und war nicht mehr tiefschwarz. Voluminöse graue Wolken erschwerten es der Sonne, sich durchzusetzen, aber das war mir nicht nur egal, es gefiel mir sogar.
Pluviophilie hieß das – die enorme sensorische Faszination für Regentage. Ich war pluviophil. Ich liebte solche Tage. Ich liebte den Regen. Und ich liebte den Herbst. Mystische Wolken, Nebel in der Luft und schwere Regentropfen, die ans Fenster klopften. Ja, so war es mir am liebsten. Wenn ich Zeit für mich hatte, meinen Gedanken anstandslos nachgehen und schreiben konnte. Herrlich!
Was alles verglichen mit dem heutigen Morgen mit Nebel und Regeln und Wind am Atlantik verblasste.
Ich starrte aus dem Fenster und genoss dieses wohlige Gefühl, das sich in meiner Brust breitmachte.
Direkt unter meinem Fenster erstreckte sich ein gepflegter Garten. Der Rasen war akkurat geschnitten, sein sattes Grün bildete einen wunderbaren Kontrast zum bleigrauen Himmel und dem Meer.
Das Meer!
O mein Gott, ich konnte das Meer von meinem Fenster aus sehen. War das nicht der pure Wahnsinn?
Der Atlantik erstreckte sich majestätisch vor mir. Kein Horizont, keine Barriere zwischen mir und der Natur. Schaumkronen blitzten hie und da auf, und selbst durch die dicken Fensterscheiben konnte ich das tiefe Rauschen hören. Beeindruckt von so viel herber Schönheit, folgte mein Blick einem Kiesweg zu meiner Rechten, der bis ans Ende des Gartens führte und von schmiedeeisernen Laternen gesäumt war. Kam man von dort etwa direkt an den Strand?
Schnell lief ich ins Bad, putzte meine Zähne und schlüpfte in Jeans, Rollkragenpullover und Socken. Mein Haar steckte ich zu einem Knoten im Nacken zusammen und stülpte mir eine Wollmütze über, die bis über die Ohren reichte. Ich schnappte mir mein Telefon, schob es in die Gesäßtasche meiner Jeans und schnaufte, als ich mit Mühe meine Füße mit den dicken Wollsocken in meine Ankle Boots stopfte.
Viel Zeit bis zu meinem ersten Kurs blieb mir nicht, wenn ich vorher noch ausgiebig frühstücken wollte, aber eine halbe Stunde würde genügen, um mir den Atlantikwind um die Nase wehen zu lassen und einige tiefe salzige Atemzüge nehmen zu können. Summende Vorfreude machte sich in meinen Muskeln breit, als ich nach meiner Jacke griff und aus dem Zimmer trat.
Die Rezeption war verwaist und überhaupt begegnete ich keiner Menschenseele. Die Luft war kalt und feucht in den Fluren und im Foyer. Auf einem Tisch neben dem Tresen der Rezeption stand eine Vase mit frischen Amaryllis-Blüten. Davor lagen Quittenfrüchte als Dekoration um ein Schwert, das auf einem samtenen Kissen gebettet war. Ich stellte mir vor, wie Lord Wer-auch-immer vor einigen hundert Jahren hier seine Gäste empfangen, Fehden gegen rivalisierende Ritter geplant und angemessene Vermählungen seiner Töchter arrangiert hatte.
Mmh, alles hier roch nach alten Geschichten. Ich hätte mich sicher gut gemacht als eine Tochter des Lords: melancholisch, zurückgezogen, Bücher lesend, stickend am Kamin, am Turmfenster in den Regen schauend und auf meinen Prinzen wartend. Na ja, das mit dem Sticken vielleicht weniger, aber dieser mystische, schwermütige Touch hätte mir ganz bestimmt gut gestanden.
Ich schmunzelte über meine romantischen Gedanken und schlenderte weiter durch die große Halle, als wäre ich hier zu Hause.
Ein Schild wies den Weg nach draußen zum Strand, und als ich die Tür aufdrückte, blies mir der harte und salzige Wind des schottischen Nordens ins Gesicht. Regen liebkoste meine Haut, ich schloss den Reißverschluss meiner Jacke bis zum Kinn und schob mir die Kapuze tief über die Stirn.
Das war genau mein Wetter.
Ich spürte die Kühle auf meinen Wangen, das Zerren des Windes an meiner Kleidung, während dieser mir fast die Luft zum Atmen nahm. Ich öffnete den Mund und schmeckte das Salz auf der Zunge. Gott, war das gut!
Am Ende des Rasens, der durch Myriaden feiner Wassertröpfchen aussah wie mit Diamanten verziert, führten sechs in den Fels gehauene Stufen an einen Sandstrand, der gerade von der Flut erobert wurde, wie mir schien. Ich lief ein Stück und wünschte, meine nackten Zehen in den groben Sand graben zu können. Doch dafür war es heute definitiv zu kalt. Alternativ bücke ich mich und steckte meine Finger in den körnigen Sand. Gott, war das schön! Wenn es etwas gab, das ich noch mehr liebte als verregnete Herbsttage, dann war es das Meer. Der Atlantische Ozean an einem verregneten Herbsttag war der Inbegriff von Perfektion. Mein Herz füllte sich mit Glück, meine Muskeln entspannten sich und in meinem Kopf hörte ich nichts als das Rauschen des Meeres. Angesichts dieser unfassbaren Schönheit fühlte ich eine Verbundenheit mit Mutter Natur, der einzigen Mutter, die ich wertschätzen konnte. Zufriedenheit wärmte mich und das Wissen, Teil dieses großartigen Schauspiels zu sein. Ein Gefühl, das mich dazu verleiten konnte, die Augen zu schließen und einfach nur zu sein. Ich hörte meinen Atem. Ich spürte, wie mein Herz schlug und meine Adern mit heißem Blut füllte. Ich roch die Weite und fühlte den Puls der Erde unter meinen Füßen.
Das Wasser rollte in rhythmischen Wellen an den Strand, zog sich zurück, wobei die murmelgroßen Kieselsteine aneinanderrieben und ein Geräusch erzeugten, das mich hypnotisierte. Es hatte etwas Meditatives, dem Klang der See zu lauschen. Und ich hätte wohl ewig am Strand hocken können, die Hände tief im Sand vergraben, doch dann fiel mir ein Detail auf, das nicht ins spektakuläre Bild passte.
Die Nacht war vertrieben, und obwohl der Tag noch nicht die volle Kraft hatte, war es hell genug, um zu erkennen, dass auf einem Felsen am Ende des Strandes etwas lag. Etwas Dunkles, Unförmiges. Noch konnte ich nicht erkennen, was es war, also stand ich auf und ging ein paar Schritte. Der Strand war nicht besonders lang, kaum zwanzig Meter. Ich hoffte, es wäre keine tote Robbe oder so. Oder eine lebende.
Ich kniff die Augen zusammen und schlang die Arme um meinen Körper, als ich den Felsen erreichte. Nein, da lag keine Robbe, sondern Kleidung. Eine Jacke, Hosen und Stiefel.
Wer …?
Ruckartig hob ich den Kopf, blickte aufs Meer hinaus und erkannte nach nur wenigen Sekunden einen dunklen Punkt. Wer zur Hölle konnte denn bitte so verrückt sein, bei dieser Kälte baden zu gehen? Es war November, verdammt! Der Atlantik hatte nicht mehr als vielleicht fünf Grad Celsius.
Heilige Scheiße!
Der Punkt näherte sich. Tatsächlich schwamm da jemand, der lebensmüde sein musste.
Ein Mann.
Er schwamm direkt auf mich zu – na ja, einfach in Richtung Strand. Starke Arme wirbelten gleichmäßig durch die Fluten. Der Kerl war nicht nur verrückt und lebensmüde, sondern wohl auch ziemlich gut trainiert. Es brauchte Kraft, sich auf diese elegante Weise im rüden Atlantik fortzubewegen. Vor allem im November! Ich war nicht unsportlich, ging liebend gern joggen und sogar gelegentlich im Kings Hall Leisure Center schwimmen, aber das Tempo, das dieser Kerl an den Tag legte, suchte seinesgleichen. Beeindruckt blieb ich stehen und beobachtete definierte Muskeln und dunkles Haar – so rabenschwarz wie meines.
Und mit einem Mal stoppte er und erhob sich aus dem Wasser.
Später glaubte ich, das war der Moment, an dem meine Welt aufhörte, sich zu drehen.
Warum?
Na ja, auf einen banalen Nenner gebracht, ging es zunächst nur darum, dass ich Augenzeugin einer fleischgewordenen Verführung wurde. Der Oberkörper des Mannes war an Perfektion nicht zu überbieten. Breite Schultern und Bizepse, an denen eine Frau sich in jeder Lebenslage festhalten konnte. Eine muskulöse Brust, darunter ein Sixpack … Puh, der Kerl sah aus wie gemalt! Und als Kirsche auf dem Sahnehäubchen war seine glatte Haut mit kunstvollen Tattoos geschmückt, die der perfekten Gesamterscheinung etwas Verwegenes verliehen. Wieder kniff ich die Augen zusammen, diesmal um die perlenden Tropfen des Atlantiks zu erspähen, die auch hier Diamanten gleich diesen unfassbar schönen und wie in Stein gemeißelten Körper verzierten.
Wie in einem Parfum-Werbespot entstieg der Kerl den Fluten, fuhr sich in Zeitlupe durch sein nasses Haar und präsentierte ein Lächeln, das mich aus den Socken hob, während das Wasser nur widerwillig an seinem Körper herunterfloss und meinem Blick die Aufmerksamkeit vorgab. Schwarzer Flaum bildete unterhalb seines Bauchnabels einen sexy Streifen und stahl sich in den Bund der ebenso schwarzen Badeshorts. Kräftige Oberschenkel und Waden machten es mir schwer, woandershin zu sehen. Selbst seine Füße waren wunderschön. Wie in Trance hob ich den Blick und stellte fest, dass sowohl meine Person als auch mein wenig subtiles Starren bemerkt worden waren.
Dieses atemberaubende Lächeln lag immer noch auf seinen nicht weniger atemberaubenden Lippen. Natürlich! Dieser Mann war es gewohnt, angestarrt zu werden, als wäre er höchstpersönlich die gezuckerte Kirsche auf dem Sahnehäubchen, das den Eisbecher zierte. Obwohl ich es nicht wollte, dachte ich an Eis, das ich von diesem perfekten Body leckte.
»Du starrst«, sagte er und trocknete sich ab.
Sollte das eine Begrüßung sein?
Selbstverständlich starrte ich, glotzte ihn an, als wäre er Poseidon, der Fürst des Meeres. Und natürlich war das seltsam. Für mich. Für ihn bestimmt nicht. Er feixte vermutlich innerlich über meine Dämlichkeit.
»Es ist nicht so kalt, wie man meinen könnte.« Er rubbelte sich die Haare trocken, was ich gern getan hätte, und schlang das Handtuch um seine Hüften. Auch dabei hätte ich gern geholfen. Mmh … Verdammt, ich starrte ihn schon wieder an! Er griff nach einem schwarzen Wollpullover und zog ihn über den Kopf. Das Handtuch fiel in den Sand. Er ließ es liegen und schob seine Finger in den Bund der Badeshorts.
»Du starrst immer noch. Willst du mir dabei zusehen?«
Ach, du liebe Güte!, wäre die offizielle Reaktion gewesen.
Hm, liebend gern, war die tatsächliche.
Schnell drehte ich mich um, nicht jedoch, ohne vorher den Ansatz schwarzer Härchen erhascht zu haben und mir zum ersten Mal in meinem Leben wünschte, nicht die Weite des Atlantiks betrachten zu müssen.
»Tut mir leid«, murmelte ich halbherzig, er lachte leise.
Nach einer gefühlten Ewigkeit hörte ich das Scharren von Stiefeln im Sand. »Ich bin übrigens Jamie.«
Ich drehte mich und durfte jetzt wieder den Mann betrachten, dem es gelang, mir den Atem zu rauben wie der Wind vom Ozean. Sein Gesicht … Jamies Gesicht könnte man zusammenfassend als kantig-männlich-schön beschreiben – ein ausgeprägter Unterkiefer, auf dem ein perfekt gestutzter Dreitagebart wuchs. Markante Augenbrauen, ebenso schwarz wie das wuschelige Haar. Markant war auch seine Nase, lang und gerade, nur zwischen den ebenfalls dunklen Augen erhob sich ein kleiner Höcker. Dieser vermeintliche Makel machte sein Gesicht vollkommen. Vom Rest seines Körpers, der jetzt von einem schwarzen Pullover, Jeans und Boots verdeckt wurde, ganz zu schweigen.
Und obwohl Jamie bemerkenswert schön, ein bisschen verrucht und irgendwie geheimnisvoll vor mir stand, bemerkte ich hinter dem coolen Lächeln etwas, das ich noch weitaus interessanter fand. Dieser Mann litt. Er war gebrochen und auf der Suche nach etwas.
Ich konnte es spüren, eine tiefe, bodenlose Traurigkeit. Da war wieder dieses Summen, das meine Fingerkuppen erfasste und nie etwas Gutes verhieß. Eine Vibration, als würde ich auf einem magischen Meridian tanzen, inmitten von Stonehenge, kurz bevor sich das Portal in eine andere Dimension öffnete …
Nein, das war natürlich Quatsch.
»Ich heiße Malice.« Schnell nannte ich ihm meinen Namen, bevor das Summen stärker wurde, meine Gedanken ins Reich der Fantasie wanderten und die Situation noch merkwürdiger werden könnte – merkwürdiger, als sie es ohnehin schon war, denn ich war mir sicher, dass ich ihn anstarrte, als würde ich König Charles persönlich gegenüberstehen.
Und hatte ich eigentlich in den vergangenen Minuten geblinzelt?
»Malice?« Er sprach meinen Namen nicht nur fragend, sondern auch mit einer gehörigen Portion Schrecken aus.