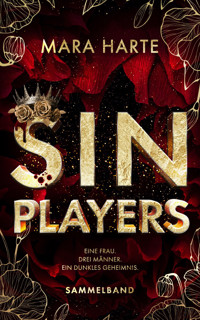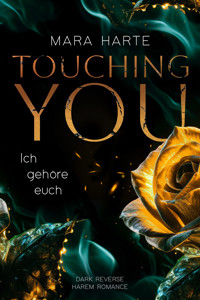
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Männer gegen eine Welt voller Feinde,und ich mittendrin. Ich bin geflohen, um sie zu schützen. Jetzt haben sie mich gefunden,und die Gefahr ist größer als je zuvor. Dorian Barnes will die Last der Welt für mich tragen. Jamie Gray braucht mich mehr, als er zugeben kann. Und Ezra Frost? Ihn liebe ich mit einer Intensität, die mich verschlingt. Wir sollten nicht zusammen sein. Jede gemeinsame Minute bringt uns näher an den Abgrund. Doch wie soll ich mich wehren, wenn mein Herz bereits entschieden hat? Die Stimmen in meinem Kopf werden lauter. Die Bedrohung rückt näher. Und die Frage brennt: Bin ich stark genug, um nicht nur ihre Gedanken zu hören, sondern auch ihre Herzen zu retten? Manchmal bedeutet Liebe, sich dem Sturm zu stellen,auch wenn er dich zu zerstören droht. TOUCHING YOU: Band 2– Das finale Kapitel einer dunklen Reverse-Harem-Romance über eine Frau, die zwischen Flucht und Kampf, zwischen Aufgabe und bedingungsloser Liebe wählen muss. Malice’ Geschichte endet hier,aber nicht so, wie du es erwartest.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ICH GEHÖRE EUCH
TOUCHING YOU
BUCH ZWEI
MARA HARTE
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2024 RebelYou Publishing
Ariana Lambert, Sandy View, Seamount, Courtown, Ireland
Korrektorat: Ariana Lambert
Cover: Epic Moon Coverdesign
https://epicmooncoverdesign.com/
Erstellt mit Vellum
TOUCHING YOU
ICH GEHÖRE EUCH
ÜBER DAS BUCH
Drei Männer gegen den Rest der Welt.
Auf der Suche nach einer Frau, die wertvoller ist als alles.
Ich bin gegangen, um sie zu schützen.
Jetzt sind sie wieder da – und ich weiß nicht, ob wir jemals sicher sein können.
Wir sollten nicht zusammen sein.
Aber wie kann ich mich dagegen wehren, wenn Dorian Barnes die Last der Welt für mich schultern will, wenn Jamie Gray meine Hilfe braucht und ich Ezra Frost einfach nur bedingungslos lieben möchte.
Ich bin sonderbar, sagen die Leute.
Und es ist mir egal, ob sie damit recht haben oder nicht.
Aber bin ich auch stark genug, mich allen Widrigkeiten zu stellen?
Kann ich den Gefahren trotzen und überleben?
TOUCHING YOU ist eine Reverse-Harem-Dilogie über eine besondere Frau, die sich den Stürmen des Lebens stellt. Malice Kincaid wird sich in drei Männer gleichzeitig verlieben und nicht wählen wollen. Und glaube mir, auch du wirst nicht wählen wollen!
DIE AUTORIN
Liebe. Passion. Worte.
Ich liebe Leidenschaften aller Art und ich liebe das geschriebene Wort.
Lovestorys von der Stange suchst du jedoch bei mir vergebens. Meine Geschichten sind nicht rosarot. Eine heile Welt gibt es ebenso wenig. Manchmal ist das Leben dark, manchmal romantisch. Bei mir ist es ungewöhnlich, spannend und amourös. Die Frauen in meinen Geschichten sind tough, selbstbewusst und äußern ihre Wünsche und Sehnsüchte. Dennoch oder gerade deshalb gewähren sie den Männern die Stärke, ihre Angebetete zu erobern. Und trotz meiner Vorliebe für die Bad Boys dieser Welt garantiere ich dir ein Happy End. Vielleicht keines aus Zuckerwatte, aber eines, das zu meinen Figuren passt und dir hoffentlich jede Menge Leselust bereitet.
Lass dich verführen!
Deine
Goodreads
Du kannst nicht beeinflussen, wen du liebst. Aber jene, die wir lieben, haben die Macht, uns am meisten zu verletzen …
Kaydence Snow – Evelyn Maynard Trilogy
Du bist besonders, weil du du bist.
* * *
PLAYLIST
The Times They Are A-Changin’ – Bob Dylan
* * *
PROLOG
»Eine Geschichte über Nutzlosigkeit, Resignation und Seelenverwandtschaft.«
Jamie Gray
Meine Finger strichen über das glatte Holz meines Rosariums. Immer öfter erwischte ich mich dabei, dass ich es nicht um meinen Hals trug, sondern um mein Handgelenk gewickelt hatte, um die zarte Oberfläche unter meinen Fingerkuppen zu spüren.
Fehlte nur noch das Gebet. Aber nein, das würde nicht passieren. Dafür waren die Narben zu groß, saß der Schmerz zu tief, war die Enttäuschung zu nachhaltig.
Obwohl es gerade jetzt vielleicht nicht verkehrt wäre, um ein bisschen Unterstützung zu bitten.
Gut zwei Wochen lag die Episode Dreich McCulloch und Schottland hinter mir. Dorian und Ezra suchten nach ihr, ließen nichts unversucht. Und ich? Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Was konnte jemand wie ich schon tun?
Eine verlorene Seele.
Ohne Passion.
Ohne Berufung.
Ohne Ziel.
Nur mit einer Sehnsucht ganz tief im Bauch, die so sehr schmerzte, dass ich es kaum an einem anderen Ort aushielt als hier.
Die Hände um das vertraute Rosarium verschränkt, den Blick über die Weite des Meeres schweifend, das Rauschen der Wellen im Ohr. Nur ich und meine Gedanken.
Sie war anders hier, die See. Anders als an der schottischen Küste. In Pembrokeshire, an der westlichsten Spitze Wales, waren die Strände weniger rau, das Meer friedlicher, der Himmel heller, der Geruch in der Luft … milder. Ich wohnte wieder bei meinen Eltern und stand jeden Morgen an diesem pittoresken Strand, die Füße im Sand vergraben, in der Ferne nach etwas suchend und wartend.
Ich wartete.
Und wartete.
Bis die Erkenntnis käme und ich wissen würde, was zu tun war.
Was ich tun konnte.
Ob es da draußen noch etwas gab, was das Leben für mich bereithielt.
Vor zwei Wochen hatte ich geglaubt, es gefunden zu haben … sie gefunden zu haben. Eine vertraute Seele, die mich versteht wie niemand sonst. Doch sie verschwand, noch bevor sie wirklich angekommen war.
Und mit ihr mein Lebensmut und meine Zuversicht.
Ich war nicht wie Dorian oder Ezra. Ich sprudelte nicht über vor Enthusiasmus und Elan. Mir musste man – sprichwörtlich – in den Hintern treten. Und solange das niemand tat, würde ich hier meine Tage an einem versteckten Strand unweit des Fishguard Fort fristen, die Möwen beobachten, die Fischerboote zählen und an die einzige Frau denken, die mir jemals etwas bedeutet hatte – und daran, dass sich bis an mein Lebensende an dieser Tatsache nichts ändern würde.
Denn es gab keine andere … es gab keinen anderen Menschen, der mich verstand.
Außer Malice Kincaid gab es keine andere Menschenseele, die so war wie ich.
Nebel zog auf. Ich roch ihn bereits, und keine zwei Atemzüge später sah ich eine düstere Wand am Horizont Richtung Land ziehen. Der Nebel kam gemeinsam mit der Flut. Die Möwen verstummten. In der Ferne ertönte das Horn einer der Fähren, die von hier zweimal täglich nach Rosslare in Irland übersetzten. Als ich hinter mir ein Knirschen im Sand hörte, das schnelle Schritte ankündigte, ahnte ich bereits, dass mich der ersehnte Tritt in den Hintern jeden Moment treffen würde.
MALICE KINCAID
»Auch wenn der Käfig, in den sie dich gesteckt haben, goldene Gitterstäbe hat, bleibt er dennoch ein Käfig.«
Der allmorgendliche Kaffee schmeckte wie ein Gedicht. Frisch gebrüht mit einer Siebträgermaschine wie in einem schicken Café. Serviert von Katherine, der Haushälterin, zusammen mit noch warmen Scones und Himbeermarmelade. Auf dem Küchentisch stand eine Vase mit frischen Tulpen. Die bunten Blüten, das durch die Fenster hereinfallende Sonnenlicht, das wunderschöne Ambiente, das dem Inneren eines Schlosses gleichen könnte, und die Tatsache, dass man sich um mich kümmerte, als wäre ich eine Prinzessin, hätten beinahe darüber hinwegtäuschen können, dass es bereits Ende November und ich eine verdammte Gefangene war.
Kaufman hielt sein Wort, das musste ich ihm lassen. Er hatte mir nicht wehgetan. Jedenfalls nicht im physischen Sinne.
Das musste ich ihm lassen?
Ich verzog meine Mundwinkel zu einem Grinsen bei diesem sardonischen Gedanken und fuhr mit einer Hand über meinen kahl rasierten Schädel.
Daran würde ich mich nicht gewöhnen.
Wegen der Elektroden, hatte Kaufman gesagt. Nur auf meiner nackten Haut konnte er meine Hirnströme messen. Daher hatte mein langes schwarzes Haar weichen müssen. Die ersten Stoppel wuchsen bereits nach, deshalb rechnete ich damit, dass er in Kürze wieder den Rasierer ansetzen würde.
»Es wird Zeit.« Wie jeden Morgen stand er an der Tür, in seinen zum Kotzen perfekt sitzenden Anzügen, in Wildleder-Loafern, akkurat sitzender Frisur und diesem strengen Zug um den Mund, den er immer dann hatte, wenn er in seinem Forschermodus war.
»Nein«, beschied ich spontan und nahm demonstrativ einen Schluck Kaffee.
»Wie bitte?« Er hatte sich bereits auf den Weg gemacht, hielt inne und kam zurück in die Küche.
»Nein.«
»Ich habe das Wort durchaus verstanden, meine Liebe. Aber ich kann dir nicht folgen.«
»Es ist sinnlos, was wir hier tun. Es wird nicht funktionieren.« Was erwartete er denn? Ich war eine Gefangene. Zwar eine in einem goldenen Käfig, aber das änderte ja nichts an der Tatsache. »Und ich will raus. Ich bin seit zwei Wochen hier eingesperrt. Ich muss an die frische Luft. Ich will an die Sonne. Ich muss zu meinen Eltern. Meine Dads müssen krank vor Sorge sein.« So spontan, wie ich losgeplappert hatte, verstummte ich wieder, weil mich der fette Kloß in meinem Hals verraten würde. Vor diesem Arschloch würde ich nicht weinen. Niemals!
Bislang hatte ich mir erlaubt, abends im Bett zu weinen. Das befreite mich von der Anspannung, der ich mich tagsüber ausgesetzt fühlte, und musste genügen.
Ehrlicherweise war ich zu Beginn meines Aufenthalts hier und wegen der Untersuchungen neugierig gewesen. Kaufmans neurologische Tests waren ganz sicher fragwürdig und moralisch mehr als grenzwertig, aber es gab eben immer auch diesen kleinen Funken Hoffnung, endlich mehr über meine Sonderbarkeiten herauszufinden.
Doch wir waren in gottverdammten zwei Wochen keinen Schritt vorangekommen.
Ich konnte mich nicht konzentrieren, hörte nichts von dem, was ich hören sollte, und war noch weniger in der Lage, die Botschaften zu übermitteln, die Kaufman mir vor die Nase setzte.
»Richard und Edward geht es gut. Ich spreche mit ihnen jeden Abend und halte sie über unsere Fortschritte auf dem Laufenden.«
»Das ist eine Lüge, Kaufman!«
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst mich Roman nennen. Immerhin leben wir unter einem Dach.«
»Das wird nicht passieren, Kaufman!« Ich betonte seinen Namen. »Es wird überhaupt nichts mehr passieren, wenn Sie nicht endlich meine Fragen beantworten.« Behutsam stellte ich die Kaffeetasse auf den Tisch und hoffte, er würde das Zittern meiner Hände nicht bemerken. Das war natürlich naiv, denn Roman Kaufman entging nie irgendetwas. Er nahm alles und jeden um sich herum mit penibelster Aufmerksamkeit wahr. »Wir drehen uns im Kreis und kommen keinen Deut weiter. Und vor allem beantworten Sie mir keine meiner Fragen. Stattdessen bekomme ich nur Lügen …«
»Na schön«, seufzte er. »Katherine, lassen Sie uns einen Moment allein.« Er setzte sich auf den Stuhl mir gegenüber und verschränkte die Hände auf dem Tisch.
Die Haushälterin verschwand mit einem schüchternen Lächeln.
»Frag!«
Fuck! Mit seinem Entgegenkommen hatte ich nicht gerechnet, und die Vielzahl an Fragen, die in meinem Kopf herumspukten, wollten sich zunächst nicht sortieren lassen. Doch dann griff ich nach der, die zumindest im Augenblick eine große Präsenz einnahm. »Roman«, begann ich, um meinen Willen zu zeigen, ihm entgegenzukommen, sobald er mir entgegenkam. Er lächelte, weshalb ich seinen blöden Vornamen direkt wiederholte. »Roman, wie geht es meinen Vätern? Wissen sie, wo ich bin, was wir hier tun? Kann ich mit ihnen sprechen, sie anrufen?«
Kaufman blieb ruhig und bedachte mich mit einem milden Blick. »Eine Menge Fragen. Aber gut. Ja, deine Väter wissen, dass es dir gut geht. Sie wissen, dass du bei mir bist und auch, was wir tun.«
»Sie müssen sich furchtbar sorgen.«
»Ich versichere ihnen jeden Tag, dass sie das nicht müssen.«
»Woher kennen Sie sich?« Meine Dads hatten sofort gewusst, von wem ich sprach, als ich den Namen Kaufman am Telefon erwähnte, und waren außer sich vor Sorge gewesen. Es war ganz sicher nichts Gutes, was sie mit dem Mann vor mir in Verbindung brachten.
»Das ist eine lange Geschichte.«
»Na dann! Ich habe nichts vor.« Demonstrativ lehnte ich mich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust.
Kaufman zögerte. »Wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir haben früher zusammen gearbeitet.« Er imitierte meine Haltung, sprach aber nicht weiter.
Ich ruckte meinen Kopf vor. Seine vagen Andeutungen warfen mehr Fragen auf, als sie beantworteten. »Und? Wann? Wie viele Jahre? Was zusammen gearbeitet?«, fragte ich weiter, wütend über diese schwammigen Worte.
Kaufmans flachen Hände schlugen auf die Tischplatte. »Das genügt. Wir müssen uns an die Arbeit machen.«
Ich bewegte mich nicht vom Platz, obwohl er bereits aufgestanden war und auf mich wartete. »Nein, Sie haben mir nicht einmal eine Frage zur Gänze beantwortet. Mit diesen kryptischen Erklärungen lasse ich mich nicht abspeisen. Ich will Antworten. Jetzt! Was ist mit mir los? Zwei Wochen haben Sie mein Gehirn durchleuchtet, irgendwas müssen Sie doch wissen. Und was ist mit Dorian? Ist er noch im Gefängnis? Wird er freigelassen? Ist das mit der Anklage erledigt?«
»Nein, ja und ja«, knurrte Kaufman widerwillig. »Er ist schon seit Tagen wieder auf freiem Fuß. Es wird keine Anklage geben. Die Angelegenheit ist erledigt. Es geht ihm gut.«
Ich seufzte und spürte den kleinen heißen Stich in meiner Brust, der mich immer piesackte, wenn ich an Dorian dachte. Oder an Ezra. Oder an Jamie.
Sollte ich auch nach ihnen fragen? Nein, das wäre zu viel.
»Können wir dann?« Kaufman hielt mir die Hand hin, riss sie aber in die Höhe, als ein Knall irgendwo im Haus ertönte. So laut und heftig, dass es mir vorkam, als bebten alle Wände um mich herum.
Instinktiv umklammerte ich die Tischplatte.
Was war das?
Ein Erdbeben?
In London?
Unwahrscheinlich.
Nur am Rande bekam ich mit, dass Kaufman nach seinem Telefon griff und eilige Befehle hinein brüllte. Hektisch stürmte er zur Tür, drehte sich noch einmal um und zeigte auf mich: »Du bewegst dich nicht vom Fleck! Ich bin gleich wieder da.«
ANGST UND HOFFNUNG
»Du musst dich deiner Furcht nicht schämen. Wenn dein Leben auseinanderbricht und du dem Tod ins Auge blickst, darfst du Angst haben.«
Dafür, dass ich Kaufman noch vor wenigen Minuten die Stirn zeigen wollte, schrumpfte ich gerade ziemlich in mich zusammen. Erst dieser Knall und dann … Hatte ich da gerade Schüsse gehört? Jetzt war es wieder so still, dass ich meinen könnte, ich wäre allein hier. Verdammt, was passierte hier?
Panisch sprang ich vom Stuhl, rannte in die nächstbeste Ecke und kauerte mich in den Spalt zwischen der Wand und dem wuchtigen Küchenschrank. Mein Herz schlug viel zu schnell. Mein Mund wurde trocken und mir wurde schlecht. Der halbe Scone, den ich bislang gegessen hatte, verwandelte sich in meinem Magen zu einem widerlichen Schleimklumpen, der raus wollte.
Zitternd hockte ich mich in der Ecke auf den Boden – zwischen Angst und Hoffnung.
Was hatte dieser Knall zu bedeuten? Eine defekte Gasleitung? Ein Angriff? Kam die Kavallerie, um mich zu retten?
Nein, das war absurd. Oder?
Bis vor Kurzem hatte mein Leben noch darin bestanden, mir die Nächte in einem Nightclub um die Ohren zu schlagen und mit Quasten auf den Nippeln überteuerte Drinks unseren gut betuchten Kunden zu servieren. Doch dann war alles aus dem Ruder gelaufen. Ich hatte gesehen, wie zwei Menschen erschossen wurden, ich war zu einer verdammten Zielperson geworden, hatte selbst eine Knarre an der Schläfe gehabt, weil ich das Objekt der wissenschaftlichen Begierde eines neurotischen Wissenschaftlers war.
Wie hatte das alles nur passieren können?
Warum ich?
Ich hatte das Gefühl, selbst bei den sich in meinem Kopf überschlagenden Gedanken einmal tief Luft holen zu müssen. Mein Brustkorb blähte sich auf.
Was war aus meinem bescheidenen, geregelten Leben geworden?
Hatte ich überhaupt noch ein Leben?
Und falls ja, wie lange noch?
Würde ich jeden Moment erschossen werden … oder gerettet?
Tränen drückten sich aus meinen Augen. Oje, ich war in den vergangenen Wochen zu einer wahren Heulsuse geworden. Aber konnte man es mir verdenken? Jetzt war es mir egal, ob sie jemand sehen konnte. Meine Zellen waren vor Anspannung kurz vorm Zerbersten. Meine Haut fühlte sich an, als wäre sie zu klein für meinen Körper, und ich quiekte laut auf, als eine Hand nach mir griff.
Ich wollte mich losreißen, um mich schlagen und rufen, dass ich noch nicht sterben wollte. Doch schon lag eine Handfläche auf meinem Mund und brachte mich zum Schweigen.
»Sch, Malice! Sie müssen ruhig sein. Wir müssen von hier verschwinden.« Mit jedem Wort lichtete sich der Schleier der Panik und ich erkannte Katherines Stimme. Die Haushälterin nahm ihre Hand von meinem Mund und zog mich aus der Küche.
»Was ist los?«, flüsterte ich und folgte Katherine, obwohl meine Füße so schwer wie Beton waren.
»Die Sicherheitskräfte vor dem Haus sind tot.« Sie schluckte, wirkte aber nicht annähernd so erschrocken wie ich.
Tot?
Es war also tatsächlich ein Angriff.
Hattest du noch Zweifel, Mali?
»Was ist mit Kaufman? Roman?«
»Ich weiß es nicht. Er ist nach hinten gegangen. In den Wintergarten. Aber wir müssen …« Abrupt hielt sie inne, als wir die Tür zum Flur erreicht hatten.
Ich prallte gegen ihren Rücken, schnaufte und blickte über ihre Schulter. Eine schwarze Pistole mit einem ewig langen Lauf – vermutlich ein Schalldämpfer – drückte gegen ihre Stirn, und als ich sah, wer die Waffe in der Hand hielt, wollte ich schreien. Vor Glück! Vor Angst!
Jamie sah zum Fürchten aus, sämtliche Züge in seinem Gesicht waren zu Stein erstarrt. Ein unordentlicher Dreitagebart lag auf seinen schmalen Wangen und sein Haar war kürzer als noch vor zwei Wochen. Zwischen den Augen prangte eine tiefe Falte und an seinem Handgelenk baumelte das Kreuz an seinem Rosenkranz.
Oh, Jamie, was tust du dir nur an?
Kurz flackerte sein Blick zu mir, verweilte jedoch nicht länger, sondern schwenkte wieder zu Katherine. Als wäre ich eine Fremde.
Erkannte er mich nicht?
»Jamie?« Meine Stimme klang brüchig. Ich räusperte mich und wiederholte seinen Namen mit mehr Kraft und Luft aus meinen Lungen. »Jamie!«
Jetzt schnellte sein Blick zu mir. Seine Augen verengten sich zu Schlitzen. Und als er erneut zu Katherine sah und seine Hand mit der Pistole zuckte, wusste ich, dass ich handeln musste.
Jamie war nicht er selbst.
Er war auf einer Mission und hochkonzentriert. Ich konnte die Schwingungen seiner Anspannung förmlich spüren. Jeder Muskel seines Körpers schien unter Hochspannung zu stehen, sein Arm war so durchgestreckt, dass man eine Tonne Gewicht daran hängen könnte, und er nicht einmal schwanken würde. Es gab nur ihn und seine Mission. Er erkannte mich nicht. Vermutlich würde er erst Katherine und dann mich erschießen. Mich, die Fremde mit dem kahlen Kopf, die rein optisch nicht ich sein konnte, weil das lange schwarze Haar fehlte.
Irgendwie musste ich ihn erreichen, seinen Fokus erweitern. Also atmete ich tief ein, schloss die Augen und rief seinen Namen in meinem Kopf so laut ich konnte.
Sieh mich an, Jamie! Sieh … mich … an!
Mein Schädel begann zu brummen, als wäre ein ganzes Bienenvolk dort eingesperrt, wo mein Gehirn sein sollte. Ich strengte mich an, versuchte, alles um mich herum auszublenden, was meine Konzentration und die Verbindung zu Jamie hemmen könnte. Wenn ich ihn nicht erreichte oder noch schlimmer in Ohnmacht fiel, würde Katherine sterben – und ich wahrscheinlich auch.
Die Geräusche im Haus wurden leiser, Katherines Wimmern rückte weit in den Hintergrund, bis ich es ebenfalls nicht mehr wahrnahm, und dann roch ich … Bitterorange. Meine Fingerkuppen begannen zu summen.
Das war gut.
Noch einmal rief ich seinen Namen mit aller Kraft meiner Gedanken und riss die Augen auf.
Jamie sah mich verwundert an und blinzelte heftig.
Yesss!
Ich war wieder im Spiel.
Was in Kaufmans Dunstkreis seit zwei Wochen nicht funktioniert hatte, war jetzt wieder da.
Ich war wieder da.
Und mit mir meine Sonderbarkeiten.
Noch nie hatten sie mich so glücklich gemacht wie in diesem Augenblick.
Sofort drückte ich mich an Katherine vorbei, riss meine Hand aus ihrer und ignorierte ihren empörten Ausruf.
»Jamie, ich bin’s. Malice. Ich bin es. Nur ohne mein Haar.« Verlegen strich ich mir über den kahlen Kopf und stellte dankbar fest, dass Jamies Blick meiner Hand folgte. »Erkennst du mich? Ich bin’s. Malice.« Behutsam versuchte ich, seinen Arm, der immer noch ausgestreckt und mit der Waffe in der Hand auf Katherine zeigte, hinunterzudrücken. Es gelang mir nicht, aber Jamie wirkte nicht mehr so entschlossen, Katherine und mich zu töten. Er blinzelte immer noch und dann erwachte er aus seiner Trance.
»Malice, was hat er mit dir gemacht?« Verwirrt begutachtete Jamie meinen Kopf, als könnte er nicht glauben, was er sah.
»Nimm die Waffe runter! Bitte!« Ich festigte meinen Griff um seinen ausgestreckten Arm. Auch wenn ich Kontakt zu Jamie hatte, hieß das noch lange nicht, dass auch Katherine in Sicherheit war. Und ich? Es gab einen Hoffnungsschimmer, aber sicher war gerade nichts.
»Was ist mit deinem Haar?« Tränen traten in seine Augen.
Ich spürte die Trauer und Verzweiflung in Jamie und noch etwas, das viel, viel dunkler und viel, viel grauenvoller war als mein bedauerliches Aussehen. Etwas Bodenloses, das meinen Magen schmerzhaft verkrampfen ließ. Ich konnte es nicht greifen und noch weniger beschreiben, aber es war da und hatte Jamie fest im Griff.
Doch ich vertraute darauf, dass er nicht schießen würde. Langsam nahm ich meine Hand von seinem Arm, schob mich zwischen ihn und Katherine, umfasste sein Gesicht und kam ihm dabei so nah, dass er nichts anderes sehen konnte.
»Es ist nur Haar. Das wächst wieder. Ist nicht schlimm. Vielleicht bin ich nicht mehr so schön wie einst, aber das macht nichts.«
Du bist wunderschön.
Ich hörte seine Gedanken klar und deutlich, lächelte und fühlte mich wunderbar leicht. Für ein paar wertvolle Sekunden konnte ich alle Scheiße um uns herum ausblenden. Denn ich erinnerte mich an den Morgen, als wir uns kennenlernten. Jamie war den eiskalten Fluten des Atlantiks entstiegen, hatte ausgesehen wie ein personifizierter Adonis und nichts als Kraft und pures Leben ausgestrahlt … und ich war in Ohnmacht gefallen. Und als ich erwachte, lag ich in seinen Armen und in meinem Kopf fand nichts anderes Platz als dieser eine Satz: O mein Gott, bist du schön!
Damals hatte die Überlegung ihm gegolten. Es waren meine Gedanken gewesen, doch darum ging es nicht. Der Punkt war, dass ich auch jetzt hören konnte, was er dachte. Diese einzigartige Verbindung zwischen uns war immer noch da.
Das fühlte sich gut an. Fernab von all den Fragen, den Schüssen, dem Wahnsinn.
Doch die Realität holte mich ein, weil Katherines Angst in meine Adern sickerte wie eine giftige Injektion. Sie stand hinter mir, atmete hektisch und wimmerte, während Jamies Arm noch immer ausgestreckt über meine Schulter reichte und die verfickte Waffe an ihre Stirn hielt.
»Jamie, bitte, nimm die Waffe runter! Das ist Katherine. Sie hat mir jeden Morgen Scones gebacken. Es ist nur Katherine, die Haushälterin. Hörst du? Du musst sie nicht erschießen. Du darfst sie nicht erschießen!«
»Aber …«, begann er zu intervenieren. Wie auch immer seine Mission lautete, wie auch immer der Plan war, er tat sich schwer damit, jetzt anders zu entscheiden.
Doch natürlich würde ich nicht aufgeben. »Jamie, sieh mich an! Lass sie gehen! Sie ist nicht wichtig. Wo ist Kaufman? Bist du allein hier? Wo sind Ezra und Dorian? Sind sie auch …«
»Der Scheißkerl ist uns entwischt, aber …« Die Geräusche schwerer Schritte und eine dröhnende Stimme erreichten mich, und ich wusste, von wem beides stammte, noch bevor ich ihn sah. Bei aller Ambivalenz darüber, ob ich mich freute, Dorian jeden Moment zu sehen oder ihm endlich den verdienten Tritt in die Eier zu geben, behielt ich meine Konzentration auf Jamie, dessen Waffe noch immer auf Katherine zielte.
Dorian blieb abrupt stehen. Ezra war bei ihm. Keine zwei Armlängen von mir und Jamie entfernt. Sie sagten nichts. Ich hielt den Augenkontakt zu Jamie und konzentrierte mich nur auf ihn, als ich sagte: »Katherine, verschwinden Sie!«
Wie erwartet, protestierte sie. »Nein, ich lasse Sie nicht allein zurück bei diesen …«
»Verschwinden Sie!«, wiederholte ich mit mehr Nachdruck und schob bei allem Verständnis für ihre Sorge um mich hinterher: »Es geht mir gut. Mir passiert nichts.«
Offenbar traf sie ihre Entscheidung und verschwand mit eiligen Schritten. Ich konnte sie nicht sehen, nur hören. Meine Aufmerksamkeit galt weiter Jamie, der im Soldatenmodus seinen Arm unbeirrt nach vorn streckte. Vielleicht gab es mehrere Möglichkeiten, ihn aus diesem Tunnel herauszuholen, ich sah nur eine, auch wenn sie – zumindest für mich – nicht gerade die beste war. Allen Erfahrungen zum Trotz schmiegte ich mich an ihn. Sollte ich wieder ohnmächtig werden – was bisher jedes Mal passiert war, als ich ihm zu nahe kam –, wäre es jetzt nicht schlimm.
Aber ich fühlte nichts von der üblichen Dunkelheit. Als ich meine Arme um ihn schlang und meine Wange an seine Brust drückte, schien sein Körper sich zu entspannen. Einen viel zu lange andauernden Augenblick später erwiderte Jamie die Umarmung, und ich spürte seine kräftigen Arme um meine Schultern.
Und so blieb ich.
Gott, war das schön!
So hätte ich ewig verweilen können.
Auch Jamie machte keine Anstalten, sich von mir zu lösen. Ich drehte lediglich den Kopf und erwiderte Ezras und Dorians Blicke, die zu verstehen schienen. Sie bewegten sich nicht, schenkten uns diesen Moment des Friedens, während Dorian seine Pistole sicherte und in einem braunen Brustholster verstaute. Auch Ezra hielt eine Waffe in der Hand … nein, Korrektur: zwei Waffen in beiden Händen.
Alle drei trugen komplett in Schwarz gehaltene Kleidung, schwere Stiefel und jede Menge militärisches Equipment an den Gürteln, den Holstern, in den Händen. Um Dorians Hals hing eine Kette, an der zwei runde silberne Anhänger seines Dog Tags glänzten, die Erkennungsmarke der britischen Soldaten. Beide trugen Westen, vermutlich schusssicher. Ihr Anblick vermittelte mir eine Ahnung, wie sie während ihrer Laufbahn bei der British Army zu den gefürchteten Red Devils geworden waren, von denen Kaufman gesprochen hatte.
»Wir müssen los«, unterbrach Dorian den Kokon, in den ich mich mit Jamie geflüchtet hatte. Er zog eine andere Waffe aus einem Holster am Gürtel, zog den Schlitten zurück und umgriff sie mit beiden Händen, bevor er sich abwandte und losmarschierte.
Jamies Griff lockerte sich, und noch bevor ich meine Arme von seiner Taille nehmen konnte, riss Ezra mich an sich und strich über meinen Kopf. »Was zur Hölle hat dieser Frankenstein mit dir gemacht?«
Ich blieb ihm die Erklärung schuldig. Was sollte ich auch sagen?
Meine drei Jungs hatten mich gerettet. Also scheiß auf mein Haar!
Schweigend folgte ich ihnen durch den langen Flur und in die Eingangshalle. Die doppelflügelige Haustür stand offen. Davor lagen zwei Männer, die in den vergangenen zwei Wochen Tag und Nacht hier gestanden und dafür gesorgt hatten, dass niemand … vor allem nicht ich dieses Haus verließ. Blut floss aus der Schläfe des einen und bildete eine unansehnliche Lache auf dem weißen Kies der Einfahrt.
Ich hielt die Luft an und starrte auf das klaffende Loch im Schädel des Mannes, den ich nicht wirklich kannte, der aber vor Kurzem noch lebendig gewesen war. Das war zu viel. Der halbe Scone vom Frühstück, mutierte jetzt zu dem widerlichen Schleimbrocken, wollte endlich raus. Würgend spuckte ich ihn auf den kostbaren Marmor in der Eingangshalle.
Ach, verdammt! Konnte das alles noch erniedrigender werden? Noch surrealer? Noch abgefahrener?
Beide Arme um meinen Bauch geschlungen, kotzte ich alles aus, den halben Scone, meine Wut, meine Angst …
»Fuck!«, stöhnte Dorian. Meine Schwäche triggerte ihn. Ich spürte, dass er mich am liebsten über die Schulter geworfen und hier rausgetragen hätte. Weit weg! Es setzte ihm zu, nicht die komplette Kontrolle über alles zu haben. Ich war ein Unsicherheitsfaktor, eine Störkomponente, etwas, das ihn daran hinderte, systematisch nach Plan vorzugehen. Und das dachte ich mir nicht aus. Ich las es in seinem Kopf.
Das gefiel mir nicht.
Ich bedachte Dorian mit einem finsteren Blick. Er wusste, dass ich ihn hören konnte. Seine Mimik wurde weicher, wenn auch nur ein klitzekleines bisschen. Trotzdem brummte er: »Wir müssen weiter!«
Doch bevor ich mich darüber aufregen konnte, spürte ich Ezras Arm um meine Taille. »Geht vor! Wir sind hinter euch.« Er half mir auf, wobei ich lieber auf die Knie gesunken wäre und mich weiter übergeben hätte, bis dieses schreckliche Gefühl in meinem Magen vorbeiginge. Vorzugsweise ohne zu spüren und zu hören, im Fokus dieser drei Männer zu sein. Vorzugsweise, ohne im Fokus von irgendwem zu sein.
»Wir müssen weiter. Komm schon! Schaffst du es allein?«
Als Ezra Anstalten machte, mich in die Arme nehmen und tragen zu wollen, wich ich zurück. »Nein, stopp! Ich kann laufen.«
Zu viel! Viel zu viel!
Ich war kaum in der Lage, meine Situation im Kern zu begreifen – eine mit toten Menschen um mich herum, während drei Männer, die aussahen, als kämen sie aus einem Actionfilm, mich befreiten. Die wegen mir hierhergekommen waren. Die wegen mir Menschen getötet hatten. Wenn Ezra mich jetzt in seinen Armen aus dem Haus trug, würde mein Hirn explodieren.
Oder mein Herz.
Oder beides.
Von der ekligen Komponente mal abgesehen, weil ich mich gerade im Schwall übergeben hatte. Romantisch war definitiv anders!
Also, nein, bitte lass mir noch ein Fünkchen Würde und Selbstbestimmung.
Schweigend hielt Ezra die Tür auf und ließ mich hindurchgehen. Ich sah ihn nicht an, hielt meinen Blick auf die Füße gerichtet. Aber ich spürte ihn. Ich konnte ihn hören und dachte über seine Stellung in der Scharade beim Schreibretreat nach. Außergewöhnlich empathische Fähigkeiten, hatte Dorian gesagt. Deshalb war Ezra dort gewesen. Weil er mich hatte unter die Lupe nehmen müssen, um zu erkennen, ob etwas dran war an meinen … Sonderbarkeiten.
Um mich in Kaufmans Hände spielen zu können.
Damit Dorian sichergehen konnte, dass die Fakten stimmten – mit der freakigen Zielperson.
Noch war ich mir nicht sicher, was ich davon halten und wie ich heute damit umgehen sollte. Vor allem wegen dem, was zwischen uns vorgefallen war … in dem magischen Raum unter der Sternenkuppel.
Und später im Weinkeller.
Weil er sich in mich verliebt hatte.
Weil ich etwas für ihn empfand.
Und für Dorian.
Und für … Jamie!
Fuck!
Alle drei waren gekommen, um mich zu befreien.
Oje, wer war ich? Rapunzel? Ach, nee, die hatte langes Haar.
Absurd!
Und es wurde noch absurder. Ezra führte mich zu einem Van, der mit laufendem Motor in der Einfahrt stand. Gerade noch fragte ich mich, wie lange ich wohl brauchte, um die Fülle an Ereignissen der vergangenen Tage und Wochen jemals verarbeiten zu können, als ich durch das heruntergelassene Fenster der Fahrerseite erkannte, wer noch zur Party erschienen war.
GEFRÄSSIGE MONSTER
»Welche Frage stellst du zuerst, wenn deren Anzahl dir den Verstand zu rauben droht?«
Ein Gesicht, umrahmt von roten Locken, über und über mit Sommersprossen übersät und mit einem Lächeln, das der gesamten von Tod und Schrecken überschatteten Szenerie die Stirn bot, empfing mich, als ich von Dorian gedrängt in den Wagen stieg.
»Dove? Du liebe Güte! Was zum Teufel geht hier vor sich? Was machst du hier?« Tausend Fragen attackierten mich. Ich überlegte, welche wichtiger war, und war versucht, sie alle auf einmal zu stellen.