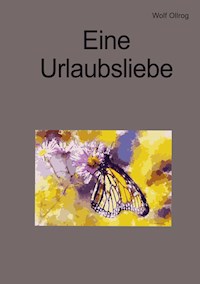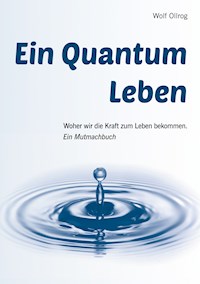Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Ich hätte dich gebraucht - Nachkriegsgeschichten" Dieses Buch erzählt Geschichten. Es sind eindrückliche, manchmal bedrückende, manchmal beglückende Geschichten eines kleinen Jungen, in denen die Geschichte der ersten Nachkriegszeit auflebt. Wer ihnen zuhört, ist sofort gefesselt. Er wird hineingenommen in ein Stück Zeitgeschichte, in eine ganz aus den Fugen geratene Welt. Zugleich ist das Buch eine Autobiographie von ungewöhnlicher Dichte und ungeschönter Ehrlichkeit, in der sich der Autor in besonderer Weise mit seinem Nazi-Vater ausein-andersetzt. Es verschweigt und beschönigt nichts. Und doch sind seine Geschichten mit Liebe geschrieben. Die heiter-ernste Erzählweise und Sprachkunst des Autors machen das Büchlein zu einem Leseerlebnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
meiner Schwester D.
Der Autor:
Dr. Wolf Ollrog (Jg. 1943), verheiratet, zwei Kinder, ev. Pfarrer. Arbeitete als Gemeinde-, Studenten-, Schulpfarrer und Hochschuldozent. Ausbildungen in Bondingpsychotherapie, Transaktionsanalyse und Systemischem Aufstellen. Schwerpunkte: Workshops für Paare, Bonding-Intensiv-Workshops; System. Aufstellungen; lebensbegleitende Supervisionsgruppen, Einzel- und Paarberatung.
Veröffentlichungen (u.a.): „Nie gesagte Worte“ in: Deutschland und seine Weltkriege: Schicksale in drei Generationen und ihre Bewältigung (2012); „Aus der Traum. 101 bewährte Vorschläge, wie man seine Partnerschaft vor die Wand fahren kann“ (2013); „Ein Quantum Leben. Woher wir die Kraft zum Leben nehmen“ (2014); „Die drei Säulen der Partnerschaft. Was Partnerschaften stabil, ebenbürtig und glücklich macht“ (2015); „Wir müssen reden! Die Partnerdiade – eine einfache Gesprächshilfe für schwierige Themen“ (2016); „Geklopfte Sprüche. Über die Welt, die Liebe und andere unflätige Dinge“ (2019); „Eine Urlaubsliebe“ (2021).
Inhalt
Einleitung
Wie ich zur Welt kam
Aufs Land
Ausgebombt
Familiäre Konflikte
Die Flucht
Unsere Wohnverhältnisse
Meines Vaters Rückkehr
Zeit des Versteckens
Mein kriegsbeschädigter Vater
Elterliche Krisenzeiten
Schöne Momente
Mein Vater und ich (1)
Die Strafen
Meine Mutter
Vom Geld, vom Sex und täglichen Leben
Vom Essen
Das verbotene Dorf
Körpererfahrungen
Jahreszeiten
Mein Vater und ich (2)
Nachgedanken
Einleitung
Über 7 Jahrzehnte, fast drei Generationen, trennen uns vom Krieg in diesem Land. Auf dem meisten, was damals geschah, liegt eine Staubschicht des Vergessens. Was nachbleibt, sind – außer vielleicht ein paar meist harmlosen, blass gewordenen Bildern – unsere Geschichten.
In Geschichten verdichten sich unsere Erlebnisse und Erfahrungen. Auf erzählbare Weise bewahren sie, in kleine Einheiten verpackt, was uns wichtig war. In unsern Geschichten leben die hinter uns zurückbleibenden Ereignisse und Gefühle wieder auf und verwandeln Vergangenes in Gegenwart. Geschichten erzählend nehmen wir andere mit in unsere Welt. Nicht nur das Leben anderer, auch das eigene gewinnt man zurück durch Geschichten.
Ich erzähle Geschichten aus der ersten Zeit meines Lebens, Kindergeschichten, Geschichten aus dem Krieg und den ersten Nachkriegsjahren. Ich tauche noch einmal ein in eine Zeit, die meinen Kindern und den meisten Menschen heute fremd ist, die aber für mich, unsere Familie, unser Land und weit darüber hinaus eine ungeheuerliche Zeit war, voller Erschütterungen, persönlicher Katastrophen und zerstörter Biografien – und zugleich auch wildentschlossener Lebenskraft.
Der von Deutschland angezettelte Krieg richtete ein unvorstellbares Maß an Grauen an. Seriösen Schätzungen zufolge hinterließen Krieg und Nachkriegszeit ein Blutmeer von über 50 Millionen umgekommenen Menschen in vielen Ländern dieser Erde, vor allem in Russland. Die Zahl der deutschen Kriegsopfer dürfte bei 7 Millionen gelegen haben, davon gut 3 Millionen Soldaten und knapp 4 Millionen Zivilisten. Mehr als 14 Millionen Deutsche oder Deutsch-stämmige wurden außerdem bis 1950 Opfer von Vertreibung und Flucht. Sie verloren ihre Heimat, ihr Land, ihre Habe, ihren Mann, ihre Frau, ihre Kinder, Geschwister, Eltern, Verwandte. Sie machten ungeheure Strapazen durch. Viele Menschen verloren ihre Würde und ihre moralischen Maßstäbe. Sie erlebten die Umwertung von Recht und Unrecht und waren auch selbst daran beteiligt. Nur wenige blieben unbeschadet. Nur wenige, die keine Schuld auf sich luden.
Schätzungsweise 15 Millionen Menschen waren bei Kriegsende in Deutschland unterwegs und suchten eine Bleibe oder ihre Angehörigen. Zahllose Familien wurden auseinandergerissen, mehr als 2 Millionen Waisenkindern fehlten die Eltern. Über eine halbe Million Menschen verlor bei den Flächenbombardements der Städte ihr Leben. An die 6 Millionen Juden wurden in den KZs und Vernichtungslagern ermordet, dazu vermutlich 3 Millionen Kriegsgefangene, Sinti und Roma, Euthanasieopfer, Homosexuelle, KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter, Deportierte, Christen, Kommunisten, Sozialdemokraten und sonstige Zivilisten. Eine ungleich größere Zahl von Menschen erlitt körperliche und seelische Verletzungen. Kaum eine Familie, die nicht davon betroffen war.
Das sind unvorstellbare Zahlen von Einzelschicksalen. An den meisten später Geborenen rauschen sie vorbei. Fassbar werden sie erst, wenn man von einzelnen Menschen erzählt. Dazu muss man ihre Geschichten anhören.
Es ist wohl ein Bedürfnis des Alters, sich noch einmal umzudrehen und zurückzuschauen, damit das eigene Leben nicht sang- und klanglos im Nebeldunst der Vergangenheit entschwindet, und dabei zu fragen: Was hat mir damals die Richtung gewiesen? Wie haben die Umstände mich zu dem werden lassen, was ich bin? Woher komme ich, und was habe ich selbst daraus gemacht?
Indem ich anfing, mir meine Geschichten noch einmal zu erzählen, füllten sie sich mehr und mehr mit Leben, fingen plötzlich wieder Farbe ein. Geschichten nähren das Kind in uns. Wir schlagen ein Bilderbuch auf, und die Ereignisse, die Figuren mit ihren Ängsten und Hoffnungen beginnen noch einmal lebendig zu werden.
Natürlich sind es nur meine Geschichten, die ich erzähle. Jeder Mensch erzählt seine eigenen Geschichten und schreibt daraus seine eigene Geschichte. Das Bild, das entstand, ist eigensinnig und schillert in meinen Farben. Aber nur so erschließt sich uns die Welt. Das kann die objektive Draufsicht, die noch so gut recherchierte Beschreibung der Umstände nicht leisten. Erlebbar, mitfühlbar wird Geschichte durch die von uns erzählten Geschichten.
Ich nehme Sie, meine Leserinnen und Leser, für eine Weile hinein in meine Kinder-Welt, eine kleine Welt, die von mir, meiner Familie und den Menschen in meinem nächsten Umfeld handelt. Personen- und Ortsnamen habe ich dabei verfremdet. Ich lasse Sie teilhaben an dem, was mich bewegte und beschädigte, was mich belebte und erschütterte, was ich verstand und nicht verstand – in dem Wissen, dass die große, ganz aus den Fugen geratene Welt meiner kleinen den Rahmen setzte und damit zugleich ein Stück Zeitgeschichte auflebt.
Wie ich zur Welt kam
Mein Anfang war kraftvoll. Meine Mutter wollte mich unbedingt haben.
Ein halbes Jahrhundert später, an meinem fünfzigsten Geburtstag, den sie nicht mehr erlebte, erzählte mir mein Vater – er machte mir damit, ohne es geplant zu haben, das bei weitem schönste Geschenk – die Geschichte meines Werdens ... wie meine Mutter, oder besser: Mutti, denn so habe ich sie immer genannt, als er im Juni 1942 für sechs Wochen zum Stabs-Lehrgang von der russischen Front nach Berlin abkommandiert wurde, sich, ganz außerhalb der Regel, für drei Wochen bei ihm in seiner engen Lehrgangs-Butze einquartierte, wie mein Vater ein Feldbett neben seinem aufschlug, und wie seine Frau, bereits Mutter zweier Töchter, mit der ihr eigenen trotzig-selbstverständlichen Art, der man nicht widersprechen konnte, sagte: „Ich gehe hier nicht eher wieder weg, bis du mir einen Sohn gemacht hast!“
Was für Liebesnächte! Wie viel Lust auf Leben! Welche Umstände: das knarzende Bett (denke ich mir), die hellhörigen Wände, die Heimlichkeiten, das Tuscheln, Beneiden und Augenzwinkern der Kameraden, die langen Tage, wenn mein Vater in seinem militärisch-ideologischen Unterricht saß, vielleicht kurze Spaziergänge in den Pausen, voller nächtlicher Sehnsucht, durch eine Stadt im Kriegsfieber, Militärfahrzeuge überall, und immer wieder Sirenengeheul und Nachtverdunklungen. Martialische Parolen füllten die Schlagzeilen, schallten aus den Volksempfängern, schrillten aus Lautsprechern: Die deutschen Truppen eilen von Sieg zu Sieg, Tod den Bolschewiken, die Judenfrage muss endlich gelöst werden, wir brauchen Lebensraum im Osten für die arische Rasse, Kinder für den Führer. Mit dem allen hatten meine Eltern keine Probleme. Sie standen auf der richtigen Seite.
Das lediglich Menschliche, Private, Intime hat zwanglos Platz neben dem Schrecklichen und Wahnsinnigen. Auch wenn die Stadt schon brennt, sucht sich das ganz Normale seinen Weg: essen, trinken, lachen, weinen, fürchten, hoffen, sterben, Kinder zeugen. Das Leben fragt nicht erst nach gut und böse, es wartet nicht auf bessre Zeiten, es schert sich nicht um den Tod, es hört nicht auf zu begehren.
Die Tagesstunden schleppten sich voran. Wird es wieder Alarm geben? Werden wir eine ungestörte Stunde zusammen haben? Wie meine Mutter die Abende, die Nächte herbeigewartet hat, wo Nehmen und Geben mit Leidenschaft erfolgten, wie sie in ihren Körper hineingehorcht hat! Ich will einen Sohn, von dir, der in ein paar Wochen wieder an die Front verschwindet, den ich vielleicht nicht wiedersehe! Ich will endlich das Männliche von dir! So wurde ich von meinen Eltern auf den Weg gebracht, als Kind der Liebe.
Ich frage mich: Wo blieben meine Schwestern in diesen Wochen? Wem hat meine Mutter ihr beiden Töchter, gerade den Windeln entwachsen, in den Arm gedrückt? Spannte sie ihre Eltern in Kassel ein? Ließ sie die Kinder bei ihren Nachbarn in Witten, mit denen sich meine Eltern gut verstanden? Der Aufwand war groß. Aber sie bekam es hin. Sie war besessen von dem einen Wunsch. Drei ganze Wochen blieb sie in Berlin, bis sie es wusste, dass sie mich bei sich hatte. Dann fuhr sie ab, soff und satt von Leben mit ihrem Mann.
Das waren unvergessene Tage, kann sein, die schönsten ihres Lebens, vielleicht die intensivsten. Meine Mutter nimmt sie mit zurück nach Haus, sie werden sie noch lange wärmen, wenn ihr Mann weit weg ist und sie des Nachts allein nach innen schaut.
So griff ich Platz in ihrem Leib, ihr drittes Kind. Sie wusste es: Es wird ein Junge, bestimmt wird es ein Junge, ein endlich ihr geschenkter Sohn, er soll nach seinem Vater heißen.
Für mich war es ein guter Platz. Nie hatte ich einen besseren. Meine Mutter machte es stark in einer Zeit, die ihr viel abverlangte. Sie fühlte es innerhalb, es machte sie sicher: Dieser bleibt mir, wenn die Angst größer wird und, sie wagt es nicht zu denken, wenn der Krieg nach dir, meinem Mann greift, wenn ich dich verliere, wenn du nicht wiederkommst. Dieser ist du, ein Wolf vom Wolfgang.
Die folgenden Wochen und Monate, Herbsttage und Winterabende, die lange dunkle Zeit, als Mangel und Zweifel schon angefangen hatten, ins eigene Land zu schleichen, hat sie mit diesem Wissen ihre Angst bekämpft, hat Ahnungen und Befürchtungen beiseitegeschoben, weil sie für ihre Kinder und vorweg für das in ihrem Bauch genug zu sorgen hatte, hat sich, je mehr ihr Leib sich rundete, in tiefer Verbindung gewusst mit ihrem Mann, meinem Vater.
Gewiss, auch meine Schwestern brauchten sie; auch sie schützten sie, die ohnehin nicht zum Grübeln neigte, vor bohrenden Gedanken. Unmittelbarer aber sprach das Kind zu ihr, das sie in ihrem Leibe trug und wachsen fühlte und von dem sie wollte, dass es ein Wölfchen sein und ihr bleiben muss. So bin ich gern in ihr gewachsen, ein Pfand der Hoffnung, aber auch ein Kind der Angst.
In den letzten Monaten des Jahres 42 setzte in der Heimat die Not ein. Die Nahrung wurde rationiert, im Laden gab es nur noch Nötiges zu kaufen. Meine Mutter bekam Angst um mich, wie sie mir später erzählt hat, und stopfte in sich, was immer sie zu essen fand. Es wäre wohl für mich nicht nötig gewesen, aber so bekämpfte sie auch später unangenehme Gedanken. Immer hatte sie mit ihrer Figur zu kämpfen. Sie ging auf und ich mit ihr.
Schwerer und dicker als ihre beiden ersten Kinder beanspruchte ich mehr Raum in ihr als sie. Als ich dann gegen Ende des harten Winters im März 1943 zur Welt kam, habe ich ihr sehr weh getan. Nach langen Mühen, die ihr das Beste abverlangten, hat sie mich mit Schmerzen geboren und brauchte lange, um sich zu erholen.
Später, als ich längst erwachsen war, erfuhr ich auf ganz überraschende und umso eindrücklichere Weise von meiner Geburt; nicht durch meine Mutter, auch nicht von jemandem anders, der es hätte wissen können. Sie hatte mir bis dahin nie davon erzählt, ich hatte nicht gefragt und wusste nichts darüber. Doch hat mein Körper sich das Drama gut gemerkt. Zweimal erlebte ich im Rahmen therapeutischer Ausbildungen in außergewöhnlichen Regressionen meine Geburt nach; zuerst auf einem Workshop in den späten 70er Jahren, danach noch einmal Ende der 80er. Ich wollte meinen mich immer wieder einmal störenden körperlichen Druckgefühlen auf die Spur kommen. Wir spielten es nach. Die Gruppe umstellte mich mit Kissen und Matratzen, ich spürte eine tiefe Angst und Panik. Mit größter Anstrengung und letzten Kräften wand ich mich aus den um mich gepressten Kissen – und fühlte mich, ganz erschöpft zwar, aber neugeboren. Es hat mich sehr bewegt und völlig überrascht.
Ich kam vom Workshop zurück und wollte unbedingt wissen: Wie war das damals mit meiner Geburt? Stimmen meine Gefühle? Als ich die Erfahrung das erste Mal machte, lebte meine Mutter noch. Ich habe sie gefragt, wie war es, als ich ankam? War ich vielleicht eine schwere Geburt?
Sie hat mir dann davon erzählt. Schwer hat sie sich getan, mich herzugeben. Ich war ein bisschen übertragen. Vielleicht wollte sie mich noch nicht loslassen, noch nicht der Kriegswelt ausliefern. Ich habe sie bei meinem Drang nach außen schlimm zerrissen. Ich weiß, ich wollte hinaus, das spüre ich bisweilen noch immer in den Beinen, wenn sie sich manchmal nachts noch freizutreten suchen. Beide waren wir der Erschöpfung nah. Am Ende ist es uns mit vereinten Kräften gelungen, sie erzählt: nach 12 oder 13 Stunden, ungewöhnlich für ein drittes Kind.
So kam ich zur Welt, ihr erster Sohn, ein Kind der Schmerzen.
In die Städte schlugen die ersten Bomben ein. Der Russlandfeldzug ging in die entscheidende Phase. Ende Januar 1943 kapitulierten die aufgeriebenen deutschen Truppen vor Stalingrad. Ich bekam davon nichts mit. Ich wurde gewollt und erwartet und unter beschwerlichen Umständen willkommen geheißen. Für mich war es ein großer Anfang.
Aufs Land
Ich bin ein Kriegskind. Als ich im Leben ankam, herrschte Krieg im Land. Was für eine fremde, absurde Angelegenheit nach 70 Jahren! Es fielen Bomben. Es brannten Städte, inzwischen auch im eigenen Land. Der Krieg setzte Zeichen. Es starben Menschen, Zivilisten, Unbeteiligte, Frauen, Kinder. Es fielen Soldaten, Väter, Söhne, Brüder - gottlob, es traf nicht uns. Menschen verschwanden aus der Nachbarschaft, Namen, Läden, die immer dazugehörten, aber es betraf niemanden aus unsrer Nähe. Da gab es Lager neben den Fabriken, belegt von ausländischen Arbeitern und Arbeiterinnen, umzäunt und schwer bewacht, doch wir hatten nichts damit zu tun. Man konnte daran vorbeigehen, musste nicht hinsehen.
Meine Mutter sah nicht hin. Sie folgte in politischen Dingen meinem Vater, der war ein überzeugter Parteigänger. Sie wollte und konnte nicht sehen, was die Nazis anrichteten. Das Grauen fand an andern Orten statt, wurde weggedacht und ausgelagert. Dem eignen Lande stand es noch bevor. Es gab nicht mehr alles zu kaufen, aber die Bevölkerung hungerte noch nicht. Noch konnten die Menschen im Land, so auch meine Eltern und Großeltern, an ein glimpfliches Ende glauben.
In meiner Familie gab es keine Kritiker oder Querdenker, keinen, der sich wegen eines Juden den Mund verbrannt hätte, schon gar keinen, der, und sei es auch nur heimlich, mit so etwas wie Widerstand sympathisiert hätte. Meine Mutter jubelte mit, meine Großeltern hängten die Nazi-Fahne raus und duckten sich weg. „Nur nicht auffallen!“ war ihre Devise. Es war der zweite Krieg für sie, vor allem mein Großvater hatte vom ersten genug. „So ist die Welt. Wir können sowieso nichts machen. Da können wir nicht gegen-an“ – so habe ich es von meinen Großeltern gehört. Sie beschränkten sich auf ihre private Welt. Und meine Mutter kümmerte sich um ihre Kinder. Das Unheil kam schrittweise näher.
Ich habe davon erst einmal nichts mitbekommen, nichts im Sinne des Erinnerns. Ich denke, nur wenn es punktgenau die eigene Familie trifft, wenn das Unheil unausweichlich wird, erschüttert es die Seele und erreicht dann auch den Säugling. Trotzdem ging es nicht an mir vorbei.
Meine ersten sechs Wochen waren vielleicht die heikelsten meines Lebens. Wir wohnten im hübschen Zweifamilienhaus zur Miete in Witten-Bochum am Rande des Ruhrgebiets, Vorgarten vorn und Nutzgarten hinten. Das Haus gibt es heute nicht mehr. Ich habe es vergeblich gesucht und dann nachgeforscht. Nur auf alten Karten war es noch verzeichnet. Schon in den frühen sechziger Jahren musste es einer neuen Straße weichen.
Unsere friedliche Stadtrand-Idylle bekam bereits mit dem Beginn des alliierten Luftkriegs im August 1942 deutliche Kratzer. Die großen Städte und auch das Ruhrgebiet wurden zu „luftgefährdeten“ Gebieten. Immer wieder gab es nach dem Dunkelwerden Fliegeralarm, manchmal mehrmals in der Nacht und schließlich auch immer häufiger am Tage. Dann, so hat sie es erzählt, ließ meine Mutter alles stehen und liegen, schnappte ihre zwei und dann drei Kleinkinder, griff die immer fertig gepackte Tasche, drehte das Gas ab und das Licht aus und stürzte mit uns ein paar Blocks weiter in den nächsten Luftschutzkeller, eh er abgeschlossen wurde und ein dumpfes, den Himmel füllendes Dröhnen die herannahenden Bomber ankündigte.
Und daran habe ich wohl doch eine Erinnerung, meine erste halbbewusste: Der Lärm der aufheulenden Sirenen, die Aufregung, die panische Eile, die keinerlei Verzögerung duldete, selbst wenn ein Kind auf dem Pott saß: das habe ich in meinem kindlichen Gemüt gespeichert.
Noch viele Jahre nach dem Krieg schrillte mir das Schreien von Sirenen in den Ohren, fuhr mir in die Glieder und blieb in meiner Seele stecken wie Aufruhr. Immer bin ich zusammengezuckt, war innerlich auf dem Sprung, wenn irgendwo Sirenen zum Probealarm aufheulten.
Ich erinnere mich, dass Jahre später, Jahre nach dem Krieg, als längst keine Bomben mehr fielen, da mag ich sechs gewesen sein, in jenem kleinen Dorf bei Göttingen, in dem wir Unterschlupf gefunden hatten und von dem ich noch erzählen werde, ein altes Fachwerkhaus in Brand geraten war. Die Heul-Sirene auf dem Pfarrhaus schrie das Dorf zusammen. Noch immer spüre ich den Schrecken in mir, weiß noch, wie mich dieses panische Gefühl erfasste, wie das ganze Dorf zusammenlief und wie ich mitrannte und dabei, ohne zu wissen, was eigentlich vorgefallen war, meine Angst wegschreiend, zusammen mit den anderen aus Leibeskräften „Feuer! Feuer! Feuer!“ brüllte.
Als dann die Luftangriffe der Alliierten weiter zunahmen, wurden alle Familien mit kleinen Kindern im Rahmen der Mutter-Kind-Verschickung aufgefordert, das Ruhrgebiet zu verlassen. Viele versuchten bei Verwandten eine Unterkunft zu finden. Meine Mutter wäre sicher viel lieber in Kassel bei ihren Eltern untergeschlüpft, doch bot die große Stadt vor den immer häufigeren feindlichen Bomberstaffeln ebenso wenig Schutz, und außerdem fehlte in der elterlichen Etagenwohnung auch der Raum für uns vier. So zogen wir, meine Mutter, meine zwei knapp vier- und dreijährigen Schwestern und ich, der sechswöchige Säugling, ich glaube, nicht besonders gern, zu den Eltern meines Vaters, mit denen meine Mutter deutlich weniger Kontakt hielt als zu ihren Eltern. Aber sie wohnten dort, wohin sich kein Bomber verirrte, fern auf dem Lande im Thüringischen, 15 Kilometer Luftlinie bis Gera, in dem Flecken Münchenbernsdorf. Die Bombergeschwader, erzählt meine Schwester, hörte man hier nur in der Ferne vorbeiziehen.
Hier gelang es durch die Vermittlung meines Großvaters, der als Rendant und Forstverwalter in großherzoglichen Diensten den Forst des Ortes betreute, eine Wohnung zu bekommen, und zwar im dortigen Schloss, einem Landgut der alten Adelsfamilie von der Gablenz. Wir zogen ins Kellergeschoss oder Tiefparterre des Hauses. Das war nicht übermäßig komfortabel, schon gar nicht schlossmäßig üppig, aber sicher.
Im Dorf hieß das Gebäude „das Schloss“. Es bestand aus einem in grauen Feldsteinen gemauerten, mehrstöckigen, an erhöhter Position mitten im Dorf gebauten Herrscherhaus, wohl vorrangig als Jagdsitz genutzt, mit ein paar Nebengebäuden an der Seite, einem kleinen Park darum und einer Mauer zum Ort hin. Eine breite, geschwungene Treppe führte ins Hochparterre, wo der Schlossherr im „Rittersaal“ mit seiner Jagdgesellschaft zu speisen pflegte, wenn er denn zur Jagd zog, was nun schon lange nicht mehr der Fall war. Seidene Tapeten, kostbare Teppiche und Bilder und besondere Möbelstücke füllten die Räume.
Für die Dorfjugend, aber ebenso für meine Schwestern, war „das Schloss“ ein zugleich märchenhafter wie unheimlicher Ort. Im Schloss, hieß es, spuke es. Da gab es verbotene Räume, die allen Gespenstergeschichten Nahrung boten. Auf den Gängen standen rostige Ritterrüstungen herum, die, wenn man sie berührte oder wenn ein Windzug hindurchfuhr, gruselig klirrten und schepperten, da gab es ein Zimmer, in dem es, besonders bei stürmischem Wetter, wimmerte und heulte. Durch die Kamine pfiff der Wind, die Dielen und Türen knarzten und ächzten. Die unteren Kellergewölbe, erzählt meine ältere Schwester, die schon vier war, als wir hier ankamen, und die von unserem neuen Heim am meisten mitbekommen hat, waren dunkel und unheimlich. Nur einmal musste sie mit allen Hausbewohnern in die hinteren, von Fledermäusen bevölkerten Räume, als dann doch ein einzelner Bomber in offensichtlich gezieltem Auftrag über dem Ort erschien und, bei strahlend blauem Himmel, die nahegelegene Salzfabrik in Schutt und Asche legte.
Mein Reich war kleiner und überhaupt nicht gespenstisch. Der das Gebäude umgebende Park mit seinen hohen Bäumen, mit den Blumenbeeten und die Wege begrenzenden, duftenden Buchsbaumhecken war für mich, so habe ich es mir erzählen lassen, ein wunderbarer Ort zum Spielen. Hier lernte ich laufen. Hier fand ich meine erste Freundin. Ein frühes Bild zeigt mich, wie wir zwei Blondschöpfe auf den Kieswegen Steinchen sammeln.
Und dann war da Gerda, unsere Perle, die aus dem Ort stammte, deren lebenspraktische Art uns entscheidend half, über diese schlimmen Jahre zu kommen. Sie habe mich besonders ins Herz geschlossen und gern in der Kinderkarre durch den Ort spazieren gefahren. Nicht ganz ohne Neid haben mir meine Schwestern erzählt, Gerda habe mir jeden Tag einen rotbäckigen Apfel mitgebracht. Aus eigener Erinnerung kann ich so viel bestätigen, dass ich zeitlebens ein Freund von rotbäckigen Äpfeln geblieben bin.
Vor allem meine Mutter, die schon während ihrer Schwangerschaft Angst hatte, ob sie in einer Zeit der Mangelernährung das Kind in ihrem Leib gut versorgen könnte und, wie sie erzählte, alles in sich stopfte, was sie zu essen bekam, schob mich, den gut Geratenen und gut Genährten und endlich als Stammhalter Vorzeigbaren, mit Stolz in ihrer weidengeflochtenen Kinderkarre vor sich her. Davon zeugt ein altes Bild. Nun war das Wichtigste getan. Ich glaube, es beseelte sie die Überzeugung, erst ich hätte sie richtig zur Mutter gemacht. Es gibt ein paar Bilder, aufgenommen, als ich vielleicht ein knappes Jahr alt war, auf denen mich, eben aus der Badewanne gehoben und nachtfertig gemacht, meine Mutter, der der Stolz aus den Augen springt, auf dem ins Bild geschobenen Küchentisch mit der Rechten mich haltend und mit der Linken mir wie zufällig das Nachthemdchen hochschiebend, dem Fotografen präsentiert: „Hier sieh! Das isser! Es ist alles dran! Und er ist wohlgenährt!“ Wahrscheinlich hat sie meinem Vater die Bilder ins Feld geschickt. Pausbäckig, eingepackt in Babyspeck, gerahmt von reichen dunklen Locken, nahm ich‘s gelassen. Meine Großmutter, die sonst nichts Orakelhaftes an sich trug, nannte mich gern „unsern Prälaten“.
Die Zeit im Schloss, meine ersten knapp drei Lebensjahre, waren eine glückliche Zeit für mich. Es waren vaterlose Jahre. Was die äußerlichen Zerstörungen betraf, zog der Krieg an uns vorbei. Von den äußeren Belastungen und täglichen Beschaffungsproblemen, die meine Mutter zu be wältigen hatte, bekam ich nichts mit.
Bald nach der Wende habe ich, zusammen mit meiner älteren Schwester, die Stätte meiner ersten Kindheit aufgesucht. Vergeblich suchten wir das Schloss. Wir sprachen mit einigen Dorfbewohnern. Von einem Schloss wussten sie überhaupt nichts. Erst ein älteres Mütterchen half uns weiter.
Das „Schloss“ gab es längst nicht mehr. Herrscherhäuser dieser Art passten nicht in den Arbeiter- und Bauernstaat. Es wurde schon in den fünfziger Jahren geschleift, und an seine Stelle baute man einen HO-Laden von seltener Hässlichkeit, der aber bereits selber wieder, als wir in den Ort kamen, verfiel. Er hat nichts Besseres verdient. Den angrenzenden Park, der, wie ich dann sah, kleiner war, als ich dachte, hatte man kahlgeschlagen. Hier also standen damals hohe alte Bäume, blühende Sträucher und Blumenrabatten, hier und da eine Bank. Auch die Umfassungsmauer wurde weitgehend abgetragen. Zurück blieb ein verwahrlostes Gelände. Vom Idyll meiner ersten drei Lebensjahre war und ist nichts mehr zu finden. Nur eine Mixtur aus schemenhaften Bildern und Erinnerungen und das Wissen um einen glücklichen Ort. Das schmerzhafte Gefühl stieg erst später in mir auf, als wir schon auf der Rückfahrt waren.
Ausgebombt
Dies ist keine leicht zu erzählende Geschichte. Kann ich sie überhaupt erzählen, obwohl ich gar nicht dabei war? Was ich darüber weiß, habe ich nur aus zweiter Hand, aus sehr seltenen, ganz spärlichen Bemerkungen meines Großvaters und meiner Mutter. Aber was die Ereignisse bewirkten, was sie in unserer Familie und in mir anrichteten – das ist aus erster Hand.
Berichte über die Bombennächte und die Zerstörung der deutschen Städte hat es immer schon gegeben; aber sie haben nur wenige Menschen interessiert. Erst in den letzten Jahren entstand ein breiteres Nachfragen nach dem, was damals geschah. Lange wurde darüber nichts erzählt. Nichts kennzeichnet die vielen Jahre nach dem Krieg so sehr wie dies: dass über die Kriegszeit geschwiegen wurde. Es ist typisch für die vom Krieg Beschädigten, dass sie nichts erzählten, und es ist typisch für die Kriegskinder und Kriegsenkel, dass sie nicht gefragt haben und nichts wissen. Man weiß inzwischen, dass das, was nicht erzählt wird, oft umso massivere Nachwirkungen hat. Deshalb muss ich davon erzählen.
Das bittere, dramatische Gesicht des Krieges erreichte unsere Familie Ende 1943. Eines Tages standen die Eltern meiner Mutter vor der Tür und brauchten ein Zuhause. In der Kasseler Bombennacht wurde ihr Haus getroffen, in dem sie seit fünfundzwanzig Jahren in einer Etagenwohnung lebten. Es war eine Brandbombe. Es blieb nichts heil. Außer ihrem nackten Leben konnten sie fast nichts retten. Sie standen vor dem Nichts. Sie wurden „ausgebombt“, wie man das nannte.
Wie zahllose andere wurden sie Opfer jener unsäglichen Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung 1943 und 1944, mit denen die Nazis in England begannen und die die Alliierten in Deutschland perfektionierten. Aus den Städten in Deutschland wurden Trümmerwüsten. Die Bombergeschwader zerbombten den Menschen nicht nur ihr Zuhause, ihre Städte, ihre Heimat. Sie zerbombten auch ihre Seele.
Am Freitag, dem 22. Oktober 1943, einem schönen Herbsttag, legten die Bomber einen Großteil von Kassel in Schutt und Asche.
Ich habe lange nicht verstanden, was das heißt: „ausgebombt“ zu sein. Ich wusste nur: Meine Großeltern haben alles verloren. Vor allem das Klavier. Ich habe mir nie klargemacht, ahne es auch jetzt nur von fern, was das bedeutet und wie es gewesen sein kann, als ihre Wohnung in der Querallee, nahe der Wilhelmshöher Allee, das Zuhause, in dem meine Mutter aufwuchs, getroffen wurde.
Heute erst frage ich mich: Als an jenem schrecklichen Tag die Bombe einschlug: Wie war es da? Wo waren meine Großeltern? Waren sie in den Luftschutzkeller gerannt? Waren sie überhaupt zusammen?
Wie ist das, wenn man im Keller hockt und die Granaten heranheulen hört, wenn die Einschläge dichter werden und näher kommen, wenn ein Geschoss ganz nah heranzischt und jeder in Sekundenbruchteilen spürt: Jetzt werden wir getroffen? Was geschieht, wenn die Mauern beben, wenn sie Risse bekommen und in beißenden Staubwolken zusammenstürzen, wenn sie mit ohrenbetäubendem Getöse alles unter sich begraben, wenn die Decken einbrechen, wenn das Haus zerplatzt und sich jeder retten will? Wie ist das, wenn das Haus, die gesamte Straße, die ganze Stadt Feuer fängt, wenn es sengend heiß wird und man vor Qualm und Hitze nicht atmen kann, wenn der Sog des Feuers die Menschen über die Straßen fegt, wenn es Steine, glühende Teile und Asche regnet, wenn immer wieder Wände einstürzen und keiner weiß, wo er Schutz finden soll?
Die ganze Stadt ein Flammenmeer: Verletzte, Zerfetzte, Erschlagene, Verbrannte, Tote. Menschen kämpfen und rennen ums nackte Überleben, suchen schreiend ihre Angehörigen, wühlen in den Trümmern nach Verschütteten, haben den Verstand verloren. Und überall brennende Schneisen der Verwüstung – ein Inferno aus Angst, Panik, Geschrei, stummer Trostlosigkeit. Gehen solche Bilder jemals wieder aus der Seele? Es sind Tage, Wochen des nackten Schreckens, menschlicher Verzweiflungen und persönlichen Versagens; und sicher auch hier und da einzelner Heldentaten, die nie erzählt werden.
Nichts blieb übrig von dem Haus, in dem die Großeltern lange lebten und sich wohlgefühlt haben, in dem meine Mutter ihre Kindheit verbrachte. Fast alles verbrannte, fast alles ging verloren. Fast alles Persönliche wurde ausgelöscht. Was man ein Leben lang ansammelte, ist nur noch verkohl-ter Schutt. Wie kann man das verkraften? Keine Erinnerung bleibt unbeschädigt.
Meine Großeltern haben uns wenig, nein, fast nichts davon erzählt, auch meine Mutter hat, soweit ich es erinnere, so gut wie nie darüber geredet. Sie alle wollten vergessen. Aber wie kann man das vergessen? Man muss, höre ich sie denken. Sonst wird man verrückt. Man muss weiterleben. Das Äußere wird zum Korsett für das Innere.