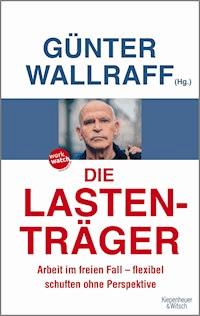9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bernt Engelmann und Günter Wallraff haben sich in diesem inzwischen berühmt gewordenen Buch zusammengetan, um die bundesdeutsche Gesellschaft vereint in die Zange zu nehmen. Aus verschiedenen Richtungen gehen sie ihr gemeinsames Ziel an: das Ausmaß des Widerspruchs zwischen der Anhäufung von Reichtum und Macht der wenigen und der Abhängigkeit und Ausnutzung der vielen aus unmittelbarer Anschauung durchsichtig zu machen. Die Welt der Milliardäre, für Millionen Leser in den Illustrierten verklärt, rückt hier nah und zeigt ihren weniger glänzenden Hintergrund.Engelmann war zu Besuch bei der Prominenz. Aus seinen Beobachtungen ergibt sich beiläufig die Geschichte des westdeutschen Nachkriegskapitals, die fast immer ein Beleg ist für die Wahrheit des Leitspruchs "Unrecht Gut gedeihe gut."Wallraff war bei denen "da unten", als Arbeiter, Vertreter, Bote, Portier oder Lakaien-Mönch. Er hat sich dabei den oft brutalen, oft verschrobenen Arbeitsbedingungen ausgesetzt. In seinen Berichten enthüllt sich die Pathologie der Reichen und vor allem die Realität, dass Geld, in Milliardenbeträgen in den Händen einzelner konzentriert, umschlägt in eine weit verzweigte politische Macht, der in unserer Gesellschaft kein Gesetz beizukommen vermag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Bernt Engelmann / Günter Wallraff
Ihr da oben - wir da unten
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Bernt Engelmann / Günter Wallraff
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Krupp
Bernt Engelmann
Der Märchenprinz: Arndt von Bohlen und Halbach
Ein sanfter, ungemein wohlerzogener, außerordentlich gepflegter junger Herr von zunächst überraschend dezenter, bei näherem Hinsehen aber recht extravaganter Eleganz, dessen Visitenkarten vier Adressen aufgeprägt sind: 8 München 13, Georgenpalais; Schloss Blühnbach, Werfen über Salzburg; ›Bled Targui‹, Marrakesch, Marokko, und 43 Essen-Bredeney, Auf dem Hügel. Jede dieser Adressen hat eine seltsame Geschichte: Im Georgenpalais in München-Schwabing nahm nach dem schrecklichen Ende der bayerischen Räterepublik der päpstliche Nuntius Quartier: Erzbischof Eugenio Pacelli, der später Papst Pius XII. wurde. Die hohen, getäfelten, kostbar tapezierten, etwas düsteren Räume mit ihren Erkern und Nischen, den vielen Schnitzereien und dem Violett der einstigen erzbischöflichen Hauskapelle – das alles wäre nicht nach jedermanns Geschmack. Doch der gerade erst dem Twen-Alter entwachsene nunmehrige Nachfolger des ›Stellvertreters‹ fühlt sich hier ganz zu Hause. Er hat seine eigenen Schätze mitgebracht. Zwei Gemälde von Rubens, ein van Dyck, ein paar weitere niederländische Meister, die zusammen ein paar Millionen Mark wert sein mögen, ohne dass sie einem deswegen gefallen müssen, hängen im langen, nur durch künstliches Licht erhellten Korridor, dazwischen ein Porträt des jungen Hausherrn in der Pose eines Torero und mit dem melancholischen Blick eines schönen Märchenprinzen.
Auch die zweite Adresse, Blühnbach, ist kirchlichen Ursprungs. Das Jagdschloss mit seinen fünfzig Schlafzimmern, Salons, Prunksälen und Hallen, für das ein siebzigköpfiges Personal erforderlich ist, gehörte einst den Salzburger Erzbischöfen, dann den Habsburgern, zuletzt jenem Erzherzog Franz Ferdinand, dessen Ermordung in Sarajevo den Ersten Weltkrieg auslöste. Zwei Jahre später, 1916, legte der Großvater des jetzigen Schlossherrn, damals Deutschlands führender Rüstungsindustrieller, einen Teil seiner ungeheuren Kriegsgewinne hier an. Er kaufte den Habsburgern, die das Ende ihrer Herrschaft nahen sahen und ihren Grundbesitz zu liquidieren begannen, die Besitzung Blühnbach für fünf Millionen Goldmark ab. Das war spottbillig, wenn man bedenkt, dass das Schloss allein heute mindestens so viel wert ist und dass zwischen 1916 und 1971 zwei totale Geldentwertungen liegen, die das deutsche Bürgertum um alle Ersparnisse brachten. Es gehören aber zum Jagdschloss Blühnbach auch noch riesige Wälder, Berge, Almen und Bäche, ein paar Dörfer, holzverarbeitende Betriebe, ein die ganze Gegend versorgendes Elektrizitätswerk sowie rund hundertfünfzig Kilometer asphaltierte Privatstraßen, einst von k.u.k. wehrdienstpflichtigen Rekruten für die Habsburger kostenlos gebaut. Und das ganze Besitztum ist größer als das Fürstentum Liechtenstein: fast 180 qkm …!
Bei der dritten Adresse, einer herrlichen Besitzung inmitten einer der schönsten Oasen Nordafrikas, handelt es sich um ein Geschenk, das der Sultan von Marokko einst dem Vater des jetzigen Besitzers, seinem Geschäftsfreund in Waffentransaktionen, gnädigst zu machen geruhte. Wie das mit Fürstengeschenken so zu sein pflegt, hatte auch dieses generöse Präsent den Sultan sehr wenig gekostet – nur einen Federstrich: Villa und Gärten waren Eigentum des Paschas von Marrakesch gewesen, der das Pech gehabt hatte, in Ungnade zu fallen und enteignet zu werden. Umso teurer wurde das Geschenk für den neuen Eigentümer, der für Unsummen Haus und Gärten völlig neu gestalten, mit allem Komfort versehen und ein fünfzig Meter langes Zierbecken sowie ein 180 Quadratmeter großes Schwimmbad bauen ließ …
Die vierte Adresse auf den Visitenkarten, Auf dem Hügel bei Essen, ist eine dezente Umschreibung für jenes architektonische Monstrum, ausgedehnt wie der Hamburger Hauptbahnhof, pompös wie ein wilhelminisches Oberlandesgericht und ebenso düster und hässlich wie beide: die alte Krupp-›Villa Hügel‹. Sie wurde erbaut von ›König Alfred‹ Krupp, dem eigentlichen Firmengründer, dessen Vater, Friedrich Krupp, zwar dem Unternehmen den Namen gab, doch nichts als Schulden hinterlassen hatte. Er, den die Legende zum ›tatkräftigen, nimmermüden Pionier der deutschen Stahlindustrie‹ ernannt hat, war in Wirklichkeit der Ruin seiner Familie und der kleinen Fabrik gewesen und hatte die letzten Jahre seines Lebens damit verbracht, im Bett zu liegen und schweigend an die Decke zu starren, bis ihn ›Kräfteverfall‹ infolge totaler Bewegungslosigkeit dahingerafft hatte … Sohn Alfred, der mit ungeheurem Ehrgeiz und der Rücksichtslosigkeit eines frühkapitalistischen Unternehmers die bankrotte Fabrik zur gigantischen ›Waffenschmiede der Nation‹ machte, war in doppelter Hinsicht erblich belastet: sein monomanischer Geltungsdrang brachte das Werk wiederum an den Rand des Bankrotts, und nur durch enorme Staatszuschüsse und -kredite konnte die ›vaterländische Anstalt‹ gerettet werden; zum anderen starb auch er in völliger geistiger Umnachtung, nachdem er zuvor bereits, nicht zuletzt beim Bau der ›Villa Hügel‹, deutliche Symptome manisch-depressiven Irreseins gezeigt hatte.
Alfreds einziger Sohn, Fritz Krupp, war ein schwächlicher Junge mit homophilen Neigungen, die er dem Stil der Zeit entsprechend durch männlich-›zackiges‹ Auftreten zu verbergen trachtete. Nur auf Capri wagte er, seiner Vorliebe für halbwüchsige Fischerknaben ungeniert nachzugehen, und später importierte er seine kleinen Schützlinge nach Deutschland, zwar nicht gerade nach Essen, aber nach Berlin. Dort wurden sie von seinem bevorzugten Hotel als Pikkolos und Pagen eingestellt, wurden jedoch nach genauen Anweisungen des Herrn Krupp bevorzugt beköstigt und gekleidet, auch – im Gegensatz zum übrigen Personal – regelmäßig gebadet und glänzend bezahlt.
Um das gewaltige Unternehmen, das er geerbt hatte, kümmerte sich Fritz Krupp so gut wie gar nicht. Er überließ das Management einem tüchtigen Generaldirektor und endete 1902, nachdem seine ›Ausschweifungen‹, wie man es damals nannte, publik geworden waren, durch einen – selbstverständlich vertuschten – Selbstmord. Er starb ohne männlichen Erben; die inzwischen zum größten Stahl- und Waffenproduzenten Mitteleuropas gewachsene Firma Fried. Krupp wurde Alleineigentum seiner Tochter Bertha, und diese heiratete 1906 den Legationsrat Gustav von Bohlen und Halbach, den Kaiser Wilhelm, der als Brautvater fungierte, Allerhöchstderoselbst zum Krupp beförderte, indem er ihm gestattete, künftig diesen Namen vor seinen eigenen zu setzen.
Gustav von Bohlen und Halbach, von seinen nächsten Angehörigen ›Taffy‹ genannt, wurde also Prinzgemahl der damals reichsten Frau Deutschlands und zog mit Bertha in die – von den beiden dann noch weiter ›verschönte‹ und ausgebaute – ›Villa Hügel‹. Das Unternehmen führte (bis 1918) der Alldeutsche und spätere deutschnationale Parteichef und Harzburger Bündnispartner Hitlers, Geheimrat Alfred Hugenberg, und infolge des allgemeinen Wettrüstens und der dann 1914 einsetzenden Hochkonjunktur für Rüstungsgüter aller Art wurden die Krupp von Bohlen und Halbach immer reicher und reicher. Übrigens, Bertha-Ehemann Gustav war keineswegs von uraltem Adel, vielmehr noch als gewöhnlicher Gustav Halbach geboren. Bohlen war der Mädchenname seiner Mutter, die eine Kusine des Vaters war, und beide entstammten biederen, aus Deutschland in die USA ausgewanderten Handwerkerfamilien. Ihr ›von‹ verdankten die Bohlen-Halbachs einem Prinzen von Baden, dem sich Gustavs Vater nützlich gemacht hatte, so wie sie die Ehre, die Erbtochter Bertha zur Schwiegertochter zu bekommen und ›Taffy‹ zum Krupp befördert zu sehen, dem Wohlwollen der Hohenzollern verdankten. ›Taffy‹ wurde indessen ein waschechter Krupp: Auch er zeigte früh Symptome der Geistesgestörtheit, insbesondere eine krankhafte Pedanterie, die selbst die Bewirtung von Gästen einem auf Sekunden genau eingeteilten Protokoll unterwarf. Auch lernte er Fahrpläne auswendig und machte eine Staatsaffäre daraus, wenn ein – von ihm gar nicht benutzter – D-Zug mit zwanzig Sekunden Verspätung seine Kontrollposten passierte. Später verfiel auch er in geistige Umnachtung und starb auf Schloss Blühnbach …
So weit die Geschichte der vier Adressen auf der vornehm geprägten Visitenkarte des jungen Herrn, der sich selbst nicht mehr Krupp nennt wie sein Vater Alfred und sein Großvater Gustav, sondern Arndt von Bohlen und Halbach.
Immerhin – man entnimmt es schon seiner Visitenkarte – versteht er, wie die Krupps zu repräsentieren und ihre nun schon etwas angestaubten Traditionen zu wahren. Doch die Verbindung zwischen seinen diversen Wohnsitzen hält er auf zwar standesgemäße, aber für die einstigen Alleininhaber einer ›vaterländischen Anstalt‹ unkonventionelle Weise: nicht mit deutschen ›Mercedes‹ – sondern mit Limousinen und Coupés britischer Machart der Marke ›Rolls-Royce‹; mit einer in Holland gebauten, im Mittelmeer stationierten 4,5-Millionen-Luxus-Hochseejacht, die nicht ›Germania‹ heißt wie die berühmte Jacht seines Vaters, sondern ›Antinous II‹, was ebenfalls seine Bedeutung hat, war doch Antinous der bildschöne Jüngling, dem sein hoher Geliebter, Kaiser Hadrian, ein palastartiges Grabmal errichtete, Tempel und Festspiele weihte; demnächst wohl auch mit einem Privatjet, den Arndt, der längst zum internationalen Jetset zählt, sich, wie er sagt, ›am sehnlichsten wünscht‹ …
Dass er sich seinen Wunsch bisher noch nicht erfüllt hat, ist nicht auf Knauserigkeit zurückzuführen. Denn Arndt von Bohlen und Halbach geizt nicht. Er führt ein großes Haus, bewirtet seine Freunde und deren Anhang auf wahrhaft fürstliche Weise und lässt sich den Unterhalt seines Jagdreviers, obwohl er sich aus dem edlen Waidwerk selbst gar nichts macht, die Knallerei verabscheut und ›Bambi-Braten‹ verschmäht, jährlich viele Hunderttausende kosten – nur für andere, die daran Freude haben, wie der griechische Reeder und Onassis-Konkurrent Stavros Niarchos, wie Krupp-Hausmeister Berthold Beitz und einige deutsche und österreichische Hocharistokraten. (Ein wenig tut er es also doch für sich selbst, denn er umgibt sich nun einmal gern mit Leuten, die zum Jetset gehören und mit ihren auch seinen Namen in die Gesellschaftsklatschspalten der internationalen Presse bringen …)
Als Arndt von Bohlen und Halbach, ›der letzte Krupp‹, Anfang 1969 die Prinzessin Henriette (›Hetty‹) von Auersperg heiratete, da ließ er diese Hochzeit zu einem Ereignis werden, das monatelang und weit über den deutschsprachigen Raum hinaus Wellen schlug, das Paar zum Illustrierten-ldol werden ließ und zu den ausgedehnten Feierlichkeiten in Salzburg und Blühnbach internationale Prominenz und damit auch die Weltpresse herbeilockte. Auch die Hochzeitsreise – in Begleitung des Pullöverchen strickenden Prinzen Ruppi von Hohenlohe-Langenburg, eines Prinz-Philip-Neffen, der bei Arndt und Hetty die Rolle eines diensttuenden Kammerherrn übernommen hat – mit der ›Antinous ll‹ durch das Mittelmeer nach Spanien und Marokko fand weltweite Beachtung. Für diese sorgt übrigens ein dazu engagiertes PR-Team, dessen Aufgabe es ist, Arndt und damit notgedrungen auch Hetty Publicity zu verschaffen, wobei die Frage, ob sich diese positiv oder negativ auswirkt, von drittrangiger Bedeutung ist. Wenn beispielsweise Erbprinz Johannes von Thurn und Taxis dem lieben Freund Arndt im Kitzbüheler Beatschuppen ›Drop in‹ ein Büschel Haare ausreißt, weil er nicht glauben will, dass Arndt ausnahmsweise keine künstlichen Locken trägt, so findet auch dies seinen Weg auf die Titelseite der ›Bild‹-Zeitung … Dergleichen lässt sich Arndt von Bohlen und Halbach jährlich einen sechsstelligen Betrag kosten …
Er lässt sich vieles viel kosten, und das überrascht eine Menge Leute. Arndt ist ja kein Industrieller mehr; er hat mit der Fried. Krupp GmbH und deren Konzern – so heißt es – nicht das Geringste mehr zu tun. Seit dem Tode seines Vaters Alfred am 30. Juli 1967 gibt es überhaupt keine Verbindung zwischen Krupp und von Bohlen und Halbach mehr, nicht einmal dem Namen nach. Und schon einige Monate vorher hatte die Krupp’sche Alleininhaberschaft ihr Ende gefunden, war Staatshilfe nötig geworden und die Umwandlung des persönlichen Eigentums am Konzern in eine Stiftung, wobei Arndt in aller Form auf seine Erbrechte verzichtet hatte.
Nun ist das alles richtig – und auch wieder nicht ganz. Zwar hat Arndt keinerlei Einfluss auf die Firmenleitung mehr, auch kein Eigentum am Krupp-Konzern, wohl aber ein sehr stattliches Einkommen, das von Krupp und den Kruppianern, wie sich die Arbeiter des einstigen Familienunternehmens mehr oder weniger stolz nennen, erwirtschaftet werden muss. Dieses Einkommen aus Essen beläuft sich auf jährlich mindestens zwei steuerfreie Millionen, von denen die eine durch einen sogenannten Förderrentenvertrag erheblich vermehrt werden konnte und auch wurde. Die besonders wertvolle und ergiebige Krupp-Zeche Rossenray war mit einer Art von Hypothek, einem lebenslänglichen Nießbrauch, zugunsten des Krupp-Sohnes Arndt belastet worden: Je mehr die Kumpel auf Rossenray ›malochten‹, je mehr Rossenray-Kohle gut verkauft wurde, desto mehr bekam Arndt, mindestens eine Million, nach sachverständigen Schätzungen aber etwa vier Millionen jährlich. Das musste geändert werden, als Rossenray aus dem Krupp-Konzern gelöst und in die neue Ruhrkohle-Interessengemeinschaft eingebaut wurde. Aber im Grunde hat das am Sachverhalt nur insoweit etwas geändert, als zwar immer noch die Zeche Rossenray und ihr Ertrag den Maßstab für einen Teil der Arndt’schen Einkünfte liefern, nur zahlt nicht mehr Rossenray selbst die Zeche, sondern die Firma Krupp.
Die Millionen aus Essen sind aber nur ein Teil der Apanage, die der junge Märchenprinz mit den Seidenwimpern erhält. Das gesamte Privatvermögen seines Vaters – und dazu gehörte nicht nur das Besitztum Blühnbach, das Palais in Marokko und die Gemäldesammlung im Werte von vielen Millionen, sondern auch ein sehr dickes Aktienpaket, mancherlei ausländischer (und inländischer) Grundbesitz, eine Menge Bankkonten in der ganzen Welt und sogar ein eigenes Bankhaus in Essen. Alles in allem vielleicht eine Milliarde Mark, vielleicht erheblich mehr, vielleicht etwas weniger. Blühnbach allein ist schätzungsweise 300 Millionen wert …
Nein, Arndt von Bohlen und Halbach und infolgedessen auch seine Frau Hetty brauchen sich keine großen Sorgen um ihr Ein- und Auskommen zu machen, und das tun sie wohl auch nicht. Und schon gar nicht brauchen sie an den Krupp-Konzern und die dort beschäftigten fast hunderttausend Menschen und deren Familien zu denken. Das geht sie nichts mehr an (oder nur noch insofern, als eine blendende Ertragslage bei Rossenray auf dem Umweg über die Verpflichtungen der Firma Fried. Krupp GmbH die sofortige Anschaffung des Privatjets ermöglichen würde, ohne Kredite in Anspruch zu nehmen …).
Der junge Herr war verschnupft, als ich ihn zuletzt besuchte, nicht verärgert, nein, er hatte einen Schnupfen. Er war, wie immer, sehr liebenswürdig, ein exquisiter Gastgeber mit wirklich blendenden Manieren. Er sprach mit sanfter Stimme. Er betrachtete sich besorgt im Spiegel, ehe wir gemeinsam das Georgenpalais verließen, in dessen Treppenhaus von unheimlicher Pracht es immer noch etwas nach Weihrauch riecht. »Wissen Sie«, sagt er, »ich wünschte, die Leute würden einsehen, dass ich ein Recht habe, auf etwas größerem Fuß zu leben als sie …« Und dann drückt er Boujemaa, dem marokkanischen Butler, sein schnupfenfeuchtes Taschentuch in die ergebene braune Hand, empfängt von ihm ein blütenweißes Tuch als Ersatz sowie ein Bündel Geldscheine – für nachmittägliche Einkäufe und Bewirtungen. »Tausend DM Klimpergeld am Tag, die brauche ich«, meint der junge Märchenprinz nachdenklich.
Günter Wallraff
Treue gegen Treue
Zwischen einer Massage durch den marokkanischen Judomeister und den Vorbereitungen an der Hausbar auf das Dinner wird Arndt von Bohlen und Halbach von einem Reporter gefragt, ob der Herr einmal zu arbeiten gedenkt.
»Das hat mir gerade noch gefehlt.«
»Eine waranige Idee«, sagt Frau Hetty, Prinzessin von Auersberg, »wissen Sie, was ein Waran ist? Eine Echse. Der Waran ist immer hässlich, immer schlecht gelaunt, immer fletscht er die Zähne, so wie die meisten Menschen.«
Jürgen F. gehört zur Gattung der ›schlecht gelaunten Meistenmenschen‹. Die ›schlechte Laune‹ ist bei ihm Folge 26-jähriger Arbeit unter Tage auf Krupp-Zechen und der Staublunge, die sie ihm eingebracht hat. Auch die ›Hässlichkeit‹ ist ihm nicht angeboren; dass er aussieht wie über 60 und erst 48 ist, könnte ihm als Hässlichkeit ausgelegt werden. Vielleicht auch die schwarzblauen Narben an Gesicht und Händen: die hat er von zahlreichen Arbeitsverletzungen. Als er die Arbeit wiederaufnahm und kleinere Verletzungen noch nicht auskuriert waren, »heilte« die Kohle in die Haut. Und wenn er seine ›Zähne fletscht‹, tut er es nicht, weil es ihm Spaß macht oder um furchterregend auszusehen, vielmehr, wenn das Wetter seiner Staublunge zu schaffen macht, bei Nebel etwa oder bei trockenem Gewitter, wenn er nach Luft japst und ihm nachts die Sauerstoffpumpe neben seinem Bett kaum Erleichterung verschafft.
Jürgen F. gehört zu den Fällen, in denen vom Grubenarzt Silikose knapp unter 30 % diagnostiziert wurde. (Bei ihm genau 29,5 %.) Hätte der Arzt noch ein halbes Prozent mehr Staub in seiner Lunge entdeckt, wäre er rentenberechtigt. Jedoch eine seltsame Laune der Natur will es so, dass in der Bundesrepublik weitaus mehr Bergleute mit knapp unter 30 % Staublungen herumlaufen als mit etwas über 30 %.
Jürgen F. nennt den Fall eines Kumpels: »Bei dem hat der Krupp-Arzt nur 20 % Silikose festgestellt. Ein paar Wochen später, als er zusammenklappte und anfing, Brocken aus der Lunge zu husten, wurde plötzlich in der Lungenheilanstalt über 50 % Staublunge bescheinigt.« Als ich F. fragte, ob er seinem Sohn, wenn er im nächsten Jahr aus der Schule kommt, auch anrät, auf Zeche zu arbeiten, sagt F.: »Auf gar keinen Fall«, fügt dann aber hinzu: »Mein Vater hat das auch gesagt - und mein Großvater auch!«
Wie sich das Krupp-Vermögen in der Krupp-Dynastie von Generation zu Generation vererbt hat, so hier beim Krupp-Bediensteten die Maloche. Das zum Gesetz erhobene Wort des Firmengründers Alfred Krupp »Anfangen im Kleinen, Streben zum Großen« und »Treue gegen Treue« verhalf nur seiner eigenen Familie zu unermesslichem Reichtum, seinen Untertanen war ein anderer Leitsatz aus dem gleichen Gesetz zur Verwirklichung vorbehalten: »Treue, Pflicht und Fleiß sei unser Preis.« Jürgen F.s Vorfahren waren von der Willkür und Gnade Krupps in einem Maße abhängig, wie es die Sklaven Roms von ihren Herren auch nicht stärker waren.
Jürgen F.: »Wir wohnten immer in Häusern, die Krupp gehörten. Heute zahle ich für die Kruppwohnung hier in Kamp-Lintfort 200 Mark Miete. Fliege ich bei Krupp raus, zahle ich sofort 380 Mark.« F.s Eltern noch kauften alles Lebensnotwendige mit Krupp’schem Geld in Geschäften, die Krupp gehörten. Sie gingen in Schulen von Krupp und lernten aus Schulbüchern, die in Krupp-Druckereien in seinem Geiste gedruckt wurden. Nach dem Motto: »Mein Ziel ist, dem Staate viele treue Untertanen zu erziehen und der Fabrik Arbeiter eigener Façon.« Und die Untertanen funktionierten dann so gut, dass sie sich 1914 in einen Krieg hetzen und von britischen Granaten zerfetzen ließen, auf denen die Buchstaben KPZ (Krupp-Patent-Zeitzünder) eingeprägt waren. So konnte sich Krupp an dem Krieg doppelt bereichern. An gefallenen englischen und an toten deutschen Soldaten. Für jeden gefallenen deutschen Soldaten kassierte Krupp 60 Mark an Lizenzgebühren vom britischen Waffenkonzern Vickers. Als Deutschland den Krieg verloren hatte, war Krupp 400 Millionen Goldmark reicher, um dann vor 1933 rechtzeitig 4738440 Mark in den neuen Kriegsvorbereiter Hitler zu investieren. Wo es Profite herauszuschlagen galt, da schlug sie Krupp heraus, im Kleinen wie im Großen, aus gefallenen Soldaten und aus gerade noch so eben am Leben erhaltenen Zigtausenden Zwangsarbeitern. Jürgen F.: »Zu Zeiten meines Großvaters musste man bei Krupp sogar für seinen eigenen Rausschmiss bezahlen. Da kassierte die Werksfeuerwehr von jedem, der fristlos rausflog, noch 6 Mark Gebühr.« Nach dem 1. Weltkrieg, als es nichts mehr zu zerschießen gab und der Markt auf diesem Sektor eine längere Flaute befürchten ließ, eigneten sich vorübergehend die Zerschossenen für einen zwar kleinen, aber feinen Absatzmarkt. Jürgen F.: »Gustav Krupp hatte damals die Idee, den zuvor für Waffen verwendeten korrosionsbeständigen V2A-Stahl einem neuen Verwendungszweck zuzuführen. Daraus ließen sich prima Gebisse und Kinnladen herstellen. Krupp ließ in Essen eine Spezialklinik errichten, in der von Krupp angestellte Chirurgen und Dentisten Gebisse in die Münder von 3000 Deutschen einsetzten, die zuvor von mit Krupp’schen Patentzündern ausgerüsteten Granaten für diesen neuen Markt reifgeschossen worden waren.«
»Wir machen alles«, lautet ein Werbeslogan des Konzerns, wobei hinzuzufügen wäre, alles, was Profit bringt. Zur Zeit des »Versailler Vertrages«, als Deutschland zum absoluten Rüstungsstopp verpflichtet war, rüstete Krupp bereits wieder heimlich auf, wurden neue Waffensysteme in Tarnfirmen in Holland erprobt und hergestellt. Nach dem letzten Weltkrieg, als Alfred Krupp, kaum entlassen aus dem Kriegsverbrechergefängnis, sich zu der Erklärung durchrang, der Konzern werde »nie mehr Waffen produzieren«, wurde er ein paar Jahre später mit neu aufgenommenen Rüstungsaufträgen für die Bundeswehr wieder wortbrüchig. »Wir machen alles« ist die Parole des Kapitalismus, und wenn bisher, von Versuchen im 3. Reich abgesehen, z.B. noch keine Menschen zu Seife geschmolzen werden, ist das nicht der Humanität zu verdanken; sondern es ist nur so, dass es sich nicht lohnt, aus Leuten Seife zu machen. Krieg dagegen lohnt sich.
Jürgen F. zog nach Schließung der Kruppzeche Helenen vor 4 Jahren nach Kamp-Lintfort, um auf Rossenray einzufahren. Rossenray war lange Zeit die ertragreichste Zeche Europas. »Wir kamen uns wie Leibeigene vor, die dem Nichtstuer Arndt sein ohnehin süßes Leben noch mit weiteren Millionen versüßten«, sagt Jürgen F. »Je mehr wir schufteten und förderten, umso mehr scheffelten wir dem, der noch nie gearbeitet hat, in die Tasche. Mindestens 2 Millionen im Jahr aufgrund einer Leibrente, die ihm von jeder von uns geförderten Tonne Kohle einen Anteil auf Lebenszeit garantiert. Da kapierten plötzlich auch Kumpels, die sonst meinten, alles sei gerecht verteilt hier im Lande. Da fielen plötzlich Worte, die fast in Vergessenheit geraten sind, wie ›Enteignung‹. Und unsere Oberen machten sich ernsthafte Sorgen, was sich da alles noch dran entzünden könnte, und schlossen sich scheinbar unserer Empörung an. So offensichtlich und in aller Öffentlichkeit sollte die Ausbeute unserer Arbeit nun auch wieder nicht verprasst werden. Ausbeutung, na klar, aber, bitte schön, etwas seriöser. Da setzten sich einige Politiker – Schiller, Strauß und Arendt – zusammen und tüftelten einen neuen Vertrag aus, der dem jungen Krupp die gleiche Absahne garantiert, uns aber besänftigen soll. Es geht hier nicht allein um den jungen Krupp. Da muss man Flick, Thyssen, Henkel, Oetker und die vielen Großaktionäre genauso sehen, die sind es insgesamt, die sich auf den Knochen der Kumpels ausruhen. Jetzt meinen alle, wir schuften nicht mehr für das ›high-life‹des Krupp-Söhnchens, tun wir aber doch, wie ich mir hab sagen lassen. Der neue Vertrag wurde nie veröffentlicht, aber es soll so laufen, dass der seine Rente weiter nach unserer Förderungsquote einsteckt, nur dass wir sie nicht mehr direkt zahlen, sondern die Kumpels vom Gesamtkruppkonzern. So einfach können die sich das zur Zeit noch mit uns machen. Auf die Optik kommt es an, was dahintersteckt, soll uns nichts angehen.«
Jürgen F. erzählt, wie die »Optik reguliert« wurde, als Kiesinger mal zu einem Wahlbesuch in die Zeche einfuhr.
»Damit der auch nur strahlende Gesichter sah, wurde alles, was etwas linksabweichend war, für diesen Tag auf Nachtschicht abkommandiert.«
Jürgen F. berichtet aus dem Alltag der Krupp-Zechen: »Ein paar Jahre arbeiteten wir in ›kombiniertem Gedinge‹. Es basiert auf den Quadratmetern, die der Einzelne an Kohle raushaut, und an der Menge der Wagen, die von der Gruppe zusammen gefördert werden. Grundsätzlich stellt die Zechenleitung die Gedinge so zusammen, dass nicht etwa Gleichstarke in einer Gruppe arbeiten, sondern die Gruppenleistung vom Stärksten bestimmt wird. Wer schwächer ist, hängt immer hinten, quält sich ab und wird von den Stärkeren bis zum Geht-nicht-mehr angetrieben, das liegt in der Natur der Sache. Wir waren lange Zeit eine Gruppe, da gab es keine höheren Lohnunterschiede zwischen den einzelnen Kollegen als 20–30 Pfg. Diese Gruppe wurde systematisch von der Werksleitung geteilt, bis praktisch die Gruppe nicht mehr vorhanden war. Wir haben versucht, die neuen Schwächeren in unsere Gruppe zu integrieren, aber das ist auf Dauer kaum möglich, weil die Werksleitung ganz systematisch die Schwächsten in die Gruppe reinsetzt. Man kann zwar mal einen Meter Kohle für einen Mann mehr nehmen, das kann man auch für eine Woche oder 14 Tage durchhalten, aber dann ist Schluss mit der Solidarität, dann geht’s einfach körperlich nicht mehr, da fängt, worauf es die Zechenleitung ja anlegt, die gegenseitige Antreiberei an.
Als ein neues Revier eingerichtet wurde, das war ein Schrägbaubetrieb, die Kohle etwa um 55 Grad geneigt, die Kohle rutschte also ab, und durch das Abrutschen der Kohle nach dem Losbrechen war eine große Staubentwicklung zu erwarten. Nach bergbaubehördlichen Vorschriften muss bei solcher übermäßigen Staubentwicklung die Zechenleitung eine Tränkleitung legen und eine Hochdruckpumpe einsetzen, damit die zu fördernde Kohle angefeuchtet und der Staub auf ein Minimum herabgesetzt wird. Das verteuert natürlich die Förderung, verlängert aber das Leben der Kumpels; wenn man bedenkt, dass etwa jeder 3. Bergmann über 50 silikosekrank ist und in den letzten 4 Jahren in der Bundesrepublik 9000 Bergleute an Silikose gestorben sind. In unserem Fall sparte sich die Zechenleitung, wie schon mehrmals vorgekommen, das zeitraubende und kostspielige Tränken. Wir mussten im dicksten Staub arbeiten, die Kopflampe brachte keinen Meter mehr Licht, und bei einigen kam es bereits zu Erbrechen. Auf Beschwerden ließ uns der Obersteiger ausrichten, die Geräte zum Tränken seien alle defekt, und neue müssten erst bestellt werden. Nach einer Woche legte ich Beschwerde ein bei der Bergbaubehörde. Die mussten kommen und stellten nach weiteren 3 Tagen fest, dass die Staubentwicklung in dem Streben 130 hoch war, also mehr als doppelt über dem erlaubten Wert. Die Förderung musste sofort unterbrochen werden, und seltsamerweise waren am anderen Morgen die erforderlichen Geräte alle vorhanden. Die verantwortlichen Direktoren wurden mit Geldstrafen belegt, der Zechendirektor, der etwa 50000 im Jahr verdiente, musste 1000 Mark Strafe zahlen und unser Betriebsführer unter Tage 600 Mark. Der herausgewirtschaftete Mehrgewinn der im Staub geförderten Kohle dürfte um ein Hundertfaches über diesen Geldbußen liegen, ebenfalls die in diesem Fall herausgeholte Erfolgsbeteiligung der Direktoren. Du siehst also, es gibt zwar Gesetze, deren Einhaltung du notfalls auch erzwingen kannst, aber die Gesetze sind so lasch, dass sie aus Profitsucht jederzeit gebrochen werden können, ohne dass ein großes Risiko damit verbunden ist. Außerdem bekam ich meine Beschwerde ein Jahr lang zu spüren, ich bekam einfach nur noch die schlechtesten Arbeiten zugewiesen und verlor so pro Schicht bis zu 10 DM an Lohn, das war in dem Jahr eine Einbuße für mich von 2000 Mark. Der wirklich Bestrafte war ich, weil ich nichts weiter gemacht hatte, als unser Recht durchzusetzen.«
Hubert B., 66, ist ein Stück Firmengeschichte. Alles, was er denkt, sagt und tut, war nie Ausdruck seiner eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Er hatte zu denken, was verlangt wurde, nur das zu sagen, was erwünscht war, ohne je selbst die Möglichkeit gehabt zu haben, etwas zu sagen zu haben; tun musste er, was andere ihm auftrugen.
Hubert B., 45 Jahre im Hause Krupp tätig, seit einem Jahr pensioniert, war selber Werkzeug bei Krupp, »Krupp-Zeug«.
Stolz legt mir Herr B. das Trauerheft der Werkszeitung zum Ableben von Alfred Krupp vor. Darin hat er den Passus dick unterstrichen, wo verkündet wird, dass laut Testament das Werk in eine Stiftung umgewandelt würde: »Zweck dieser Stiftung soll es sein, die Einheit des Unternehmens Fried. Krupp zu wahren und nach näherer Bestimmung philanthropischen Zwecken zu dienen.« Zu »philanthropisch« hat sich Herr B. die Deutung aus dem Lexikon daneben geschrieben: »menschenfreundlich, menschlich gesinnt, griech.« »So war unser Chef«, sagt Herr B., »das Gesamtwohl geht ihm vor seinem eigenen Sohn.«
Aus der Vitrine holt Herr B. ein Etui, lässt es aufspringen und präsentiert eine vergoldete Uhr. »Meine Jubiläumsuhr, 21 Steine«, sagt er, »und alles eingraviert, mein vollständiger Name und gleich daneben der Name Krupp.« »Für 40 Jahre treue Mitarbeit«, steht eingraviert. »Man darf nie unangenehm aufgefallen sein und keine großen Fehlzeiten haben, sonst bekommt man zum Jubiläum nur eine Treueurkunde«, sagt Herr B.
»Ich bin pensioniert«, sagt B., »aber deswegen bin ich immer noch Kruppianer. Wir sind mit der Firma Krupp 100 %ig verbunden, von den Eltern angefangen, da gibt es nichts anderes. Selbst die wenigen Kommunisten, die es bei Krupp gab, waren verhältnismäßig harmlos, sie waren an erster Stelle Kruppianer, dann erst Kommunisten.«
»Kruppianer zu sein, ist eine Auszeichnung«, sagt B., »das müssen Sie wissen. Wir sind an erster Stelle gute Deutsche, dann Kruppianer, eine andere Partei gibt es für uns nicht. Ein Türke z.B. kann nie ein Kruppianer sein.«
Auf Krupps enge Liierung mit Hitler angesprochen: »Hören Sie mal, der alte Krupp hat den Hitler nie richtig empfangen, das war ein Etepetete, der Alte, drei Schritte Abstand. Da hat Hitler auf einmal gesagt, wenn Sie nicht wollen, werde ich Ihre Firma requirieren, annullieren. Was wollte er denn machen, der war doch selbst ein Gefangener. Es wäre besser gewesen, das Attentat auf Hitler wäre wirklich 100 % geglückt. Deutschland wäre dann noch eine Einheit und Millionen Menschen wären dann noch am Leben, und wir brauchten keine Fremdarbeiter. Millionen Deutsche, die in der Normandie und in Stalingrad und unterm Rasen liegen, wo der Stalin oder die Kommunistische Partei heute den Rasen sät, das wäre uns erspart geblieben.«
35 Jahre war Hubert B. als Montage-Facharbeiter bei Krupp beschäftigt, die letzten fünf Jahre wurde er wegen eines Betriebsunfalls zum Werkschutz abgeschoben.
»Dort hatte ich unter anderem ein riesiges fabelhaftes Büro zu bewachen, wo außer den Sekretärinnen, die meist Illustrierte lasen und sich die Zeit mit Kreuzworträtsellösen vertrieben, nie jemand drin war. Es war die für Arndt von Bohlen und Halbach vorgesehene Büro-Etage, Eingang B, 2. So wussten alle, dass es ihn als Erben gab, gesehen wurde er dort nie.«
An die Entlassung seines obersten Chefs Alfried Krupp aus dem Kriegsverbrechergefängnis Landsberg erinnert sich der Werkschutzmann: »Presse aus der ganzen Welt war erschienen und Wochenschau. Die Direktoren standen in einer Reihe Spalier. Berthold, der Bruder von Alfried, stand mit einem großen Strauß Tulpen und Narzissen empfangsbereit. Seinen neuen roten Porsche, einen der ersten, der in Deutschland auf den Markt kam und der erst eine Woche zuvor gekauft war, hatte er unauffällig in einer Seitenstraße geparkt, um den Journalisten aus dem Ausland keinen Vorwand zu liefern; damals galt noch das Urteil, dass der Konzern zwangsentflochten werden sollte. Für Alfried war ein VW-Kleinbus gemietet worden, auf einer Seite dieses Wäschereilieferwagens stand die Aufschrift: ›Schneeweiße Wäsche‹, erinnert sich der Werkschutzmann – »Später in der Firma hielt Alfried Krupp eine kurze Ansprache an die versammelte Belegschaft. Da versprach er uns, dass er es nie dulden werde, dass der Konzern auseinandergerissen und entflochten werde. ›Ich verkaufe meine Leute nicht wie Stücke Vieh‹, so sagte er wörtlich, und dieses Versprechen uns gegenüber hat er ja auch gehalten«, sagt der Werkschutzmann. Nach seinem schönsten Erlebnis bei Krupp befragt:
»Das war die Ehrung zu meinem 40-jährigen Firmenjubiläum. Wir Jubilare mussten uns unten in der Ehrenhalle treffen, dann wurden wir raufgeschleust. Da empfing uns Alfried Krupp persönlich, richtete einige Worte an uns und drückte jedem von uns die Hand. Er, der selbst Nichtraucher war, stellte uns eine Kiste Zigarren hin. Obwohl die meisten unten in der Halle noch geschmaucht hatten, wagte es jetzt keiner, die Zigarren anzurühren. Plötzlich waren da alle ›Nichtraucher‹. Ich ärgere mich noch heute, dass ich mir nicht wenigstens eine von dieser teuren Sorte eingesteckt habe. Der Alfried hätte uns so gerne eine geschenkt, aber wir waren halt zu feige.«
Hubert B. ist Freizeitmaler. Die Wände des engen Wohnzimmers sind mit selbst gemachten Bergidyllen behangen.
Hubert B.: »Hobby wurde bei der Firma Krupp stets gefördert. Von Prof. Hundhausen bekam ich immer Ehrenkarten für Kunstausstellungen in der Villa Hügel. Manchmal konnte ich wegen meines Dienstes nicht hin. Da musste ich mir aber trotzdem den Luxus leisten, zur Villa zu fahren und die Karten da knipsen zu lassen. Denn der Prof. Hundhausen kontrollierte das, der wollte wissen, ob man auch da war; wenn ich einmal weggeblieben wäre, dann wäre ich bei dem Prof. Hundhausen unten durch. Der hätte genau sehen können, wer nicht da war, die Karten waren ja nummeriert. Die waren ja auch nicht dumm. Wir sind auch nicht dumm, wenn wir auch für dumm verschlissen werden.«
Je mehr sich die Flasche Korn während unseres Gesprächs leert, umso offener wird Herr B. in seinen Äußerungen.
»Es gibt Dinge, über die man nicht sprechen kann, um nicht verachtet zu werden, wie es hier in diesem Krupp-Revier ist, verpönt oder schlechter gestellt zu werden, man muss mit den Wölfen heulen.
Aber ich will Ihnen jetzt mal was sagen. Im Grunde genommen scheiße ich auf die ganzen Auszeichnungen hier. Da war ich viel zu lange drauf stolz, da hab ich mich mit einwickeln lassen, ich war ja direkt ›Krupptoman‹. Ich habe bei Krupp als Monteur malocht wie ein Affe. Und immer brav, immer, immer nur deinen Dienst gemacht, keine Überstunden hast du versäumt, und was hatte ich zu guter Letzt davon! Ein Leistenbruch genügte, und ich war für die Arbeit als Spezialmonteur nicht mehr tauglich und wurde zum Werkschutz abkommandiert, und seitdem war ich eine Null. Ich habe keinen Betrug oder sonst was begangen, ich war ehrlich bis auf die Haut. Im Hügel gab es für jede Ratte, die man totschlug, 50 Pfennig. Ich habe im Hauptverwaltungsgebäude, wenn ich nachts da war, die meisten Ratten kaputtgeschlagen, pro Woche mehr als 20 Stück. Ich bin 32 Jahre als Garantiemonteur für Krupp rausgefahren, war am Westwall für Krupp zum Montieren von Spezialwaffen, und zuletzt als Garantiemonteur auf dem Panzerkreuzer Prinz Eugen. Alles nichts genützt, zuletzt ließ man mich’s spüren, dass ich einmal das falsche Gebetbuch hatte – der Chef vom Werkschutz hatte fast alle Mitglieder seiner katholischen Schützenbruderschaft bei Krupp rekrutiert, aber noch schlimmer, ich hatte nicht das richtige Parteibuch, ich war nie in der NSDAP, hatte mich immer an den Leitsatz vom alten Krupp gehalten: ›im Hause Krupp wird nicht politisiert‹. Dass ich das allzu wörtlich genommen hatte, ließ man mich nun spüren. Ich wurde schikaniert vom Werkschutzchef, wo es nur ging. Er eiferte seinem Vorgänger nach, dem Walter Hassel, einer Bestie, der im 3. Reich Vorgeführte zwang, mit einer Tasse eine Wassertonne im Hof leerzuscheppen, und wenn sie es nicht schafften, die Leute derartig durchgeprügelt hat, dass sie nicht sitzen und nicht stehen konnten.
Hubert B. legt mir seine Belobigungen und Firmenpräsente vor: »Das hat mich immer mit Stolz erfüllt, und plötzlich war alles einen Dreck wert. Hier die beiden Vasen, hab ich vom Graf Zedtwitz, dem Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, dem, der das Buch geschrieben hat ›Tu Gutes und rede darüber‹, persönlich überreicht bekommen, weil ich immer meine Pflicht getan habe, und er hat schöne Worte zu mir gesprochen.
Und genau das, wo mich Krupp am meisten für auszeichnete und belobigte, daraus ist mir zuletzt ein Strick gedreht worden, da war ich vom Fenster weg. Hier diese Anerkennung von Prof. Hundhausen für meine Bilder auf der großen Krupp-Ausstellung. Eigenhändige Widmung: ›Herrn Hubert B. für seinen hervorragenden Beitrag zur Ausstellung ›Schöpferische Freizeit 1964‹ in dem Buch ›Welt der Malerei – Das Wissen unserer Zeit‹. Und hier: noch einmal extra eine Ehrenurkunde dafür: ›Sehr geehrter Herr B.! Rund 8600 Besucher haben unsere 6. Ausstellung: – Schöpferische Freizeit in der Informationshalle der GRUGA gesehen. Vielleicht haben Sie selbst gemerkt, dass die Ausstellung bei den Besuchern und in der Presse ein sehr positives Echo gefunden hat. An diesem schönen Erfolg haben Sie durch Ihre Teilnahme maßgeblich mitgewirkt. Als Anerkennung für Ihre Mitarbeit überreichen wir Ihnen das beigefügte Buch und hoffen Ihnen damit eine kleine Freude zu bereiten. Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und für das kommende Jahr Gesundheit und Erfolg.« (Das Buchgeschenk ist ein prachtvoll illustrierter Werbeband »Krupp-Meilensteine der Firma«, worin allerdings die wesentlichen Geschäftserfolge ausgespart sind. Keine einzige Abbildung der Kaiser, Feldmarschälle, Großadmirale oder des Führers und nicht eine einzige von Krupp produzierte Waffe findet Erwähnung.)
»Durch meine Erfolge auf dieser Ausstellung«, sagt B., »entstand im Werk eine regelrechte Nachfrage nach Bildern von mir. Direktoren wollten welche von mir haben für ihre Empfangszimmer, und Sekretärinnen bestellten welche für ihre Abteilungen. Es kam dann so, dass ich die ganzen Bestellungen für die Firma zu Hause nicht mehr bewältigen konnte, obwohl ich schon wie am Fließband produzierte und Himmel, Berge und Almhütte nach Schablonen jeweils für sich einpinselte. Da ja die Firma meine Bilder sozusagen als Reklame gebrauchte, habe ich mir diese Arbeit mit auf meine Arbeit genommen. Wenn ich Nachtschicht hatte, habe ich in den Pausen gemalt und auch schon mal, wenn sonst nichts zu tun war. Als das der Werkschutzleiter gewahr wurde, hat er das zum Anlass genommen, mich endgültig fertigzumachen. ›Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps‹, hat er gesagt, er ließ mich vor sich antreten und hat mich vor der ganzen Mannschaft abgekanzelt. Lohnmäßig wurde ich vom Facharbeiter zum Hilfsarbeiter degradiert. Die Direktoren, die meine Bilder da hängen hatten und die ich wegen Hilfe anging, konnten oder wollten mir auch nicht helfen. Ich habe seitdem nichts mehr zu lachen gehabt beim Werkschutz, ich habe mich nur noch auf den letzten Tag gefreut.«
Die folgende Geschichte würde glaubhafter klingen, wenn sie sich im Mittelalter zugetragen hätte, zur Zeit der Hexenverfolgungen. Sie ist aber passiert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, genau vor 2 Jahren bei der Weltfirma Krupp in Essen.
Heinrich K., der die Geschichte erlebte, kann sie sich nur so erklären, dass bei ihm ein Krupp-Gesetz aus der Gründerzeit des Werks, obwohl längst überholt und nicht mehr in der alten Form gültig, zur Anwendung gelangte: »Wer trotzen will oder seine Pflicht weniger tut, wird bei Ertappen entlassen.«
Dabei hatte Heinrich K. seine »Pflicht« nicht verletzt, darüber hinaus glaubte er sich in einer gesicherteren Position als mancher Krupp-Direktor: er war aufgrund gesetzlicher Bestimmungen unkündbar.
Seinen unkündbaren »Pflichtplatz« als schwerbeschädigter Bote hatte er indirekt der Firma »Krupp« zu verdanken. 1942, als Soldat eingezogen und direkt an die Front versetzt, hatte er am 4. Tag bereits das große Glück – seine Kompanie wurde zusehends aufgerieben –, dass ihm seine Krupphandgranate durch Fehlzündung zu früh losging und seinen rechten Arm abriss. Damit war der Krieg für ihn zu Ende und sein späterer Pflichtplatz bei Krupp gesichert. Hätte er nicht das Glück mit dem weggesprengten Arm gehabt, so sieht es Heinrich K. heute, wäre er von Krupp nach dem Krieg nicht mehr eingestellt worden. Denn Heinrich K. galt im 3. Reich im Hause Krupp als Roter. Bei Haussuchungen, die die Gestapo bei ihm erfolglos durchführte, wurde er gefragt: »Haben Sie Schriften oder Waffen?« Selbst unter Folter konnte die Gestapo nichts aus ihm herauspressen, nicht zuletzt, weil er die Genossen selbst nur unter Tarnnamen und -adressen kannte. Allerdings seinem Schwager nützte sein Nichtswissen letztlich nichts. »Den haben sie vor mir geholt, der hatte Pech, den haben sie bis zur Unkenntlichkeit grün und blau geschlagen, der ist am nächsten Tag an einer zerquetschten Niere gestorben.«
K., einmal in Verdacht, kein nazitreuer Kruppianer zu sein, nützte seine Unabkömmlichkeitseinstufung als Spezialmechaniker für Flugwaffen nichts. »Die Firmenleitung ließ die Spreu vom Weizen scheiden.« K. war Spreu. »Alle, die nicht nazitreu waren, wurden freigestellt, obwohl es qualifizierte und gute Arbeiter waren. Die oben im Büro sagten: wir kennen unsere Vögelchen. Obwohl ich unabkömmlich war. Krupp hat mich freigestellt. An die Front.«
K., im doppelten Sinn krupp- und kriegsgeschädigt, erhält nach dem Krieg vom Arbeitsamt den Pflichtplatz bei Krupp in Essen zugewiesen. – Der Gesetzgeber hat der Großindustrie zur Auflage gemacht, einen bestimmten Prozentsatz Kriegs- und Schwerbeschädigte in unkündbare Stellung aufzunehmen. In der Regel sollen 6 % der Arbeitsplätze derartige Pflichtstellen sein. Krupp, als Waffenschmiede der Nation überdurchschnittlich an der Produktion von Kriegskrüppeln beteiligt, sieht sich nach Ausstoß auf den Markt nicht in der Lage, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Einmal drückt Krupp über Beziehungen zu den zuständigen Behörden die Pflichtplätze von 6 auf 4,3 % herunter, stellt in Wirklichkeit dann jedoch nur 3,3 bis 3,5 % dieser nicht voll einsatzfähigen Kriegs- und Arbeitsunfallopfer ein. Für jeden nichtbesetzten Pflichtplatz hat die Firma laut Gesetz 50 DM monatlich in einen Schwerbeschädigtenfonds einzubringen. 200000 DM wurden allein auf diese Weise in den letzten drei Jahren vorenthalten.
Heinrich K., armamputiert, mit steifem Rücken und stark sehbehindert, versieht seinen Dienst als Bürobote, eine Tätigkeit, die weit unter seinen intellektuellen Möglichkeiten liegt. Er leert Papierkörbe, trägt Akten von einer Abteilung zu anderen, legt Bestellungen – darunter auch wieder Rüstungsaufträge – den zuständigen Bearbeitern vor. Und er kann es – nach seiner Meinung gefragt – nicht lassen, auch seine wirkliche Meinung kundzutun und nicht, wie es einem Kruppianer anstünde, dazu noch in seiner unteren Untertanenstellung, die offizielle Meinung des Hauses nachzuplappern. Er sagt »DDR«, als es noch nicht die Politik des Hauses ist, mit Ostblockstaaten Geschäftsbeziehungen anzuknüpfen, und widerspricht, wenn Vorgesetzte von ihm erwarten, dass er kuscht. Obwohl er seine Arbeit gewissenhaft und regelmäßig macht, sucht man nach Vorwänden, ihn zu maßregeln. Sein Vorgesetzter verbietet ihm, seine erforderlichen Arztbesuche während der Arbeitszeit zu machen, und erst nach einigen Monaten wird ihm dieses Recht über den Betriebsrat ausdrücklich zugestanden. Heinrich K. erkennt: »Obwohl ja nach außen hin immer der Anschein erweckt wurde, dass die Firma Krupp so eine soziale Firma ist; ich habe immer andere Erfahrungen machen müssen. Meine Frau ist sehr kränklich. Sie sollte mehrmals in Kur, ich habe um Vorschüsse gebeten, die hat man mir immer rundweg abgelehnt.«
Heinrich K., der seine Meinung sagt, wie er sie aufgrund seiner Erfahrungen sagen zu müssen glaubt, ist bei seinen Vorgesetzten unbeliebt und ihnen wegen seiner Unkündbarkeit doppelt verhasst. Wie sehr man an ihm Anstoß nimmt, entnimmt er einer Äußerung seines Direktors: »Herr K., wir haben uns über Sie Gedanken gemacht. Geben Sie’s zu. Sie sind Kommunist.« In K.s Antwort, der sich nach dem Kriege außer in seinen Gedanken und Meinungsäußerungen nicht mehr politisch betätigt hat, muss der Direktor Aufruhr und Subversion gewittert haben, zumindest sieht er darin eine Provokation. »Leider nein«, antwortet ihm K., »es gibt ja keine Kommunisten mehr, seit sie verboten worden sind, aber ich bin ein konsequenter Sozialist.« Die Existenz von K. muss für die Hüter der Kruppdynastie eine ständige Bedrohung gewesen sein. Ein Betriebsratsmitglied heute zur damaligen Situation: »Die hätten ihm glatt ein Haus geschenkt, wenn er dafür seinen Mund nicht mehr aufgemacht oder die Firma verlassen hätte.« Diesen Gefallen tat K. ihnen nicht.
Dann passierte, was entweder ein willkommener Anlass für K.s Vorgesetzte gewesen sein muss oder sogar direkt von ihnen inszeniert wurde, um ihm, wenn ihm schon politisch nichts anzuhängen war, anders beizukommen.
K., der wegen seines Augenleidens eine dunkel getönte Brille trägt, wird in einer Abteilung, in der 16-jährige Mädchen beschäftigt sind, von einer Arbeiterin angesprochen: »Sagen Sie, Herr K., ist diese Brille, die Sie da immer tragen, so eine Röntgenbrille, mit der Sie durch unsere Kleider durchsehen können?«
K. geht auf den Scherz – dafür hält er es anfangs – ein. »Ja«, sagt er, »das kann ich damit.« Und als eine andere Arbeiterin den Beweis erbracht haben will und fragt, welche Farbe denn ihr Slip habe, rät K. zufällig die richtige Farbe. Gelächter der Umstehenden, und der aufsichtsführende Abteilungsleiter tritt hinzu. Zwei Stunden später erhält K. eine Vorladung zum Werkschutz. »Ich hatte die Sache bereits vergessen und wusste nicht, was die von mir wollten. Die benahmen sich sehr arrogant und machten ein regelrechtes Verhör. Ich hätte Unruhe hervorgerufen und den Betriebsfrieden gestört. Ob ich eine Brille hätte, wo man alles mit durchsehen könnte?!« Am nächsten Tag wurde das Verhör fortgesetzt. Unter Leitung des Werkschutzleiters Dr. Pütz. Ich hatte meine sämtlichen Brillen mitgebracht, und der Werkschutzleiter probierte sie der Reihe nach aus. Statt sich zu entschuldigen, behandelte er mich wie einen Sittenstrolch, und ich brachte zum Ausdruck, dass das Methoden seien, die mich an die Nazizeit erinnerten. Im Beisein des Betriebsrates kam er letztlich jedoch nicht daran vorbei zu erklären, dass alles ein Missverständnis gewesen sei und, falls es tatsächlich so eine Brille geben sollte, ich jedenfalls nicht im Besitz einer solchen sei.«
Heinrich K. glaubt sich rehabilitiert, jedoch dem ist nicht so. Eine Woche später wird ihm eine strenge Rüge zuteil, als Aktennotiz unwiderruflich in seinen Personalpapieren festgehalten und ihm per Einschreiben mit der Post nach Hause zugestellt. Unterschrieben vom Prokuristen Direktor Steck, mit dem Wortlaut, dass ihm aufgrund der ihm bekannten Vorkommnisse eine strenge Rüge dahingehend erteilt werden müsse, die ihm zur Auflage machte, dass er künftighin nicht mehr den Arbeiterinnen auf festgestellte Weise mit Blicken nachstelle; dass er sich dadurch in der Fa. Krupp erwiesenermaßen ›arbeitsfriedenstörend‹ verhalten und bei diesbezüglicher Wiederholung mit fristloser Kündigung zu rechnen habe.
Heinrich K. nahm kurz darauf ein Angebot der Krupp-Werke an, worin ihm unter Zusicherung der Weiterzahlung sozialer Sonderleistungen wie Weihnachtsgeld usw. die »Auflösung des Beschäftigtenverhältnisses« nahegelegt wurde. Er unterschrieb die vorgelegte Erklärung, wonach er »aufgrund der zwischen ihm und der Firma getroffenen besonderen Vereinbarung hin aus gesundheitlichen Gründen mit dem Ausscheiden aus den Krupp-Werken einverstanden« sei.
»Die von Alfried Krupp praktizierte Ausbeutung der Sklavenarbeiter[1] übertraf die in allen anderen Industriebetrieben, einschließlich der IG-Farben. Nirgendwo wurde ein derartiger Sadismus geübt, eine so sinnlose Barbarei, eine so schockierende Behandlung von Menschen als seelenloses Material. Alfrieds Macht war absolut und daher auch absolut korrumpierend …« (D.A. Sprecher, Jurist aus Washington, Teilnehmer des «Nürnberger Prozesses»)
»Dieses Alte, längst Vorhandene näher zu betrachten, ist der Mühe wert. Man kann die Gegenwart nicht verstehen, die Zukunft nicht abschätzen, wenn man nicht in die Vergangenheit greift.«
>(aus einer Jubiläumsschrift der Fa. Krupp 1961)
Ein ehemaliger höherer Krupp-Angestellter, jetzt Rentner und die letzten Jahre bei einer anderen Firma beschäftigt, erinnert sich nur ungern an eine Zeit, die dem Werk zu einmalig hohen Profiten verhalf, bisher jedoch keinen Einlass in die Jubiläumsschriften der Firma fand.
Es bedarf mehrerer Vorsprachen und Überredungsversuche, um den jetzt 66-jährigen ehemaligen Kruppianer zum Sprechen zu bringen. Er hat offensichtlich Angst, er könnte durch sein gutes Gedächtnis in erhebliche Schwierigkeiten kommen. Er verweist auf den Fall eines befreundeten ehemaligen Kollegen, der, wie er sagt, »zuviel gewusst« hat und zuerst hohe Geldzuwendungen erhielt und nachher, als er dennoch sein Wissen nicht für sich behalten konnte, um sein Leben fürchtete und heute in einer Art erzwungener Emigration im Ausland leben würde. Das sei nicht der einzige Fall dieser Art gewesen, behauptet der frühere Krupp-Angestellte. Einige der Zeugen, die es gewagt hätten, vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg ihren obersten Gebieter zu belasten, seien später, als Krupp sein Reich wieder übernahm, verschollen gewesen.
Sein Wissen habe er aus Erzählungen seines früheren Freundes und aus eigenem Erleben.
»Die ersten ausländischen Arbeiter«, berichtet der Augenzeuge, »wurden noch durchaus menschlich behandelt. Da lohnte es sich rein wirtschaftlich noch nicht, sie einer Sonderbehandlung zu unterziehen. 1942 änderte sich das, da gab es 10000 Slawen, und etwa die gleiche Anzahl war von Krupp noch ›nachbestellt‹ worden. Da lohnte es sich für Krupp, ihre Arbeitskraft optimal zu verwerten. Damit schon äußerlich klar ersichtlich war, dass ihnen das Äußerste abverlangt werden konnte und Rücksichtnahmen, die Menschen gegenüber in irgendeiner Weise meist immer noch bestehen, bei ihnen fallen gelassen werden sollten, wurde zuerst eine Sprachregelung von der Firmenleitung aus durchgeführt. An den Außenmauern der Krupp-Werkstätten wurden Schilder angebracht mit dem Hinweis: ›Slawen sind Sklaven.‹ In den Werksmitteilungen wurde ausdrücklich von ›Sklavenarbeitern‹ und von ›Sklavenmarkt‹ gesprochen, ansonsten von ›Judenmaterial‹. Im Hauptbüro war der gebräuchliche Ausdruck für die Zwangsverschleppten ›Stücke‹. Da wurde die Parole ausgegeben, die Fließbänder würden jetzt ›durch Judenmaterial verlängert‹. Da mit Vieh aus landwirtschaftlichem Nutzeffekt heraus wesentlich härter umgesprungen wird als mit Menschen, wurde für die Sklavenarbeiter ein Terminus aus diesem Bereich eingeführt. Das bei der Viehfütterung angewandte Wort ›Fressen‹ galt für sie. ›Ohne Arbeit kein Fressen‹ war oft das erste Wort, das die Deportierten von Krupp-Aufsehern hörten, wenn sie aus den Güterwagen in Essen herausgetrieben wurden, während man sie mit Tritten und Schlägen traktierte, auch Kranke und Kinder, damit sie von Anfang an merkten, dass es ernst gemeint war.
An die Neuankömmlinge wurden Holzschuhe verteilt und Decken mit dem Kruppzeichen, den drei ineinandergreifenden Ringen, sowie die Gefangenenuniform des Werkes, blau mit einem breiten gelben Streifen. Namen waren untersagt, ihre Unterscheidungsmerkmale waren Nummern, die mit weißem Faden auf die Anzüge aufgesteppt waren. Junge hübsche Jüdinnen wurden sehr häufig noch in einer besonderen Weise gekennzeichnet, um bei deutschen Arbeitern die sich leicht einstellende Sympathie jungen Mädchen gegenüber gar nicht erst aufkommen zu lassen. Wahrscheinlich mit aus diesem Grund wurde ihr Haar zu grotesken entstellenden Mustern geschoren. Überhaupt wurde vom Werkschutz neben Prügelstrafen und Essensentzug bis zum Verhungern als Strafmaßnahme das Haar in Form eines Kreuzes geschoren.
Die Sklavenarbeiter waren in Ruinen, in ungeheizten Schuppen, auf Schulspielplätzen und in Zelten untergebracht. Manche mussten auf dem Boden schlafen, oft ohne Schutz vor dem Regen. Die französischen Zwangsarbeiter waren z.B. in Hundehütten einquartiert, knapp 1 m hoch, 2½ m lang und 2 m breit; jede Hundehütte war mit 5 Mann belegt, um hineinzugelangen, mussten sie auf allen vieren kriechen. Andere waren in öffentlichen Bedürfnisanstalten und alten Backstuben untergebracht. Allein in Essen gab es 55 Arbeitslager von Krupp. Mit den Außenstellen in den Konzentrationslagern (u.a. in Auschwitz) hatte Krupp insgesamt an die 100000 Sklavenarbeiter für sich eingespannt.
Für ständig frischen Nachschub und schnellste Einfuhrwege des billigen ›Menschenmaterials‹ sorgte Krupp-Direktor Lehmann, der in fünf besetzten Ländern die Auswahl traf. Und wenn die ausgesuchten ›Stücke‹ sich nicht freiwillig in die Transporte einfügen wollten, wurden sie mit Handschellen nach Deutschland versandt.
In den Kruppwerken wurden 12- bis 14-jährige Kinder als volle Arbeitskräfte verwendet, und 1944 gab es sogar 6-jährige, die zur Arbeit gezwungen wurden. In allen Sklavenlagern bei Krupp war die Ernährung katastrophal. Zu einem Zeitpunkt, als es durch die eroberten Ernten in den besetzten Gebieten in Deutschland noch keine Lebensmittelknappheit gab, wurden die Krupp-Sklaven aus Sparmaßnahmen heraus auf Hungerration gesetzt. Die Krupp-Rationen für sie lagen noch weit unter den sonst in Deutschland festgelegten Sätzen für Zwangsarbeiter, die schon minimal genug waren.
Laut behördlichen Erlassen sollten zur Zwangsarbeit rekrutierte Russen und Polen mindestens 2156 Kalorien pro Tag bekommen und Schwerstarbeiter 2900. Krupp gehörte jedoch zu den wenigen Unternehmen, denen es der mit der SS abgeschlossene Vertrag erlaubte, die Verpflegung der Arbeitssklaven nach eigenem Dafürhalten zu regeln, sodass er durch Rationalisierung dieses kargen Fraßes selbst noch Gewinne einheimste. ›Hart wie Kruppstahl‹, nach diesem Prinzip wurden im Werk seit je Gewinne erzielt. Die Tagesration der Sklavenarbeiter bestand häufig nur aus der sogenannten ›Bunkersuppe‹, einer Wassersuppe aus Kohlblättern und einigen Scheibchen Steckrüben, einer Scheibe Brot mit Marmelade oder Margarine, alles in allem vielleicht an die 500 Kalorien, wenn es hochkommt. Viele der Sklaven-Kruppianer starben an Unterernährung, viele hatten durch Hunger aufgetriebene Bäuche und Hungerödeme. Die Krupp-Ärzte weigerten sich zuletzt aus Angst vor Ansteckung, die Menschenzwinger der Krupp-Sklaven überhaupt noch zu betreten. Alfried Krupp war der Gebieter über Leben und Tod. Er hatte mit den Nazibonzen ausgehandelt, sich Sklaven für 4 Mark je Kopf und Tag auszuleihen und noch 70 Pfg. für Essen einzubehalten, Umtauschrecht vorbehalten. Er hatte sich ausbedungen, schlechte, das bedeutete oft, bei ihm in kurzer Zeit verschlissene Ware zurückzugeben. Der entsprechende Passus dieser Handelsbeziehung lautete: ›Es gilt jedenfalls als vereinbart, dass für die Fabrikarbeit gänzlich ungeeignete Leute ausgetauscht werden können.‹ Es gab deutsche Arbeiter, die trotz Androhung harter Strafen das Risiko auf sich nahmen und den verhungerten Zwangsarbeitern heimlich etwas von ihrem Essen zusteckten. Aufseher einzelner Abteilungen, z.B. der Bürovorsteher der Lokomotivenfabrik, richteten Beschwerden an die Firmenleitung, dass diese extremen Rationalisierungsmaßnahmen der Essensrationen sich letztlich doch unrational auf die Produktivität der Sklavenarbeiter auswirkte, dass sie vor Entkräftung selbst durch Antreiben durch Lederknüppel, Peitschen und andere Schlagwaffen die erforderliche Arbeitsleistung nicht mehr brächten und beinah jeder Dritte ganz ausfiel. Da nützte es oft nichts, dass aus den Deportiertentransporten nur die Stabilsten und Jüngsten herausgesucht wurden.«
»Herr Hassel vom Werkschutz, der gleichfalls anwesend war, schaltete sich ein und sagte …, dass man es hier mit Bolschewisten zu tun habe, die besser Prügel statt Essen bekommen sollten.«
(Krupp’sche Aktennotiz über eine Besprechung über das Verpflegungswesen, Werkschutzleiter Hassel war einer von Alfrieds einflussreichsten Gefolgsleuten.)
»Die Tatsache, dass Klagen wegen unzulänglicher Verpflegung ausländischer Arbeiter häufig erhoben (wurden) … (ist) … mir wohl erinnerlich.«
(Alfried Krupp als Angeklagter vor dem Nürnberger Kriegsverbrecher-Tribunal.)
»Niemand weiß, wer die hinterhältig treffende Formel von der ›Ausrottung durch Arbeit‹ prägte, aber schon vier Wochen später trug Krupp die Sache dem Führer vor. Er sagte, jeder Parteigenosse sehe natürlich die Beseitigung von ›Juden, ausländischen Saboteuren, gegen den Nationalsozialismus eingestellten Deutschen, Zigeunern, Verbrechern und Asozialen‹ gern, doch sehe er nicht ein, warum diese nicht etwas fürs Vaterland leisten sollten, bevor sie umgebracht würden. Wenn man sie scharf antreibe, könne jeder von ihnen in den Monaten vor der Liquidierung die Arbeitsleistung eines ganzen Lebens erbringen … Die Lösung des Problems war, wie sich herausstellte, eine Frage der Wirtschaftlichkeit …«
(aus: William Manchester: »Krupp«)
»Wie die meisten Schreibtischtäter«, fährt der ehemalige Krupp-Angestellte fort, »wollte auch Alfried Krupp nach dem Zusammenbruch nichts mehr von der viehischen Behandlung seiner Sklavenarbeiter gewusst haben, er, der sich stets um alles kümmerte und nach typisch patriarchalischem Standpunkt fast alle wichtigen Entscheidungen selbst traf, wälzte nun die Verantwortung auf andere ab. Dabei wusste fast jedes noch so kleine Licht in Essen, wie im Hause Krupp mit den Zwangsarbeitern verfahren wurde. Jeden Morgen wurden z.B. die Jüdinnen in einem 6-km-Anmarsch in Scharen wie Vieh durch die Böcklerstraße an der Ecke Altendorferstraße zur Arbeit vorbeigetrieben. Dort residierte Alfried in seinem Büro. Dort marschierten im Winter die Arbeitskolonnen vorbei, 14-jährige ausgemergelte Mädchen darunter, mit Frostbeulen an Füßen und Händen, denen es verboten war, gegen die noch so eisige Kälte Handschuhe zu tragen, deren Schuhbekleidung ohne Strümpfe nur aus einer Holzsohle bestand, die sie sich mit abgerissenen Fetzen aus ihrer Schlafdecke umwickelt hatten.
Den Juden ging es am allerdreckigsten bei Krupp. Bei Fliegeralarm war es ihnen ausdrücklich verboten, Luftschutzkeller oder Schutzräume aufzusuchen, sie mussten bleiben, wo sie gerade waren.
Um allen klarzumachen, dass es sich bei Juden nicht um Menschen handelte, sondern um ›Tiere‹, auf die die für Menschen geschaffenen Gesetze nicht anwendbar seien, wurden den Jüdinnen die Benutzung der Toiletten in der Fabrik verboten. Sie mussten draußen im Hof, wo sie jeder sehen konnte, wie Tiere ihre Notdurft verrichten.«
Später vor dem »Internationalen Kriegsverbrecherprozess« in Nürnberg konnte Alfried Krupp folgerichtig erklären, dass er sich »keiner Verletzung der Menschenrechte bewusst« sei. Er hatte in seiner Art recht. Sklavenarbeiter waren keine Kruppianer. Und da sie keine Menschen waren, konnten bei ihnen auch keine Menschenrechte verletzt werden.
»Eine zweckmäßige Kontrollorganisation zur Sicherung der Rechte aller Fremdarbeiter zu schaffen, wurde von der Firmenleitung als Pflicht angesehen; sie wurde eingerichtet und hat gute Dienste geleistet. Um gerade die ausländischen Arbeiter wirksamer zu betreuen, waren alle für sie wirksamen Verwaltungszweige unter einer Oberlagerleitung zusammengefasst … Die Prüfer des ›Revisionsbüros‹ befassten sich laufend mit der Überwachung der für die ausländischen Arbeiter vorgeschriebenen Fürsorgemaßnahmen … Beanstandungen wurden ohne Rücksicht gemeldet und Fehler abgestellt. Die leitenden Angestellten und auch die Angeklagten selbst kümmerten sich immer wieder persönlich um die Verhältnisse in den Lagern, machten Essensproben und besichtigten die Unterkünfte. Die Betriebsordnung der Firma verpflichtete alle Vorgesetzten zu einer ›ruhigen und gerechten Behandlung der Gefolgschaftsmitglieder‹, zu denen selbstverständlich auch die Fremdarbeiter gerechnet wurden …
Die Gesamtheit dieser Einrichtungen zeigt, dass die ausländischen Arbeiter nicht rechtlos waren. Sie hatten vielmehr durchaus die Möglichkeit, den Mund aufzutun, wenn sie glaubten, Anlass zu Beschwerden zu haben.«
(Tilo Freiherr von Wilmowsky [Onkel von Alfried Krupp] in einer vom Hause Krupp in Auftrag gegebenen Rehabilitationsschrift »Warum wurde Krupp verurteilt? Legende und Justizirrtum«)
Die Krupp-Opfer hatten tatsächlich »die Möglichkeit, den Mund aufzutun«, allerdings konnten sie ihre Beschwerde dann nur in Form von Schreien vorbringen.
Besonders ausgebildete Krupp-Aufseher und -Aufseherinnen ließen den Krupp-Sklaven ihre »Fürsorgemaßnahmen« mit Peitschen und Knüppeln angedeihen. Im Lager Humboldtstraße gab es z.B. den Aufseher Rieck, der die »Betreuung« der Sklavenarbeiter zu einer Art Sport kultiviert hatte. Er trug Reitstiefel, hatte in einer Hand stets ein Stück Gummischlauch, in der anderen eine lange Lederpeitsche.
Seine Jüdinnen waren zwischen 14 und 25, eine war über 30. Als sie bei der Arbeit nicht mehr mit den andern mithalten konnte, peitschte sie Rieck systematisch zu Tode. Er hatte mit der Zeit eine einzigartige Fertigkeit entwickelt. Er brüstete sich vor den anderen Aufsehern damit, aus 2½ Meter Entfernung genau ins Auge treffen zu können. Er machte das bei seinen Jüdinnen mit Vorliebe. Einmal hatte er einer auf diese Weise die Augen ausgepeitscht, sodass sie blind wurde.
Auch Alfried Krupp selbst wurde als oberste Beschwerdeinstanz mit den Beschwerdeschreien seiner Opfer konfrontiert, obwohl er später vor Gericht angab, von allem nichts gewusst zu haben. Seine eigene Sekretärin hatte ein besseres Gedächtnis. Sie gab an, häufig durch allzulang anhaltende Beschwerdeschreie beim Diktat gestört worden zu sein.
Im Kellergeschoss von Alfrieds Hauptverwaltungsgebäude hatten Werkschutz und Werkschar ihr Hauptquartier. Hier war zur Sonderbehandlung von Sklavenarbeitern der »Käfig« errichtet worden. Ein fensterloses Stahlgehäuse mit einigen Trennwänden, jede Kammer 55 cm breit, 55 cm tief und 1,50 m hoch, so eng und niedrig, dass die dort Eingepferchten mit der Zeit vor Schmerzen fast wahnsinnig wurden. Zur Abwechslung wurden sie dann bei kaltem Wetter durch Luftlöcher von oben mit Wasser begossen und wurden so bis zu mehreren Tagen eingeschlossen. Für Schwangere eignete sich der »Käfig« vorzüglich. Sie wurden oft aus den geringsten Anlässen heraus, z.B., wenn sie morgens statt um 4.30 Uhr erst um 4.45 Uhr die Arbeit aufnahmen oder wenn sie bei der Arbeit vor Entkräftung einmal einschlafen sollten, dieser Sonderbehandlung unterzogen, manchmal Frauen darunter, die im 6. Monat und darüber waren. Dann blieb es ihnen meist erspart, ihre Kinder erst lebend zur Welt bringen zu müssen, da sonst in einem Krupp-Kinder-KZ die Vernichtung des unproduktiven Lebens besorgt worden wäre.
Das war eine besondere Einrichtung von Krupp, der vielleicht aus nichteingestandener religiöser Pietät heraus schwangere Slavenarbeiterinnen ihre Kinder erst mal austragen ließ, um sie dann im kruppeigenen Säuglings- und Kinderlager Buschmannshof langsam verhungern zu lassen. Januar 1943 beherbergte das Lager etwa 120 halb verhungerte Säuglinge und Klein-Kinder; keins dieser Kinder unter 2 Jahren überlebte.
»Dann ging Alfried Krupp ins Gefängnis; mit Haltung und mit Würde trat er, der Schuldlose, vor den Militärgerichtshof. Er verantwortete sich für das Haus Krupp, aber er verantwortete sich zugleich für Deutschland mit Rang und Noblesse. Dafür dankt Deutschland an diesem Sarg.« (Aus der Trauerrede des damaligen Bundestagspräsidenten Eugen Gerstenmaier.)
»Wer von uns wollte sich erkühnen, in die Geheimnisse eines solchen männlichen, verschlossenen, großen Lebens hineinzuschauen, sie zu entziffern. Wir stehen vor den Tatbeständen, dass in diesem Leben manches in die Dunkelheit der Geheimnisse der Fügung Gottes mit uns hineingetaucht ist. Aber wir wissen, gerade in dieser Tiefe erscheint ein Widerschein des Lichtes, jenes Lichtes, das aus Gott kommt; jenes Lichtes, das Jesus ans Licht gebracht hat.« (Aus der kirchlichen Traueransprache von Präses Beckmann.)
»In Antwort auf eine Frage, warum die Familie sich für Hitler erklärt hat, sagte ich: Wir Kruppianer sind keine Idealisten, sondern Realisten. Mein Vater war Diplomat. Wir hatten den Eindruck, dass Hitler uns eine gesunde Entwicklung bescheren würde. Tatsächlich hat er das getan … in diesem harten Kampf brauchten wir eine harte und starke Führung. Hitler gab uns beides. Nach den Jahren seiner Führung fühlten wir uns alle viel besser. Als ich über die antijüdische Politik der Nazis befragt wurde und was ich davon wusste, sagte ich, dass ich nichts von der Ausrottung der Juden gewusst habe, und weiterhin, dass, wenn man ein gutes Pferd kauft, muss man ein paar Mängel hinnehmen.« (Aussage von Alfried Krupp vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg. Schuldig gesprochen wegen Plünderung von Wirtschaftsgütern im besetzten Ausland; und Ausmerzung und Misshandlung breiter Massen ausländischer Zwangsarbeiter. Verurteilt zu 12 Jahren Haft; jedoch nach drei Jahren – im Zuge der Wiederaufrüstungspolitik – entlassen.)
Thurn und Taxis
Bernt Engelmann
Deutschlands reichster Junggeselle: Johannes von Thurn und Taxis
Der mit Abstand reichste Junggeselle der Bundesrepublik wohnt – wie könnte es anders sein? – in einem pompösen Schloss. Das riesige, von ausgedehnten Parkanlagen umgebene Gebäude liegt im Herzen einer süddeutschen Großstadt, nämlich mitten in Regensburg, und enthält ganze Fluchten von prächtigen Sälen voller Antiquitäten und Gemälden alter Meister. Doch die meisten Räume des alten Schlosses dienen nur gelegentlicher, dann allerdings sehr aufwendiger, nach altspanischem Hofzeremoniell verlaufender Repräsentation. Für seinen junggeselligen Alltag hat sich der Schlossherr in einem der Seitenflügel eine vergleichsweise kleine und bescheidene Wohnung eingerichtet, in deren Vestibül ein Springbrunnen plätschert und wo ihn seine Hampels aufs Vortrefflichste umhegen.
Der Hampel-Mann waltet, vorbildlich ergeben und umsichtig, als des ledigen Krösus persönlicher Kammerdiener und Haushofmeister; die Hampel-Frau versieht das Amt einer Wäschebeschließerin, leitet den Einsatz der Putzerinnen und komponiert als vortreffliche Köchin jene erlesenen Menüs, für die die Tafel ihres Herrn berühmt ist, denn Durchlaucht – so wird er angeredet – lieben gut zu speisen. Sein voller Name lautet übrigens: Erbprinz Johannes Baptista de Jesus Maria Louis Miguel Friedrich Bonifazius Lamoral von Thurn und Taxis.