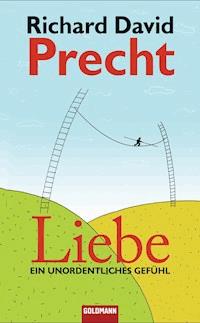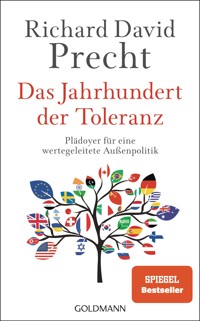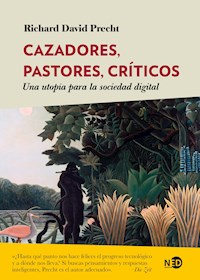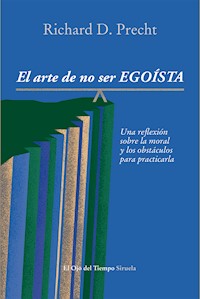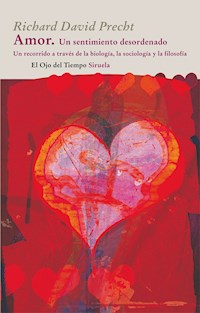2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In den letzten Jahren hat sich Richard David Precht immer auch zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen geäußert und in wichtigen Debatten Stellung bezogen. Sein Interesse gilt dabei über den konkreten Anlass hinaus stets auch übergeordneten Fragen wie u.a. und der Suche nach einer neuen Moral und der Frage nach der demokratischen Legitimation in modernen Gesellschaften. Das macht diese Beiträge über den tagesaktuellen Moment hinaus bedeutsam: In ihnen spiegeln sich nicht nur gesellschaftspolitische Diskussionen der jüngsten Vergangenheit, sondern sie haben eine über diese hinausweisende grundsätzliche Relevanz. Das vorliegende e-book versammelt die wichtigsten dieser Essays und Betrachtungen von Richard David Precht. Abgerundet wird es darüber hinaus durch je ein zentrales Kapitel aus seinen drei großen Philosophiebestsellern. So ist dieser Reader zugleich eine spannende Einführung in die Gedankenwelt Richard David Prechts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Richard David Precht
Immer mehr ist immer weniger
Gedanken zur Zeit
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright © dieser Ausgabe 2011by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenSatz: Uhl+Massopust, AalenISBN 978-3-641-07903-1V003
www.goldmann-verlag.de
Über dieses Buch
Richard David Precht, Philosoph, Publizist und Autor, ist einer der wichtigsten Intellektuellen Deutschlands und ein gefragter Gast in politischen Talkshows. Als Honorarprofessor lehrt er Philosophie an der Leuphana-Universität Lüneburg. Mit seinen philosophischen und kulturgeschichtlichen Sachbüchern »Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?«, »Liebe. Ein unordentliches Gefühl« und »Die Kunst, kein Egoist zu sein« wurde er zu einem der meistgelesenen Autoren unserer Zeit.
In den letzten Jahren hat sich Richard David Precht immer auch zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Fragen geäußert und in wichtigen Debatten Stellung bezogen. Sein Interesse gilt dabei über den konkreten Anlass hinaus stets auch übergeordneten Fragen wie u.a. der Suche nach einer neuen Moral und der Frage nach der demokratischen Legitimation in modernen Gesellschaften. Das macht diese Beiträge über den tagesaktuellen Moment hinaus bedeutsam: In ihnen spiegeln sich nicht nur gesellschaftspolitische Diskussionen der jüngsten Vergangenheit, sondern sie haben eine über diese hinausweisende grundsätzliche Relevanz. Das vorliegende E-Book versammelt die wichtigsten dieser Essays und Betrachtungen von Richard David Precht. Abgerundet wird es darüber hinaus durch je ein zentrales Kapitel aus seinen drei großen Philosophiebestsellern. So ist dieser Reader zugleich eine spannende Einführung in die Gedankenwelt Richard David Prechts.
Vom tierischen Mitgefühl
Können Affen zwischen Gut und Böse unterscheiden?Warum der Primatenforscher Frans de Waalmit seiner Moraltheorie überzeugt.
Am Anfang war der schnauzbärtige Mann nur einer von vielen in den wirren 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Menschenaffen waren in Mode. Die gelernte Sekretärin Jane Goodall berichtete Faszinierendes über die Schimpansen vom Gombe-Strom in Tansania. Die Ergotherapeutin Dian Fossey war bei den Gorillas in Ruanda. Und in den Menschenaffen-Forschungslabors an amerikanischen Hochschulen machte man Schimpansen und Bonobos von der menschlichen Psyche abhängig und maß ihr Sprachtalent am menschlichen Maßstab. Die Versuche waren unzumutbar, nicht nur für die Affen.
Frans de Waal war einer der Ersten, die merkten, dass es so nicht ging. Er untersuchte das Verhalten von Schimpansen nicht in der Menschenwelt, sondern beobachtete die Tiere im Umgang miteinander. Seit fast 20 Jahren ist der gebürtige Niederländer Professor für Psychologie in Atlanta. Er ist der renommierteste Primatologe der Welt. Seine Bücher sind eine publizistische Erfolgsgeschichte. Doch was hat er uns zu sagen?
Ziemlich wenig, sollte man meinen. De Waal hat eine unter sehr wenigen Theorien vom Ursprung der menschlichen Moral entwickelt, aber die Philosophen schweigen dazu. Sie stellen sich taub, auch wenn der Verhaltensforscher sich inzwischen unüberhörbar als Philosoph zu Wort meldet.
Umso bemerkenswerter ist die Auseinandersetzung, die der Primatologe im Winter 2003/2004 im Rahmen einer Vorlesungsreihe an der Universität Princeton mit hochrangigen Vertretern der Wissenschaft führte und die jetzt auf Deutsch vorliegt.* Sie bestätigt: De Waal hockt zwischen allen Lehrstühlen. So fremd er unter Moralphilosophen ist, so heimatlos erscheint er zugleich unter philosophierenden Biologen.
De Waals provozierende These hat ein freundliches Antlitz: Der Keim zum Guten im Menschen ist eine alte Geschichte aus dem Tierreich, entstanden aus der Geselligkeit. Konfliktlösung stand am Anfang, Mitgefühl und Fairness kamen später dazu. Vom sozialen zum moralischen Tier war es ein kleiner Schritt, oder besser: eine Abfolge von kleinen Schritten. Die Paviane und mehr noch die großen Menschenaffen zu verstehen bedeutet, die Wurzel unserer Moral zu entdecken: in Kooperation und Trösten, Dankbarkeit und Gemeinschaftssinn.
Wie eine Matroschka schichtet sich de Waals Modell der moralischen Evolution. Im Innersten versteckt ist der emotionale Reflex, ausgelöst durch das Verhalten anderer. Er findet sich nahezu überall bei höheren Tieren. In der Mitte liegt die Empathie, die Fähigkeit, die Emotionen eines anderen einzuschätzen, einschließlich seiner Gründe. Menschenaffen seien dazu in der Lage und Menschen. Die äußerste Schicht ist die Kunst, in vollem Umfang die Perspektive eines anderen einzunehmen. Nur sie ist exklusiv menschlich.
So weit, so nachvollziehbar – und so verfänglich. Denn so harmlos diese Idee erscheint, von zwei Fronten hagelt es Kritik. Gegner sind sowohl die Vernunftphilosophie, die nur den Menschen als moralisches Wesen gelten lassen will, wie auch die bis ins Mark amoralisch denkende evolutionäre Psychologie. Für Erstere ist de Waal ein »Naturalist«, für Letztere ein gefühlsduseliges Weichei.
Biologen mit einem positiven Menschenbild gibt es wenige. Der Humanist Charles Darwin war eher die Ausnahme als die Regel. Seit dem Siegeszug des »Darwinismus« im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ist es ein beliebter Sport unter den Psychologen der Evolution, alles Sympathische am Menschen schlechtzureden und zu eliminieren.
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war alles Kampf, Gemetzel und Auslese – die Folgen dieses Antihumanismus sind Geschichte, vom Ersten Weltkrieg bis zur nationalsozialistischen Ideologie. In ihrer zeitgenössischen Spielart ist die Evolution heute Globalkapitalismus. Und in den Lehrbüchern der evolutionären Psychologen geht es zu wie im Ökonomieseminar. Vom Kosten-Nutzen-Kalkül im Miteinander ist die Rede, von Investitionen in den Nachwuchs, von Risikostrategien bei der Partnerwahl. Kaum ein moderner Evolutionspsychologe, der nicht glaubt, was wir glauben sollen: dass ausgerechnet die Wirtschaft der Biologie die Spielregeln vorgibt.
De Waal dagegen ist ein großer Kapitalismuskritiker der Evolutionstheorie. Wahrscheinlich ihr wichtigster. Ein Humanist unter Raubtierwärtern, kennt der Niederländer keine egoistischen Gene und kein Prinzip Eigennutz als vermeintliche Motoren der menschlichen Evolution. »Der Mensch ist des Menschen Wolf?« – das beleidigt allenfalls die sozial vorbildlichen Wölfe. Dem miesen Menschenbild seiner Zunft setzt de Waal Mitleid, Einfühlung, Interesse und Selbstlosigkeit bei Menschen und Menschenaffen entgegen.
Worte wie diese provozieren die Biologen der Psyche. Seit hundert Jahren passen sie nicht mehr in den Zoo ihrer Begriffe. Man kann auch sagen: zu viel Seele, zu wenig Reflexe, zu viel netter Darwin, zu wenig unfreundlicher Darwinismus. Doch von de Waal lernen wir: Ohne »moralische Empfindungen«, die wir mit Menschenaffen teilen sollen, ist die menschliche Moral schlichtweg unerklärlich. Ohne Gefühle weiß auch unsere Vernunft nicht, was Gut und Böse ist.
Jede andere Erklärung der moralischen Natur des Menschen verwirft de Waal als »Fassadentheorie«. Wir sind keine moralisch lackierten Gartenzwerge.
Den Weg der Moral können wir an unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, zurückverfolgen. Wenn Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans so handeln, als wären sie gut, warum sollen sie es dann nicht auch sein?
Gibt es »gute« Affen? Die Moralphilosophen reagieren so aufgeschreckt, als legte der Niederländer ihnen unter dem Tisch die Hand ans Knie. Ist die Fähigkeit zum Guten nicht der von Kant formulierte exklusive Verfassungsauftrag des Menschseins? Sind wir nicht die Einzigen, die ein »Sollen« in uns spüren und nicht nur ein »Wollen«?
Philosophen müssen sich von Tieren fernhalten, zumindest theoretisch, das bedauerte schon Albert Schweitzer. Wie die Hausfrau, die ihren Fußboden gescheuert hat, darauf achtet, dass ihr der Hund nicht durch die gute Stube läuft, so achten die Philosophen darauf, dass ihnen keine Tiere in der Ethik herumlaufen. Sie meinen zu wissen, dass Tiere eines bestimmt nicht haben: Intentionen. Der philosophische Maßstab für die Moral lautet dann: Können Menschenaffen etwas mit Absicht tun? Und können sie diese Absicht reflektieren?
Das Unzeitgemäße an dieser Messlatte: Wir wissen, dass sie zu hoch hängt. Nicht mal beim Menschen können wir »Intentionen« wasserdicht beweisen. Das Fehlen von Beweisen ist noch lange kein Beweis für das Fehlen. Nicht ohne Witz ist auch, dass Hirnforscher, die unsere menschliche Willensfreiheit untersuchen, heute das Gleiche fragen: Können Menschen etwas mit Absicht tun? Mit einer Absicht auf der Grundlage freier Auswahl, versteht sich. Kann ich wollen, was ich will?
Die Situation ist bizarr. Während viele Hirnforscher die menschliche Vernunft in Affekte zerlegen wie ehedem die Behaviouristen die Tierseele, legen Philosophen noch immer den kantischen Maßstab für die menschliche Wertegemeinschaft an: Intentionalität, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung. Tatsächlich aber messen wir Menschenaffen gar nicht am alltäglichen Verhalten von Menschen, sondern an der Fähigkeit, Normen zu formulieren. Eine Fähigkeit, von der nur die wenigsten Zeitgenossen Gebrauch machen. Nicht Menschen sind der Maßstab für die Vernunft der Tiere, sondern Moralphilosophen!
Der Mensch, der keine biologische Sonderanfertigung mehr ist, soll eine moralische Sonderanfertigung bleiben. Von de Waal aber lernen wir: Selbst wenn es stimmt, dass die moralischen Fähigkeiten des Menschen einzigartig sind, so sind sie doch nicht einzig. Schimpansen »gut« sein zu lassen bedeutet nicht, die menschliche Sonderbegabung zu verleugnen.
»Kratz einen Altruisten, und du siehst einen Heuchler bluten!« lautete das sagenhafte Credo von Michael Ghiselin, dem Erfinder der »evolutionären Psychologie«. De Waals lange Erfahrung mit Menschenaffen macht ihn zu einem besseren Philosophen. Sie bewahrt ihn davor, uns als schlecht getarnte Bestien zu beschreiben und den Psychopathen als Normalfall. Die Moral ist keine freundliche Tünche auf unserer bösen Natur. Denn was sollte uns dieser widernatürlich alberne Anstrich? Der Schwarm von Piranhas, der freiwillig beschließt, vegetarisch zu werden, muss erst noch gefunden werden.
Nach de Waal ist der brutale Widerstreit zwischen unserer bösen animalischen Natur und dem zarten Anstrich der Zivilisation, der noch Sigmund Freuds Irrtümer beflügelte, eine Schimäre, eine bequeme Illusion abendländischen Denkens.
In der Tiefe unseres Herzens mögen wir vielleicht nicht unbedingt »gut« sein, aber in unserer tierischen Natur steckt etwas von der Seele der Zwergschimpansin Kuni im englischen Twycross-Zoo: Nachdem sie einen Vogel mit der Hand gefangen hatte, kletterte sie auf die Spitze des höchsten Baums, entfaltete die Flügel des Vogels und warf ihn in die Luft. Die Schimpansin konnte nicht fliegen, wie sollte sie wissen können, was Fliegen ist? Trotzdem versuchte sie, dem Vogel eine neue Chance zu geben, beschwingt von einer ganz natürlichen Regung: Mitgefühl.
*Frans de Waal: »Primaten und Philosophen. Wie die Evolution die Moral hervorbrachte«. Carl Hanser Verlag, München; 224 Seiten; 19,90 Euro.
Über Tierversuche
An Affen dürfen wir nur Experimente durchführen,die wir auch mit Menschen machen würden.
In meiner Schulzeit standen sie sich spöttisch gegenüber: die Physik-, Chemie- und Biologielehrer auf der einen Seite und die Kollegen aus den sogenannten Geisteswissenschaften auf der anderen. Vielleicht, weil die Naturwissenschaftler ahnten, dass man den Geist eines Tages in seine materiellen Bestandteile zerlegen und ordentlich verpackt ihnen überstellen würde. Von Nüchternheit beseelt, spotteten sie über die Blumenwiese aus Orchideen- und Laberfächern. Gemeint waren Fächer wie Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, die Übungsplätze unserer Kultur, unserer Werte und Leitvorstellungen.
Historisch gesehen waren meine Lehrer die Erben zweier verschiedener Traditionen: des Szientismus der modernen Naturwissenschaften und des christlich-abendländischen Humanismus. Und da sie in der gesellschaftlichen Wirklichkeit außerhalb von Lehrerzimmern nur selten aufeinandertreffen, gibt es sie bis heute.
Umso heftiger ertönt das Geschrei, wenn sich eine Konfrontation nicht vermeiden lässt. Wie in Bremen. Dort forscht der Neurobiologe Andreas Kreiter mit Makaken. Er pflanzt ihnen Elektroden ins Gehirn. Ein ganz normaler Vorgang, nicht nur für Kreiter, sondern auch für die Bremer Universität, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Das Tierschutzgesetz verbietet solche Affenversuche nicht. Es verliert ohnehin kein Wort über Affen. Aus Sicht des Gesetzgebers ist der Graben zwischen Schimpanse und Mensch tiefer als der zwischen Schimpanse und Huhn.
Für Menschen gibt es bürgerliche Rechte und Pflichten, für die anderen nur ein Schutzgesetz.
Biologisch begründet ist das nicht. Genetisch stehen sich Menschen und Affen sehr viel näher als Affen und Hühner. Die strenge moralische Trennung zwischen Affen und Menschen stammt aus einer unwissenschaftlichen Zeit. Aus der Theologie des Thomas von Aquin zum Beispiel, der beide nach einem sicheren Kriterium voneinander schied: nach der Sterblichkeit und der Unsterblichkeit ihrer Seelen. Noch vor 100 Jahren galten unsere haarigen Verwandten als läppisch, frech, geil, minderwertig und brutal. Bis die Naturwissenschaft sich der Sache annahm. Man untersuchte Intelligenz, Verhalten und Psyche. Im Jahr 1921 schrieb der Berliner Psychologe Wolfgang Köhler auf der Anthropoidenstation in Teneriffa eine erste Psychologie des Schimpansen.
Verhaltensforscher, Genetiker und Neurobiologen zeigen heute ein beeindruckend komplexes Bild der nichtmenschlichen Primaten. Affen sind faszinierend soziale Wesen. Sie kennen Hilfsbereitschaft, Fürsorge und Gemeinschaftsgeist. Ihre Psyche ist sensibel und kompliziert. Sie empfinden Zuneigung, Trauer und psychischen Schmerz.
Affen biologisch ernst zu nehmen bedeutet, sie nicht schlicht als Tiere zu sehen, sondern als psychisch sensible Verwandte. Umso erstaunlicher mutet es an, dass Gerhard Heldmaier, der Vorsitzende der Senatskommission für tierexperimentelle Forschung bei der DFG, keine ethischen Bedenken bei den Bremer Versuchen sieht. Heldmaier ist Tierphysiologe, kein Tierpsychologe. Er verweist auf die 2,7 Millionen anderen Versuchstiere, die in deutschen Labors benutzt und getötet werden.
Die Logik dahinter ist schlicht: Weil wir mit Mäusen experimentieren, dürfen wir das auch mit Affen. Das Gegenargument ist leicht zu benennen: Wir dürfen es nicht, weil Affen eben keine Rinder oder Hühner sind, selbst wenn der Begriff »Tiere« sie unsauber zusammenbindet. Man müsste sich des Ernstes halber einmal vorstellen, dass Kenner der Affenpsychologie wie Jane Goodall oder Frans de Waal in der Kommission der DFG säßen. Was würden sie von den Experimenten halten?
Das wichtigste Argument, das Kreiter gegen seine Kritiker kennt, ist: Das Einpflanzen der Elektroden tut den Tieren nicht weh. Worin also soll das Verwerfliche bestehen? Nun, vielleicht darin, dass »die messbare Seite der Welt nicht die Welt ist. Sie ist die messbare Seite der Welt«, wie der Frankfurter Philosoph Martin Seel schreibt. Wo bleiben die psychischen Schädigungen der Tiere? Schäden durch die Käfighaltung, durch Angst und Traumatisierung? Ein Hirnforscher, der den mutmaßlichen Schaden seiner Affen nur am physiologischen Schmerzempfinden misst, geht auf verblüffende Weise unter sein Niveau.
Erklären kann man dies nur moralpsychologisch: durch ein Denken, das zwei Dinge so im Gehirn speichert, dass sie dort nicht zusammentreffen. Die Erkenntnisse der Wissenschaft über die Psyche von Affen einerseits und ihre »Benutzung« für die eigenen Experimente andererseits.
Für Frans de Waal gibt es für Versuche an unseren nächsten Verwandten nur ein Kriterium: »Die Art von Untersuchungen, die wir auch an menschlichen Freiwilligen vornehmen würden.« Immerhin gibt es in Deutschland seit 1991 keine invasiven Experimente mit Menschenaffen mehr. Das szientistische und das humanistische Weltbild haben sich hier erfreulicherweise vereint. Und auch die Lösung der Bremer Probleme dämmert schon am Horizont. Sie wird durch neue Generationen von Kernspintomografen und durch Computersimulationen kommen, die Kreiters Grundlagenforschung ersetzen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Forschungen, die heute noch als »Zukunft« gerechtfertigt werden, sind schon bald Geschichte.
Verliebt in die Liebe?
Warum wir immer mehr Liebe suchen und immer weniger finden
Die Kunst, verheiratet zu leben, definiert eine Beziehung, die dual in ihrer Form, universal in ihrem Wert und spezifisch in ihrer Intensität und in ihrer Kraft ist.
Michel Foucault
Ehen werden im Himmel gestiftet und auf Autositzen geschieden.
Niklas Luhmann
Als meine Großeltern heirateten, hatten sie keine Wahl. Ihre Väter arbeiteten bei der Bahn. Sie verabredeten sich. Mariechen und Willi, fünf Jahre Altersunterschied, das passte. Es hielt zusammen, mehr als 50 Jahre; gepasst hatte es nie. Meine Großeltern hatten es sich nicht ausgesucht. Sie suchten sich ja ohnehin nichts selbst aus: ihre Liebe, ihren Beruf, ihren Wohnort, ihren Arzt, ihren Glauben, ihren Lifestyle, ihren Telefonanbieter, ihre Community, ihre Peergroup nicht und auch keinen Therapeuten. Die Kirche blieb im Dorf, die Ansprüche waren gering. Meine Großeltern machten alle vier Jahre ein Kreuz auf dem Wahlzettel mit einer Pause zwischen 1933 und 1949. Sie kannten Deutschland und Österreich, und die einzige große Reise meines Opas war der Krieg. Ob er nach Polen wollte, wurde er nie gefragt.
Als meine Eltern heirateten, durften sie wählen. Sie kannten das Leben, aber nur ein bisschen. Sie heirateten früh, meine Mutter war 22. Das war Ende der 1950er Jahre. Mein Vater brauchte nicht zum Militär, weil es ausnahmsweise keines gab. Dafür konnte er studieren und wurde Designer, was in Deutschland sehr neu war. Das Land wurde reicher und reicher. Die 60er Jahre kamen, und Oswald Kolle klärte die Republik auf. Aus dem Pflichtfach Sex wurden Kür und Wahl. Meine Eltern reisten durch Westeuropa bis nach Marokko, flogen nach Südkorea und Vietnam. Sie versuchten ein alternatives Leben und trennten sich von den Werten ihrer Eltern. Sie traten aus der Kirche aus, kauften ein Eigenheim am Stadtrand, kamen in die Midlife-Crisis, erhielten eine Satellitenantenne für ein zusätzliches drittes Fernsehprogramm und eine Fernbedienung.
Als ich Abitur machte, gab es in Deutschland die ersten Videorekorder. Das war 1984. Telefone hatten noch eine Schnur und gehörten der Post. Das Land wurde immer noch reicher. Aber es gab eine Lehrlingsschwemme und schlechte Berufsaussichten auch für Studierte. Ich konnte meinen Studienort frei wählen und bald auch zwischen zehn Fernsehprogrammen. Ich konnte reisen, wohin ich wollte, nach 1990 sogar in den Osten. Ich musste lernen, einen Computer zu bedienen. Ich konnte mir meine Liebe aussuchen, meinen Beruf, meinen Arzt, meinen Glauben, meinen Lifestyle, meinen Telefonanbieter, meine Community, meine Peergroup und, wenn ich gewollt hätte, meinen Therapeuten. Ich war frei und bekam meine ersten grauen Haare. Der Schutzfaktor der Sonnenmilch hat sich verzehnfacht, die Klimakatastrophe ist Gewissheit geworden. In Zeitungen und Büchern kann man lesen, dass der Öko-Crash nicht mehr aufzuhalten ist. Im Fernsehen werden uns Überbevölkerung, Migration und die Kriege um die natürlichen Ressourcen vor Augen geführt. In unserer realen Lebenswelt aber merkt man nichts davon. Die Menschen sehnen sich noch immer nach mehr: nach einem Maximum an Liebe und Sex, an Glück, an Gesundheit. Sie wollen prominent sein, schlank und niemals alt.
Wir leben keine Normalbiografien mehr wie unsere Großeltern, wir haben Wahlbiografien, oder genauer »Bastelbiografien«. Wir wählen aus einem immer größeren Sortiment an Lebensmöglichkeiten, und wir müssen wählen. Wir sind gezwungen, uns selbst zu verwirklichen, weil wir ohne diese »Selbstverwirklichung« augenscheinlich gar nichts sind. Und uns verwirklichen heißt nichts anderes als auswählen aus Möglichkeiten. Wer keine Wahl hat, kann sich gar nicht selbst verwirklichen. Wer sich dagegen verwirklichen muss, kann auf die Wahl nicht verzichten. Und die wundervolle Chance »Sei du selbst!« ist zugleich eine finstere Drohung. Was ist, wenn mir das nicht gelingt?
Auch in der Liebe erwarten wir heute so viel wie möglich – wir sind es uns wert. In unseren Beziehungen suchen wir vielleicht noch immer einen sozialen Halt. Mehr noch aber suchen wir eine Idealmöglichkeit zur Selbstverwirklichung – in der romantischen Liebe.
Romantik ist die Idee, das flüchtige Gespenst der Verliebtheit in den Rahmen der Liebe zu stecken und ihm in einem selbst gemalten Porträt ein ewiges Antlitz zu geben. Diese Vorstellung ist nicht neu. Vermutlich gab es sie in ähnlicher Form bei den alten Griechen sowie in der Renaissance und – zumindest als Idee – auch in der höfischen Kultur des Mittelalters. Diese Idee wurde, wie gesagt, nicht kontinuierlich freigesetzt, und selbst unsere Großeltern wussten nur selten davon. Kein Zweifel aber besteht daran, dass sie heute eine weitverbreitete Vorstellung in den Wohlstandsstaaten zumindest der westlichen Welt ist und dass sie auch in vielen anderen Ländern vorkommt. Das Einzigartige dabei ist ihr Massencharakter. Was auch immer Romantik in der Vorstellungswelt früherer Zeiten gewesen sein mag, unter keinen Umständen war sie etwas, was fürs Volk gedacht war. Romantik war keine realistische Erwartung von Normalsterblichen. Sie war die künstlerische Phantasie einer Oberschicht, eine Passion von Privilegierten.
Heute dagegen ist Romantik ein allgegenwärtiger Anspruch. Wer von geschlechtlicher Liebe redet, der redet in allen Bevölkerungsschichten von Leidenschaft und Verständnis, Aufregung und Geborgenheit. Und sei es auch nur, dass er das Fehlen des einen oder des anderen bei seinem Liebespartner seufzend bemängelt. Unsere Gesellschaft verfügt nicht nur über einen historisch beispiellosen Wohlstand und ein ebenso einzigartiges Bildungsniveau. Sie setzt auch einen beispiellosen Anspruch auf Glück und Wahl ins Recht. Und sie überbrückt dabei Räume und Zeit durch Autos, Züge, Flugzeuge, Internet und Mobiltelefon.
Selbst wenn der Wohlstand nicht gleichmäßig verteilt ist und die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird, und selbst wenn im Hinblick auf unsere Unterschicht von einer »Bildungskatastrophe« die Rede ist, so ist zumindest der Anspruch auf Glück, auch in der Liebe, fast überall vorhanden. Dieser Anspruch mag sich auch heute noch unterscheiden. In den Glitzermetropolen der Sex and the City-Kultur ist er vermutlich ein anderer als in den ländlichen Regionen Frieslands und der Oberpfalz mit ihren Bauer sucht Frau