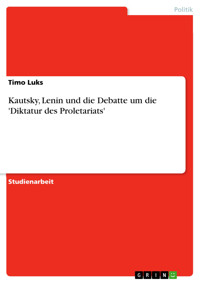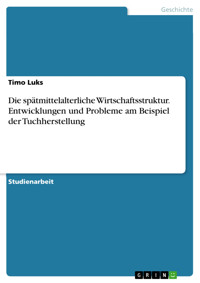31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der moderne Mensch ist Arbeitsuchender. Um sich auf Arbeitsmärkten gegen Konkurrenz durchzusetzen, bedarf es bestimmter Fähigkeiten. So wird die Bewerbung im 19. Jahrhundert zu einer zentralen Kulturtechnik in modernen Arbeitsgesellschaften: Sie entstand aus der älteren Tradition der Bittschriften und wurde im Lauf der Zeit zu einem Werbeprospekt in eigener Sache. Wo Bewerberinnen und Bewerber sich einst veranlasst sahen, Anstellungsgesuche mit ausufernden Erzählungen persönlicher Schicksale zu begründen, da rückten spätere Bewerberinnen und Bewerber ihre Eignungen und Qualifikationen in den Vordergrund, veranschaulicht in ausbildungsbezogenen Lebensläufen. Der Historiker Timo Luks erzählt nun erstmals die Geschichte der Bewerbung vom späten 18. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert. Eine Geschichte, die auch von den Veränderungen sozialer Beziehungen erzählt. Sein Buch, anschaulich und elegant geschrieben, ist reich an Beispielen und gibt dabei vor allem Aufschluss über die Funktionsweise des Arbeitsmarkts: nicht als abstrakte, makroökonomische Realität, sondern als Bezugspunkt des täglichen Ringens um ein Auskommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Timo Luks
In eigener Sache
Eine Kulturgeschichte der Bewerbung
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2022 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-478-7
E-Book Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde
© 2022 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-366-7
eISBN 978-3-86854-481-7
Umschlaggestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Umschlagabbildung: Jacob Grimm: Bewerbung um eine Stelle in der Landesbibliothek Kassel, 10. 8. 1815, Universitätsbibliothek Kassel, 4° Ms. hist. litt. 45[44
Inhalt
IEinleitung
Vorlagen und Erzählungen
Leistung und Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
Empfehlungen und Patronage
Eine Bestimmung für die Zukunft
IIDer Begriff der Bewerbung
IIIDie Welt in Ratgebern
Ausführliche und gründliche Anleitung zum Briefeschreiben
Das lange Leben der Universalbriefsteller
Neue Ratgeber
Zwischenstück: Prominente Bibliothekare
IVBewerbungskultur um 1800
Handwerker auf der Suche
Verabschiedete Soldaten
Treue Diener
Die Qualifizierten
Zwischenstück: Väter und Söhne
VKameralisten im Königreich Württemberg
Kameralwissenschaftlich Beflissene und Doctores beider Rechte
»Justiz- oder Cameral-Stellen in den neuerdings acquirierten Königlichen Landen«
Zwischenstück: Eine Stelle bei des Groß- und Erbprinzen Hoheit
VIÜbergänge
Verwaltungsprofis zwischen Qualifikationsnachweis, Bewerbung und Beförderung
Güterverwaltung und Marktregulierung: Handelsleute in städtischen Diensten
Zwischenstück: Ungute Verfahrensdynamik
VIIBewerberinnen
VIIIBewerbungskultur der Jahrhundertmitte
Die Beharrlichkeit der Erfolglosen: Mehrfachbewerbungen und Lerneffekte
Kurze Bildungsromane: Nürnberg sucht einen Rechnungsrevisor
Gutachten und Bewerberverzeichnisse: Aufseher im Arbeitshaus
Hörensagen, Ausschreibungen und »Brauchbarkeit«: Bewerbungen im Polizeidienst
Die Stunde, »in welcher mich Jesus Christus in seinen geistl. Weinberg rufen will«
Bekehrung und Berufung: Missionare als unwahrscheinliche Bewerber
Zwischenstück: Die Gesandtschaft vermittelt keine Anstellungen
IXBewerbungskultur um 1900
Die Bewerbung als Problem des Bewerbers
Die Papiere zusammentragen
Noch einmal: Aufseher im Arbeitshaus
Wege in die Fabrik
Stenotypisten und andere Frauen
»Über meine sonstige äußere Erscheinung gibt die beigefügte Photographie Auskunft«
XAusblick
Archive
Gedruckte Quellen
Literatur
Zum Autor
Ich erlaube mir dazu die Motive vorzutragen, die mir Hoffnung geben, nicht als ein arroganter Bewerber zu erscheinen.
Johann Wilhelm Link, an Magistrat Nürnberg, 4. 6. 1842; Stadtarchiv Nürnberg C 7/I 167
Sehr geehrter Herr!
Ich bin vollkommen überzeugt, daß Sie allen Anforderungen für den von Ihnen angestrebten Posten durchaus entsprechen. Sowohl Ihren Kenntnissen nach als bezüglich Ihres Charakters besitzen Sie die volle Eignung, um ihn zur Zufriedenheit der Vorgesetzten auszufüllen.
Wenn ich trotzdem nicht in der Lage bin, Ihr Gesuch zu unterstützen, so liegt die Ursache weder an Ihnen, noch an meinem Willen, Ihnen behilflich zu sein. Es ist mir aber aus sicherer Quelle die Nachricht zugekommen, daß sich um die Stelle gleichzeitig ein Mann bewirbt, der ebenfalls vollkommen entspricht, aber eine längere, vielfach belobte Militär-Dienstzeit hinter sich hat. Wenn ich es auch über mich brächte, einen so verdienstvollen Bewerber verdrängen zu wollen, so wären doch solche Bemühungen höchst wahrscheinlich ganz vergebens und Sie werden gewiß damit einverstanden sein, wenn ich voraussichtlich vergebliche Schritte zu Ihren Gunsten unterlasse. Bei Ihren Eigenschaften kann Ihnen ja eine entsprechende Anstellung nicht entgehen und es wird stets bereit sein, Sie dabei zu unterstützen Ihr dienstwilliger R. R.
Gaal, Georg von: Allgemeiner deutscher Muster-Briefsteller, Leipzig und Wien 1917, S. 166
IEinleitung
Es ist, frei nach Jane Austen, eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass jemand ohne den Besitz eines schönen Vermögens sich nichts mehr wünschen muss als eine Anstellung. Der moderne Mensch jedenfalls ist Arbeitsuchender: willens und auch in der Lage, sich mittels eigenverantwortlicher und selbsttätiger Positionierung auf dem Arbeitsmarkt ein Ein- und Auskommen zu sichern. Auch wenn dieser Arbeitsmarkt stets in zahlreiche Teilarbeitsmärkte zerfällt und je nach Standort anders aussehen kann, so ist er doch eine der wirkmächtigsten Realitäten, an denen Menschen seit zweieinhalb Jahrhunderten ihr Leben ausrichten. Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspolitik nehmen den Arbeitsmarkt in der Regel als hoch aggregiertes Abstraktum wahr. In der Perspektive des Einzelnen erscheint er jedoch als Ansammlung sehr konkreter Zumutungen. Einerseits muss dieser Arbeitsmarkt politisch, rechtlich, sozial und kulturell gehegt und gepflegt werden. Andererseits müssen sich tendenziell alle seinen Anforderungen unterwerfen. Wer seinen Lebensunterhalt nicht durch unternehmerische Tätigkeit bestreitet oder von einem (ererbten) Vermögen leben kann, ist darauf angewiesen, sich eine Anstellung zu suchen. Diese Stellensuche ist in modernen Gesellschaften über den Arbeitsmarkt vermittelt. Um den Lebensunterhalt zu sichern, muss man sich auf die Regeln eines Spiels einlassen, in dem Mitspielende immer Gegenspielende sind. Man muss sich um eine Anstellung bewerben, und zwar so lange, bis eine dieser Bewerbungen Erfolg hat. Erfolg meint hier: Jemanden davon überzeugen, dass man selbst besser (geeignet) ist als andere. Ohne Bewerbungskompetenz bleibt der moderne Arbeitsuchende ein Mängelwesen. Um das zu vermeiden, stehen unzählige Ratgeber und Beratungsangebote zur Verfügung, die inzwischen zu einer profitablen »Übergangsindustrie« angewachsen sind. »Heutzutage«, so stellte die Journalistin Barbara Ehrenreich bereits 2006 fest, »reicht es nicht mehr, die Stellenanzeigen eingehend zu studieren und Bewerbungsunterlagen zu versenden, um dann auf Anrufe zu warten. Die Stellensuche ist zu einer so komplexen Technik, wenn nicht gar Wissenschaft geworden, dass kein Arbeitsloser diese Aufgabe noch allein bewältigen kann.«1 Feststellungen, dass etwas heutzutage eine bisher kaum gekannte Bedeutung annimmt, stellen für Historikerinnen und Historiker in der Regel eine produktive Provokation dar. Historiografische Aufklärung zielt allerdings nur selten darauf, einem gegenwartsbezogenen Sonderbewusstsein zu schmeicheln – auch wenn natürlich heute alles anders ist, weil es das früher eben auch war. Stattdessen geht es darum, die Genese und Transformation bestimmter Praktiken und eines bestimmten Wissens zu rekonstruieren und in Beziehung zur Gegenwart zu setzen. Historisierung bedeutet in diesem Sinn immer auch Distanzierung und Relativierung.
Die Anforderung, Bereitschaft, Erwartung, Fähigkeit, Notwendigkeit und Zumutung sich zu bewerben, ist eine längst nicht mehr wegzudenkende Selbstverständlichkeit. Bei der Bewerbung handelt es sich um eine grundlegende Kulturtechnik moderner Gesellschaften. In der Medienwissenschaft (dem akademischen Heimathafen des Konzepts) gelten Kulturtechniken als Ensemble von Kenntnissen und Fertigkeiten, »die es Mitgliedern eines bestimmten Kulturkreises ermöglichen, diese spezifische Kultur zu praktizieren und damit auf Dauer zu stellen«.2 Es geht um jene Praktiken, aus denen die Apparate, Instrumente und Artefakte von Kultur überhaupt erst hervorgehen. Gemeint sind damit sowohl Körpertechniken, also Formen körperlichen Könnens, als auch Medientechniken wie Lesen, Schreiben oder Rechnen. Eine Kulturtechnik verschränkt Wissensbestände, körperliche Gesten und technische Hilfsmittel. Zudem etablieren Kulturtechniken je spezifische Selbstverhältnisse. Es handelt sich um Techniken der Selbstreflektion, Selbstbeschreibung und Identitätsbildung.3 Die Bewerbung kann in diesem Sinn zweifellos als Kulturtechnik der modernen Arbeitsgesellschaft gelten. Sie macht Menschen zu Bewerberinnen und Bewerbern, indem sie sie auf bestimmte Indikatoren reduziert, das heißt bestimmte Aspekte eines Lebens betont und andere ignoriert. Das Leben wird dabei zum Lebenslauf, orientiert primär am Modell einer Karriere, womit nicht zwingend ein Aufstieg gemeint sein muss, sondern zunächst einmal lediglich eine Abfolge von Beschäftigungsverhältnissen.
Trotz ihrer Bedeutung wurde der Entstehung und Etablierung der Kulturtechnik der Bewerbung bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Bewerbungsschreiben finden in geschichtswissenschaftlichen Arbeiten zwar sporadisch Verwendung als Quellen. Sie werden dabei aber nie selbst zum Gegenstand der Untersuchung gemacht, sondern mit Blick auf andere Fragestellungen ausgewertet, etwa als Bestandteil von Schriftkultur und behördlicher beziehungsweise unternehmerischer Kommunikation.4 In Studien zu verschiedenen sozialen Gruppen und Milieus – Orts- und Ministerialbeamten, Hofpredigern, Scharfrichtern, Patrimonialrichtern, Missionaren oder Predigern, um nur jene Beispiele zu nennen, die im weiteren Verlauf der Studie, neben anderen, eine wichtige Rolle spielen werden – dienen sie zudem als Quelle für die Rekonstruktion von Lebenswegen und Selbstpräsentationen. Es ist bezeichnend, dass der Historiker Martyn Lyons in seiner Geschichte der Schriftkultur den Wandel der Schreibpraxis zwar mit einem Hinweis auf Bewerbungsschreiben illustriert – in denen heute niemand mehr auf handschriftliche, sondern auf Fähigkeiten im Umgang mit Textverarbeitungsprogrammen eingeht –, jedoch nicht auf die Idee kommt, Bewerbungsschreiben selbst als Quelle heranzuziehen.5 Wenn es um einen prominenten Bewerber geht und die Überlieferung es zulässt, dann werden im Einzelfall die Abläufe eines Bewerbungsverfahrens rekonstruiert. In der Regel folgt das einem biografischen Interesse, ohne dass weitergehende Fragen in den Blick genommen werden.6 In anderen Fällen dienen archivalische Zufallsfunde als Ausgangspunkt, um einem landesgeschichtlich interessierten Publikum ein untergegangenes städtisches Amt vorzustellen.7 Auch in Arbeiten zur Geschichte der Personalauswahl in Unternehmen und Organisationen oder zur Geschichte der Berufsberatung, die sich dem Gegenstand geschuldet auf das 20. Jahrhundert konzentrieren, finden sich Hinweise auf zeitgenössische Bewerbungspraktiken. Die Bewerber und ihre Bewerbungen werden dabei jedoch zugunsten einer Beschäftigung mit Auswahlverfahren, Eignungsprüfungen usw. ausgeblendet.8 Jüngere Forschungen zur Geschichte des Lebenslaufs als spezifische Textsorte und Praxis überkreuzen sich erkennbar mit Fragen einer Geschichte der Bewerbung, nicht zuletzt, weil die verwendeten Quellen mehrheitlich aus Bewerbungskontexten stammen. Die entsprechenden Forschungen lösen den Lebenslauf allerdings aus diesen Kontexten heraus, um ihn als eigenständigen Forschungsgegenstand zu behandeln.9 Kurz und gut: Vor dem Hintergrund bisheriger Forschungen ist kaum bekannt, wie Stellensuchende lernten, sich zu bewerben, wann und unter welchen Umständen sich die schriftliche Bewerbung als zentrales Instrument der Stellensuche durchsetzte, welche Hilfsmittel zu diesem Zweck zur Verfügung standen – oder wer diejenigen waren, die sich zuerst mit der Notwendigkeit schriftlich ausgearbeiteter Bewerbungen konfrontiert sahen. Diesen und ähnlichen Fragen werde ich nachgehen. Ich werde dabei eine archäologische Perspektive einnehmen, die nach den Spuren des modernen Bewerbungswissens sucht. Das schließt die Herausbildung des Begriffs der Bewerbung in seiner modernen, auf den Arbeitsmarkt bezogenen Bedeutung ebenso ein wie die Rekonstruktion der Rahmenbedingungen, die die Entstehung dieses Wissens ermöglichten.
Verstehen lässt sich die Kulturtechnik der Bewerbung nur, so die grundlegende These, indem man Schritt für Schritt ihre historischen Bezugspunkte herausarbeitet. Die Bewerbung erscheint dabei als Kulturtechnik, die an der Wende zum 19. Jahrhundert als Krisenbewältigungsstrategie entstand und seither untrennbar mit dem Problem sozialer und ökonomischer Prekarität verbunden ist. In gleicher Weise ist sie in ihrer modernen Form an die Existenz von Arbeitsmärkten, an das Prinzip der Konkurrenz und dasjenige der Leistung und des Leistungsvergleichs gebunden. Wie sich diese Konkurrenz ausgestaltet, was jeweils unter Leistung verstanden wird und welche Argumente mobilisiert werden, um gegenüber Mitbewerberinnen und Mitbewerbern zu bestehen und eine dritte Partei von sich zu überzeugen, unterliegt dem historischen Wandel. Wo Bewerberinnen und Bewerber in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre besondere Würdig- und Bedürftigkeit gegenüber anderen betonten und sich veranlasst sahen, ihre Anstellungsgesuche mit teilweise ausufernden Erzählungen persönlicher und familiärer Schicksale zu begründen, da rückten spätere Bewerber und Bewerberinnen Qualifikation und Eignung in den Vordergrund, versinnbildlicht in ausbildungs- und beschäftigungsbezogenen Lebensläufen, die sich in der uns bekannten Form seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ausdifferenzierten. In diesem Sinn ist die Geschichte der Bewerbung eng damit verbunden, wie eine Gesellschaft das Zusammenleben denkt: entlang Vorstellungen von Patronage und »sittlicher Ökonomie« (Edward P. Thompson) oder entlang einer Idee von Meritokratie. Im ersten Fall ließ sich mit einer Bewerbung ein zumindest moralischer Anspruch auf Versorgung geltend machen, im zweiten bewarb man die eigenen Verdienste und Leistungen. Innerhalb dieses Rahmens spielte sich die Konsolidierung der Kulturtechnik der Bewerbung ab. Diese Geschichte begann mit den Herausforderungen der in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht prekären Umbruchszeit um 1800, und sie endet im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts mit der vollständigen Ausbildung der modernen Arbeitsgesellschaft, das heißt der Verfestigung segmentierter Teilarbeitsmärkte innerhalb eines allgemeinen Arbeitsmarkts, der Etablierung einer professionalisierten Arbeitsvermittlung und Berufsberatung, der Herausbildung von Personalabteilungen in Unternehmen sowie der Entstehung zielgruppengerechter Spezialratgeber für Stellensuchende.
Die Fragen und Themen der vorliegenden Studie verweisen auf eine historische Problemstellung. Und doch gibt die Beschäftigung mit der Geschichte der Bewerbung auch Aufschluss über unsere heutige Bewerbungskultur. Denn: Die historische Perspektive ist vielleicht sogar besser als andere Perspektiven geeignet, eine vermeintliche Selbstverständlichkeit moderner Gesellschaften zu problematisieren und zu verstehen, was wir warum tun, wenn wir uns bewerben. Meine Studie ist daher jenen gewidmet, die sich wieder und wieder mit Bewerbungen herumschlagen. Zwar ist es aus theoretischen, methodischen und Quellengründen müßig, der Frage nachzugehen, wie historische Akteurinnen und Akteure die Anforderung, Bereitschaft, Erwartung, Fähigkeit, Notwendigkeit und Zumutung der Bewerbung erfahren haben, ob sie sich lieber auf andere Weise um eine Anstellung bemüht hätten oder was sie über das Selbstbild dachten, das sie in ihren Bewerbungsschreiben entwarfen. Womit man jedoch rechnen kann, das sind vergleichbare Erfahrungen heutiger Leserinnen und Leser. Gegenwärtige Erfahrungen können Ausgangspunkt eines Nachdenkens über historische Erfahrungen sein, nur sollte man nicht die eigenen Erfahrungen rückprojizieren. Die Berufung auf die »Erfahrung« historischer Subjekte, das ist seit Joan W. Scotts Überlegungen nicht zu leugnen, erzeugt trügerische Evidenzen, jedenfalls wenn damit eine historische Realität jenseits von Sprache und Diskurs verbürgt werden soll. Die Identität der Erfahrung machenden historischen Akteurinnen und Akteure, so Scott, würde damit einer – in jedem Fall notwendigen – kritischen Historisierung entzogen.10 In diesem Sinn geht es mir um eine Vermessung der Distanz zwischen der heutigen Bewerbungskultur und derjenigen des frühen, mittleren und späten 19. Jahrhunderts, schließlich hat man es in dem einen Fall mit einer gerade erst entstehenden und im anderen Fall mit einer allgegenwärtigen Kulturtechnik zu tun. Trotz allen historischen Wandels, den ich in den folgenden Kapiteln beschreiben werde, sollte nicht vergessen werden, dass es sich bei der modernen Arbeitsgesellschaft um eine inzwischen über zweihundert Jahre alte Formation handelt, deren Anforderungen ebenso wenig ein individuelles oder allein heutiges Problem sind wie das Verzweifeln oder Scheitern daran.
Für eine Geschichte der Bewerbung stehen zwei Quellengattungen zur Verfügung. Einerseits handelt es sich um die umfangreiche Ratgeberliteratur vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert, in der sich Musterschreiben und Anleitungen zum Verfassen von Anstellungsgesuchen finden. Die Zielgruppen der auflagenstarken Veröffentlichungen sowie die darin enthaltenen Beispiele (Stellen als Kanzlist bei Post- oder Forstverwaltungen, bei Landgerichten oder in privaten Diensten, als Prediger oder Lehrer, als Handlungsgehilfe oder Kontorist) lassen erkennen, von welchen Personen und für welche Berufe man zu verschiedenen Zeiten annahm, dass eine schriftliche Bewerbung notwendig oder von Vorteil sein könnte. Diese Quellen gewähren Einblick in sich wandelnde Vorstellungen »korrekter« und »angemessener« Gesuche. Sie werfen die Frage nach der Aneignung des bereitgestellten Wissens sowie dem Verhältnis von Standardisierung und individueller Ausgestaltung der Schreiben auf.11 Andererseits sind für das gesamte 19. Jahrhundert zahlreiche Bewerbungsschreiben für unterschiedliche Beschäftigungssegmente archivalisch überliefert. Als Ego-Dokumente und Selbstzeugnisse erfüllen diese Quellen das Kriterium der Freiwilligkeit und eigenhändigen beziehungsweise direkt beauftragten Abfassung.12 Durch ihre Anbindung an ein reguliertes Verfahren gilt das aber nicht absolut, gehört die Sorge um ein Ein- und Auskommen doch zu jenen »besonderen Umständen« (Winfried Schulze), die jene, die es ansonsten vielleicht nicht getan hätten, dazu veranlassen, Auskunft über sich selbst zu geben. Bei den darin greifbaren Selbstpräsentationen handelt es sich um Übersetzungsleistungen sowie das Ergebnis taktischer und strategischer Überlegungen innerhalb eines formalisierten Settings. Bewerbungsschreiben bewegen sich im Geflecht wechselseitiger Erwartungen und »Erwartungserwartungen« (Niklas Luhmann). Als Quellen gewähren sie nicht nur einen Einblick in Lebensumstände und Vorstellungswelten von Bewerberinnen und Bewerbern, sondern vor allem in die sozialen, ökonomischen, kulturellen Umstände, die eine bestimmte Art des Schreibens hervorbringen. In dem Maß, wie sich in Anstellungsgesuchen oft nur leicht variierte, wiederkehrende Formulierungen zeigen, lassen sich die Konturen eines geteilten und zirkulierenden Wissens nachzeichnen, wonach eben bestimmte Auskünfte (oder auch Sätze) in eine Bewerbung um diese oder jene Stelle gehörten. Ergänzen werde ich das, wann immer möglich, um Materialien, die Aufschluss über die Verfahrensseite bieten, also Fragen der Ausschreibung oder der Einschätzung und Auswahl von Bewerbern und Bewerberinnen innerhalb bestimmter Behörden und bei konkreten Stellen. Bewerbungs- und Anstellungsgeschichte, das wird dabei deutlich, durchdrangen sich immer wieder, und die eine Geschichte prägte die andere jeweils mit. Die zumindest fallweise Rekonstruktion der Spezifika der diskutierten Arbeitsmarktsegmente sowie der damit verbundenen Anstellungsgeschichten ist nicht zuletzt deshalb von Belang, weil sich Bewerbungskompetenz in modernen Arbeitsgesellschaften daran zeigt, ein allgemeines kulturtechnisches Wissen auf konkrete Situationen zu beziehen – und dabei sowohl die Spezifika des jeweiligen Beschäftigungssegments als auch generelle Verfahrensfragen zu kennen und zu berücksichtigen. Letzteres lässt sich etwa daran ablesen, ob und inwieweit die in Ausschreibungen genannten Einstellungskriterien reflektiert oder dort verwendete Formulierungen übernommen wurden.
Vorlagen und Erzählungen
Die Bewerbung ist eine besondere Form des Redens über sich selbst. Sie verwandelt Menschen in Arbeitsuchende. Reden über sich selbst setzt, so der Soziologe Alois Hahn, eine Distanzierung voraus: zwischen sich selbst als jemandem, der redet, und als jemandem, über den geredet wird.13 Die von Hahn hervorgehobene Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Selbst – das Selbst einerseits als »Lebenslaufresultat« und andererseits als Gegenstand der Kommunikation sowie Resultat sozialer Zuschreibungen – wird im Akt der Bewerbung, diese Hypothese lässt sich formulieren, unterlaufen. Schließlich ist die Bewerbung eine Präsentation seiner selbst als Lebenslaufresultat, die auf denjenigen zurückwirkt, der sich präsentiert. Das Autobiografische kommt im erzählten Lebenslauf in bestimmter Formatierung zum Vorschein: einerseits unspezifisch hinsichtlich der Fülle von Lebensereignissen, andererseits fokussiert auf bestimmte Kategorien und Kriterien, die das sich bewerbende Subjekt vergleichbar machen und sein Leben auf die angestrebte Anstellung beziehungsweise Karriere zuschneiden. Entscheidend ist die Verknüpfung einzelner Stationen zu einer teleologischen Reihe, die in der finalen Anstellung gipfeln sollte.14 In der projektiven Fortschreibung des Lebens liegt der Clou des bewerberlichen Diskurses. Er verknüpft in der Vergangenheit liegende Stationen, die es so tatsächlich gab, mit einer potenziellen Station, die in Zukunft angestrebt wird. Die Bewerbung ist eine Schablone, in die das Selbst gegossen wird. Dazu trägt bei, dass es sich um eine hoch formalisierte Textsorte handelt. Schriftliche Gesuche um Anstellung fügten sich am Beginn ihrer Geschichte einerseits in die Briefkultur des 19. Jahrhunderts, deren Kennzeichen nicht Individualisierung, sondern eine »bis ins Detail entwickelte Konventionalisierung« war – mit ständig wiederkehrenden Elementen, etwa der in privaten Briefen obligaten Schilderung der persönlichen Lebensumstände, des Befindens der Familie und der beruflichen Entwicklung.15 Andererseits ging die Bewerbung aus der älteren Tradition der Bittgesuche hervor, in denen die Obrigkeit um gnadenvolle Gewährung einer wie auch immer gearteten Unterstützung gebeten wurde. Die Verleihung einer Stelle zählte zu den etablierten Formen der Unterstützung, um die sich bitten ließ und die ein Herrscher gewähren konnte.16 Die Geschichte der Bewerbung ist die Geschichte einer schrittweisen Transformation dieses Kontexts unter anderem in Richtung eines arbeitsmarktlichen Leistungsvergleichs.
In Anstellungsgesuchen zeigt sich eine Erzählpraxis, die fiktionale Qualität haben kann. Schließlich ging es bei Bitten immer auch darum, eine plausible und zielführende Geschichte zu erzählen. Die Historikerin Natalie Zemon Davis hat vor einigen Jahren frühneuzeitliche Gnadengesuche einer klugen Analyse unterzogen. Ihr ging es darum, »wie die Autoren dieser Texte aus den Geschehnissen im Umkreis eines Verbrechens eine Geschichte schaffen«.17 Um vom König begnadigt zu werden, war es nötig, die Geschehnisse in einer Weise zu erzählen, die sich gegen andere Geschichten durchsetzen konnte. Den Adressaten – königlichen Notaren und Magistraten – musste eine nachvollziehbare Situation vor Augen geführt werden, die eine Tat als gerechtfertigt erscheinen ließ; etwa indem typische Sorgen und Nöte einer bestimmten sozialen Gruppe geschildert wurden. Es sei dahingestellt, ob sich Bewerbungen nicht auch als eine Art Gnadengesuch anfühlen können. In jedem Fall stellt sich aber die Frage, wer darin welche Geschichte erzählte. Das liegt nahe, weil Anstellungsgesuche eben lange Zeit zu den Bittschriften gehörten, wenn auch als besondere Spielart dieser Gattung. Und Bittschriften mussten erzählen.
Die narratio, also die Schilderung der Notlage, in der man sich befand und aus der man sich zu befreien hoffte, war gemäß gültiger rhetorischer Schemata verbindlicher Teil eines Bittschreibens. »Es geht nemlich«, so ein zeitgenössischer Ratgeber, »der Bittschrift eine kurze, gut geordnete und wahre Geschichtserzählung, oder eine eben so geordnete Darstellung unserer Lage voraus, welche uns zu der vorzutragenden Bitte bestimmt.«18 Johann Georg Müllers Neuester Briefsteller für alle Fälle im gemeinen Leben (1801) wies nachdrücklich darauf hin, dass die Erzählung deutlich, verständlich, einleuchtend, zusammenhängend und unterhaltend zu sein hatte. Schmückendes Beiwerk sei erlaubt, wenn der Gegenstand das vertrage. Vollständigkeit dürfe aber nicht mit Weitschweifigkeit oder Umständlichkeit verwechselt werden. Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten könne man behutsam einflechten, müsse aber dasjenige, was ihnen an Wichtigkeit abgehe, mit Lebhaftigkeit des Ausdrucks kompensieren. »Insofern die Bittschriften Erzählungen enthalten«, habe der Stil dem Zweck dienlich zu sein. Man versuche, das Herz des Adressaten zu erreichen und ihn mit Wohlwollen zu erfüllen, wähle also die »erhebende Sprache des Affektes, lebhafte und starke Schilderungen, die nicht bloß Skizze bleiben, sondern mit Vortheil ausgemalt sind. Doch darf der Briefsteller dabey nie Redner oder Dichter werden.«19 Dem Erzählerischen boten sich hier große Spielräume. Mal ging es darum, sich »auf die gehörige Darlegung und den überzeugenden Beweis von der Nothwendigkeit, Rechtmäßigkeit, Billigkeit oder Nützlichkeit derjenigen Sache« zu konzentrieren, »um deren Bewilligung man anhält«; mal sollte sich die Konzentration auf »den schicklichen und wirksamen Vortrag einer auf bloßer Güte und Gnade beruhenden Bitte« richten. In einigen Fällen waren »Beweis- und Beweggründe nebst der Widerlegung der etwaigen Zweifel und Bedenklichkeiten« vollständig und bündig vorzutragen. In anderen war es »meistens schon genug, die Veranlassung und die Beweggründe deutlich und bestimmt in gedrängter Kürze auszuführen.«20 Spätere Ratgeber betonten, man müsse sich »ganz besonders der peinlichen Wahrhaftigkeit befleißigen. Man begründe niemals eine Bitte mit unwahren oder auch nur übertriebenen Angaben und Schilderungen.« Dabei vermeide man »alle Weitschweifigkeit in der Darlegung und schreibe eine klare Darlegung, aber nicht unnötig breit und lang und ohne phrasenhafte Redewendungen«.21 Der Inhalt eines Bittschreibens, so hieß es 1907 in der letzten Auflage von Rammlers Universal-Briefsteller, der erstmals 1834 erschienen war, bestehe »in der Darlegung der Veranlassung der Bitte, der Gründe, wodurch sie unterstützt wird, in den wichtigen Vorteilen, welche man von der Bewilligung derselben erwarten darf«, und schließlich der Verpflichtung, »die man sich dafür aufzuerlegen bereit erklärt«. Neu war lediglich die Warnung, »über seine eigenen Verhältnisse nicht mit allzugroßer Vertraulichkeit zu sprechen, wenn man nicht der völligen Vertrauenswürdigkeit und Verschwiegenheit des Briefempfängers versichert ist«.22
Das Erzählerische, das lange selbstverständlicher Bestandteil von Bittschriften war, wird im Lauf der Zeit zumindest aus jenen Bitten verschwinden, die als Bitten um Anstellung unserem Verständnis von Bewerbungen entsprechen. Die heutige Bewerbungskultur kommt allem Anschein nach ohne ausgreifende Storys aus, jedenfalls ohne solche, die über sorgsam komponierte berufliche Erfolgsgeschichten hinausgehen. Die schrittweise Ausdifferenzierung des separaten Lebenslaufs seit dem späten 19. Jahrhundert sowie dessen im 20. Jahrhundert folgende Tabellarisierung leisteten einer Reduktion auf das Faktische ebenso Vorschub wie einer Konzentration auf stellenrelevante Themen.23 In historischer Perspektive lässt sich das auch als Ergebnis einer Kontextverschiebung interpretieren, die immer wieder Thema sein wird: die schrittweise, aber nicht immer eindeutige Herauslösung der Bewerbung (und damit der eingebetteten Lebensläufe) aus der älteren Praxis der Bittschriften. Die sprachliche Selbstverleugnung des Bittstellers, die für ältere Erzählungen charakteristisch war, also Schilderungen, die den Bittenden als Referenten in eigener Sache darstellten und die Bitte zum eigentlichen Protagonisten der Geschichte machten24, hat der Objektivierung und Zerlegung des Bewerbers oder der Bewerberin in Leistungsindikatoren Platz gemacht. Die Geschichten, die Personalbögen oder Bewerbersynopsen erzählen, sind dann doch andere. Ratschläge, die sich noch bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hielten – dass sich nämlich ein Bewerbungsbrief »von der großen Flut solcher Stellengesuche durch eine persönliche Note unterscheiden« solle und »seinen Empfänger nicht langweilen« dürfe, sondern ihn »so fesseln« müsse, dass er »obenan liegt bei den Briefen, die zur engeren Wahl vorgesehen sind«25 –, wirken dabei fast schon etwas deplatziert.
Bei der Bewerbung handelt es sich um eine besondere Form des Redens über sich selbst, an die sich wandelnde erzählerische Ansprüche gestellt wurden. Damit war von Anfang an eine besondere Herausforderung verbunden. Sie lag darin, dass in Bewerbungsschreiben nicht nur die Umstände zu schildern waren, die zur Bewerbung veranlasst hatten, sondern auch die Lebensgeschichte, einschließlich der im Lauf des Lebens erworbenen Dispositionen und Qualifikationen, die den Bewerber aus seiner Sicht zur Ausübung der Stelle befähigten, ihn aber auch der fraglichen Stelle bedürftig und würdig machten. Daraus ergab sich die heikle Situation, von sich selbst reden zu müssen – und gerade dadurch unbescheiden zu wirken. Der Pädagoge Adolph Diesterweg gehörte zu den wenigen Bewerbern, die dieses Problem nicht nur erkannten, sondern offen zur Sprache brachten. In seiner an den preußischen Kultusminister Altenstein gerichteten Bewerbung um die Leitung des neu gegründeten Lehrerseminars in Moers vom 2. Februar 1820 schrieb er:
Auf dem Vertrauen zu der bekannten Humanität Ew. Excellenz ruht die Hoffnung des Bittstellers, daß das mißliche, aber durch die Natur der Sache gebotene Unterfangen desselben, von sich selbst zu reden, nachsichtig werde beurteilt werden. Denn nur allzu leicht trägt die Lösung der Aufgabe, eine Skizze des eigenen Lebens zu entwerfen, das Gepräge der Anmaßung oder der erkünstelten Bescheidenheit an sich. Jederzeit aber wird man in solchem Falle nur eine kurze Geschichte des äußeren Lebens erwarten, gerne beistimmend, wenn der Autobiograph die Beurteilung des Verlaufes seiner inneren Bildung und die Zeichnung der Umrisse seines Charakters Anderen und namentlich seinen vernünftigen Umgebungen überläßt.26
Und so hielt es Diesterweg im Fortgang auch: Einer förmlichen Skizze seiner Schul- und Ausbildung sowie der bisherigen Tätigkeiten im Sinn eines ausformulierten Lebenslaufs folgte der Verweis auf bereits eingereichte oder noch einzureichende »Testimonia«, da »das Bisherige nicht hinreichen kann, um das Wohlwollen Ew. Excellenz zu fixieren«. Diesterweg fühlte hier die Notwendigkeit, »begründetere Andeutungen, wo nicht Beweise, für die Rechtmäßigkeit meiner Wünsche und Hoffnungen darzulegen«. Diesterwegs Adressierung des Bittstellers als Autobiograf ist elaborierter als vieles von dem, was Leserinnen und Lesern im Verlauf der vorliegenden Studie begegnen wird. Ein Grundproblem ist damit aber dennoch benannt. Zahlreiche Ratgeber betonten den Wert und die Notwendigkeit eines bescheidenen Auftretens im Rahmen einer Bewerbung. Bewerberinnen und Bewerber wiederum verzichteten nahezu nie auf eine Bescheidenheitsfloskel. Das wiederum wurde durch die Bitte begleitet, man möge die Schilderung der eigenen Fähigkeiten und Leistungen nicht als unbescheiden auslegen.
Leistung und Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
Bewerbungen verbinden wir heute intuitiv mit dem Prinzip der Arbeitsmarkt- und Leistungskonkurrenz. Diese Zuspitzung ist Ergebnis einer historischen Entwicklung. Ihre volle Bedeutung erlangt sie in einer Gesellschaft, die auf einer Verengung des Arbeitsbegriffs auf Erwerbsarbeit beruht und darunter alle Tätigkeiten zusammenfasst, die auf ein Einkommen aus dem marktbezogenen Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zielen.27 Gemeint ist eine Gesellschaft, in der Menschen als Verkäuferinnen und Verkäufer ihrer Arbeitskraft miteinander konkurrieren. Die Kulturtechnik der Bewerbung setzt die keineswegs selbstverständliche Existenz von Arbeitsmärkten voraus; und sie ist zugleich deren Effekt. Umso erstaunlicher ist es, dass Bewerbungspraktiken in der historischen Arbeitsmarktforschung kaum diskutiert werden. Die Beschäftigung mit der Bewerbung kann hier dazu beitragen, Arbeitsuchende als Handelnde auf dem Arbeitsmarkt sichtbar zu machen. Das ist nicht zuletzt deshalb sinnvoll, weil Angebot und Nachfrage nicht auf magische Weise zueinander finden, sondern einander suchen müssen; und dabei spielt die Bewerbung eine entscheidende Rolle. In dem Maß, wie sich Arbeitsmärkte und das Prinzip der Arbeitsmarktkonkurrenz etablierten, veränderte sich auch der Charakter der Bewerbung: von einem Instrument der gegenseitigen sozialen Verpflichtung oder der Geltendmachung moralischer Ansprüche hin zu einem Instrument der Positionierung auf einem kompetitiven Arbeitsmarkt. Ausschlaggebend wurde die Herausbildung einer Gesellschaft, die um die Idee eines selbstregulierenden Markts kreiste. Karl Polanyi sprach in seiner klassischen Studie The Great Transformation (1944) davon, dass »ein völlig neuer institutioneller Mechanismus auf die westliche Gesellschaft einzuwirken begann, daß dessen Gefahren, zunächst äußerst schmerzlich, nie wirklich überwunden wurden und daß die Geschichte der Zivilisation des 19. Jahrhunderts weitgehend aus Versuchen bestand, die Gesellschaft vor den durch diesen Mechanismus hervorgerufenen Verheerungen zu schützen.«28 Die Institutionalisierung des Marktprinzips brachte eine Neuformatierung wirtschaftlicher und sozialer Beziehungen mit sich. Entscheidend ist nicht die Entstehung kommerzieller Konsumgütermärkte, sondern die Herausbildung eines Arbeitsmarktes. Der Arbeitsmarkt verwandelt Arbeit in eine »fiktive Ware« (Polanyi); fiktiv deshalb, weil sie im Unterschied zu anderen Waren nicht mit dem Ziel »produziert« wird, sie profitabel zu verkaufen. Der entscheidende Einschnitt war die Durchsetzung des – formal freien und freiwilligen – Arbeitsvertrags als Prinzip der Organisation von Arbeit und damit deren Herauslösung aus Vormundschaftsverhältnissen und anderen Formen der Unfreiheit. In historischer Perspektive, so schreibt der französische Soziologe Robert Castel, geht es nicht um die Notwendigkeit der Arbeit, sondern um die »Notwendigkeit der Freiheit der Arbeit«.29
In ihren Bezügen auf den Arbeitsmarkt ist die Bewerbung mit dem Problem der Konkurrenz verbunden, auch wenn diese Verbindung nicht von Anfang an gegeben war, sondern sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts herausbildete und verfestigte. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wurde im deutschen Sprachgebrauch die Rede von »Concurrenz« auf Märkten üblich, das heißt, Märkte wurden erst ab diesem Zeitpunkt als Orte des Wettbewerbs verstanden – als Orte, an denen Wett- und Mitbewerber konkurrierten. Dass Wirtschaft insgesamt als Leistungskonkurrenz im Sinn eines positiv konnotierten Verdrängungswettbewerbs zu verstehen sei, ist eine Idee noch jüngeren Datums.30 Während Konkurrenzphänomene als solche kaum sauber vom Begriff des Wettbewerbs zu unterscheiden sind, lässt sich in historischer Perspektive doch eine Unterscheidung vornehmen, die beispielsweise der Soziologe Tobias Werron ins Blickfeld gerückt hat. Demnach setzte sich die Wettbewerbssemantik seit dem Ende des 18. Jahrhunderts als »Reflexionsformel für eine bestimmte Form der Konkurrenz« durch: diejenige Form, die sich auf ein überindividuelles und anonymes Publikum bezog, um dessen Gunst oder Geld mehrere Wettbewerberinnen und Wettbewerber konkurrieren und über dessen Präferenzen und Erwartungen sie nur spekulieren können.31 Die Engführung als Konkurrenz um Käuferinnen, Kunden und Konsumentinnen, die man nicht persönlich kennt, zwingt dazu, die Spezifika der Bewerbung als Konkurrenzinstrument zumindest versuchsweise auszubuchstabieren. Die vorliegende Studie ist ein Versuch in diese Richtung.
Die klassische soziologische Bestimmung des Begriffs und Phänomens der Konkurrenz stammt von Georg Simmel. Konkurrenz, so schrieb Simmel Anfang des 20. Jahrhunderts, sei »eine eigentümliche Form des Kampfes«. Wirksam werde sie unter Bedingungen der Knappheit, also dann, »wenn ein nicht für alle Bewerber ausreichendes oder überhaupt zugängliches Gut nur dem Sieger eines Wettbewerbes unter ihnen zufällt«.32 Entscheidend sei, dass der Kampf indirekt ausgefochten werde und zudem vielfältig reguliert sei. Konkurrenten zielten in erster Linie auf die Gunst eines Dritten. Es gehe nicht darum, Gegnerinnen und Gegner zu besiegen (jedenfalls sei mit einem solchen Sieg das eigentliche Ziel noch nicht erreicht), sondern darum, ihnen gegenüber bevorzugt zu werden. Die »ungeheure vergesellschaftende Wirkung« der Konkurrenz, so Simmel, liege darin begründet, dass die Energien nicht auf die Vernichtung eines Gegners gelenkt werden. Vielmehr zwinge sie
den Bewerber, der einen Mitbewerber neben sich hat und häufig erst hierdurch ein eigentlicher Bewerber wird, dem Umworbenen entgegen- und nahezukommen, sich ihm zu verbinden, seine Schwächen und Stärken zu erkunden und sich ihnen anzupassen, alle Brücken aufzusuchen oder zu schlagen, die sein Sein und seine Leistungen mit jenem verbinden könnten. […] Die moderne Konkurrenz, die man als den Kampf aller gegen alle kennzeichnet, ist doch zugleich der Kampf aller um alle.33
An der zitierten Passage fällt die unmittelbare Verwendung der Begriffe des Bewerbers und Mitbewerbers zur Beschreibung von Konkurrenzsituationen auf. Auch Max Weber definierte den »friedlichen Kampf« als Konkurrenz, »wenn er als formal friedliche Bewerbung um eigne Verfügungsgewalt über Chancen geführt wird, die auch andere begehren«.34 Keiner von beiden kam jedoch auf die Idee, die Bewerbung als eigenständiges, vielleicht sogar zentrales Instrument moderner Konkurrenz zu profilieren. Dabei kommen in der Bewerbung nahezu alle angesprochenen Elemente paradigmatisch zusammen. Die Bestimmung als indirekter Kampf lenkt die Aufmerksamkeit darauf, wie Bewerberinnen und Bewerber jenen Dritten adressieren, um dessen Gunst sie konkurrieren, sowie darauf, wie weit die von Simmel angesprochenen opportunistischen und konformistischen Tendenzen gehen und wie sie sich ausgestalten. Es stellt sich aber auch die Frage, ob und in welcher Form Bewerber und Bewerberinnen auf ihre Konkurrenten Bezug nehmen und entlang welcher Maßstäbe sie sich vergleichen. Die heute naheliegende erste Intuition – es müsste oder sollte um einen Leistungsvergleich und Leistungskonkurrenz gehen – erweist sich in historischer Perspektive als heikel.
Einerseits ist der Begriff der Leistung in unserem Verständnis ein spätes Produkt. Der Umstand, dass »zunehmend ein vermeintlich autonom handelndes, tüchtiges beziehungsweise fähiges und kräftiges Individuum ins Zentrum« des Begriffs rückte und die sozialen Kontexte an den Rand gedrängt wurden, ist, so die Historikerin Nina Verheyen, Ergebnis einer »schleichenden Umdeutung« in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die ältere Bedeutung akzentuierte demgegenüber eher den Aspekt sozialer Obliegenheiten, also der Treue, der Pflicht, des Gehorsams, nicht die Anstrengungen und das Vermögen des Einzelnen. Etwas zu leisten, hieß demnach: einer Verpflichtung nachzukommen. Vor diesem Hintergrund entfaltete sich schrittweise ein neues Verständnis, »das unabhängig von einer konkreten sozialen Beziehung auf persönliche Fähigkeiten verwies«.35 Das wiederum schuf die Grundlage dafür, Menschen entlang ihres Tuns und Könnens zu vergleichen und zu hierarchisieren (und sie damit zu Konkurrentinnen und Konkurrenten zu machen, die mehr als andere leisten sollten, um Anerkennung zu finden). Damit stellt sich andererseits jedoch die Frage, was in sozialen Situationen und historischen Konstellationen jeweils als Leistung anerkannt und wie Vergleichbarkeit herstellt wird. In der Geschichte der Bewerbung ist das unmittelbar evident. Wer Aufstieg und Ausgestaltung der »Leistungsgesellschaft«, also der meritokratischen Rechtfertigung sozialer Ungleichheit36 und der Veralltäglichung von Wettbewerb als individueller Leistungs- und Arbeitsmarktkonkurrenz, besser verstehen will, kommt um eine Beschäftigung mit dieser Kulturtechnik nicht herum.
Empfehlungen und Patronage
In bestimmten Beschäftigungsfeldern konkurrierte das schriftliche Gesuch um Anstellung mit anderen Formen der Stellensuche und Stellenvergabe. Im Bereich der Fabrikarbeit dominierte die sogenannte Umschau, also das Umherziehen und Nachfragen vor Ort. Ging es um häusliche Dienstverhältnisse (als Kammerfrau oder Kammerherr, Hofmeister, Sekretär, Dienstmädchen, Dienstbote), waren, sieht man von der Tätigkeit etablierter Vermittlungsbüros ab, Empfehlungen entscheidend. Empfehlungen, so beschreibt der Sozialhistoriker Rolf Engelsing diese Praxis, »wurden nicht allein unter den Dienstherren ausgetauscht, sondern erfolgten vor allem in großen Häusern für gutbezahlte Stellungen in weitem Umfang auch durch das dort tätige Personal«.37 Bewerbungen in einem engeren Sinn spielten dabei eine untergeordnete Rolle. Entweder baten Stellensuchende im Vorfeld einen Gönner oder eine Gönnerin um Empfehlung, oder jemand erbat sich von Bekannten die Empfehlung geeigneter Personen für eine zu besetzende Stelle. Die damit verbundene Form der Stellensuche lässt sich als stellvertretende oder indirekte Bewerbung verstehen. Zwar ist davon auszugehen, dass Mündlichkeit dabei wichtiger als bei anderen Formen der Stellensuche war. In der Ratgeberliteratur finden sich dennoch zahlreiche Beispiele für eine schriftliche Empfehlungspraxis, etwa die Empfehlung eines Hofmeisters durch einen Edelmann, das Musterschreiben einer Sekretärin, die einer »vornehmen Dame« eine »Anverwandtin« als Kammerfrau empfahl, oder die Bitte eines »Bürgers« an einen Standesgenossen, seine Nichte als Kammerjungfer unterzubringen.38 Die Musterempfehlungsschreiben sind in der Regel weniger standardisiert als förmliche Anstellungsgesuche. Ratgeber betonten allerdings auch die Ähnlichkeit der beiden Briefarten. Bewerbungsschreiben wurden dabei als »Empfehlungsschreiben« präsentiert, »bei welchen der Verfasser der Briefe selbst der Empfohlene ist«.39 Der Charakter der Bewerbung als Selbstempfehlung blieb seither erhalten und macht seit Langem ihren Kern aus. Die Empfehlung durch andere wurde dabei allerdings schrittweise in Bewerbungsverfahren und Bewerbungsdossiers re-integriert, allerdings in veränderter Form als Attest oder Arbeitszeugnis, die mit dem Anspruch größerer Objektivität und eines quasi-offiziellen Charakters auftreten.
Im Unterschied zu Anstellungsgesuchen bewegten sich Empfehlungsschreiben innerhalb verschiedener Bezugssysteme. Einerseits erfüllten sie eine Funktion, die Empfehlungen auch in heutigen Verfahren erfüllen sollen: Informationsasymmetrie auszugleichen und Informationen zu vermitteln, die aus Zeugnissen, Noten und Kennziffern so nicht ablesbar sind, auch wenn inzwischen Zweifel geäußert werden, ob sie diesen Zweck tatsächlich erfüllen.40 Andererseits wirkte die Kultur der Empfehlung im 18. und 19. Jahrhundert als Instrument der Vergesellschaftung und Stellenbesetzung. Informationsweitergabe und Konkretisierung der Fähigkeiten und Eigenschaften eines Bewerbers mittels Empfehlungsschreiben waren hier insofern von besonderem Gewicht, als in vielen Beschäftigungsfeldern keine einheitliche Ausbildung existierte, die mit aussagekräftigen Zertifikaten verbunden gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund wuchs die Bedeutung von Empfehlungen, mit denen beispielsweise Väter versuchten, ihr soziales und kulturelles Kapital auf die Söhne zu übertragen, um sie im geschäftlichen Freundes- und Bekanntenkreis unterzubringen. Da es in solchen Schreiben jenseits des konkreten Anliegens um die Bekräftigung von »Geneigtheit und Wohlwollen« im Dienst einer stabilen und beiderseitig profitablen Geschäftsbeziehung ging, so die Historikerin Lisa Gerlach in einer Analyse von Empfehlungen, die Mitte des 19. Jahrhunderts bei dem Bankier Gerson von Bleichröder eingingen, erscheinen die Schreiben oft als relativ »unbeeinflusst vom Charakter oder Können« des Empfohlenen, über den man nicht immer etwas Konkretes erfährt.41 Der Umstand, dass Vorlagen in dieser Hinsicht kaum detaillierte Ausführungen enthielten, legt nahe, dass es primär um den Empfehlenden und seine Beziehung zum Adressaten ging. Nicht zuletzt dann, wenn sich ein einmal in Aussicht gestellter Gefallen einfordern ließ. »Als ich vor kurzem die Ehre hatte, Ew. Wohlgeb. meine Hochachtung zu bezeugen«, so heißt es in einem Musterbrief in Karl Philipp Moritz’ Anleitung zum Briefeschreiben (1783), »versprachen Sie mir, daß Sie für die Beförderung des jungen N. auf das beste sorgen wollten. Jetzt wäre es Zeit, wenn Sie ihr Versprechen erfüllen wollten, weil so eben die … sche Stelle erledigt ist, die gerade für ihn passen würde. […] Verpflichten Sie mich also durch eine baldige Erfüllung Ihres gütigen Versprechens.«42 Das Einfordern eines Gefallens, die Erinnerung an ein Versprechen, dessen Einlösung an der Zeit war, gehörte zum Briefrepertoire der Jahre um 1800. Entsprechende Schreiben waren häufig mit dem Problem der Stellensuche verbunden, denn welcher Gefallen und welches Versprechen konnten willkommener und gütiger sein als die Unterstützung bei der Suche nach einem Ein- und Auskommen?
Abweichend vom bewerbungskulturellen Normalfall – mehrere Bewerberinnen und Bewerber konkurrieren um die Gunst und Gnade eines Dritten, der eine Stelle zu vergeben hat – wird bei der stellvertretenden, indirekten Bewerbung ein Bewerber allerdings auch zum Unterpfand und Spielball zweier Parteien, die ihre Beziehung untereinander verhandeln. Deutlich wird das im zeitgenössischen Gattungsverständnis. Demnach waren Empfehlungsschreiben »gleichsam ein Tausch«. Sie signalisierten, dass man dem anderen »einen ähnlichen Dienst erzeigen kann«. Daher würden die »Empfehlungsschreiben derjenigen mehr gelten, welche eben die Gegenvergeltung zu leisten im Stande sind; und gegen die man Verbindlichkeit hat«. Interessanterweise kam der zitierte Ratgeber aus dem Jahr 1826 aber noch auf eine zweite, weniger wirksame Art von Empfehlungen zu sprechen: solche nämlich, in denen Fragen der Gegenvergeltung und Verbindlichkeit in den Hintergrund gedrängt würden und »man dreist Jemanden seiner Verdienste wegen« empfehle, wo man doch sicher sein könne, »daß dieselben geprüft und erkannt werden«. In diesen Fällen wolle das »Empfehlungsschreiben bloß bewirken«, dass »auf den Empfohlenen Rücksicht genommen werde«.43 Etwas zugespitzt: Empfehlungsschreiben, die bloß die Anstellung einer Person auf Grundlage überprüfbarer Verdienste bewirken wollen, sind gar keine Empfehlungsschreiben im vollen Sinn, weil nachweisliche Qualifikation und Eignung idealerweise keiner besonderen Empfehlung bedürften beziehungsweise ein Bewerber sich damit bereits selbst ausreichend empfehle.
Die kleinen Empfehlungen und Bitten um Empfehlung für eine Anstellung unterscheiden sich zwar von den formalisierten und ritualisierten Patronageverhältnissen der Frühen Neuzeit, etwa dadurch, dass sie nicht in jedem Fall auf Dauer angelegt waren. Dennoch besteht eine spannungsreiche Nähe zu dieser verbreiteten Praxis. Patronagebeziehungen werden inzwischen nicht mehr als »Residuen der Vormoderne« und Gegenmodell zu den regelgebundenen Verfahren der bürokratischen Moderne gedeutet. Vielmehr, so die jüngere Forschung, fügten sie sich auch nach 1800 in ein breites Spektrum sozialer Handlungen, die auf dem Austausch ökonomischer, symbolischer oder sozialer Ressourcen beruhen, auf Gegenseitigkeit angelegt sind und horizontale mit vertikalen Beziehungsmustern verbinden. Allerdings verschoben sich die mit ihnen verbundenen Bewertungen. In der Frühen Neuzeit, so Jens Ivo Engels und Volker Köhler, war Patronage »a priori nicht moralisch anrüchig«. Sie galt »in vielen Fällen als sozial geboten« und befand sich im Einklang mit »weit verbreiteten sozialen Rollenerwartungen«. Punktuelle Kritik entzündete sich immer dann, »wenn die sozialen Erwartungen an Patronage nicht erfüllt werden konnten, wenn Teile eines Begünstigungsnetzwerks den Eindruck erhielten, übervorteilt zu werden, wenn das Ausmaß der patronagebedingten Ungleichbehandlung sozial akzeptierte Grenzen überschritt oder schlicht und ergreifend dann, wenn ein Begünstigungsnetzwerk entmachtet wurde und dessen Gegner Argumente benötigten, um seine Angehörigen zu kritisieren oder vor Gericht zu bringen«.44 Diese ambivalente Bewertung verschob sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts in dem Maß, wie meritokratische oder auf Gleichheit und soziale Durchlässigkeit abhebende Vorstellungen an Bedeutung gewannen. Infolgedessen verschwanden Patronageverhältnisse nicht, wurden aber häufiger beschwiegen oder in implizite Botschaften gepackt. Bis ins frühe 19. Jahrhundert wurden »Fälle von Protektion« dagegen »völlig offen benannt«, wie Stefan Brakensiek für die Karrierebemühungen angehender Amtmänner registriert. Das wiederum deute darauf hin, dass diese Praxis »nicht tabuisiert wurde, weil sie angeblich nur verdienstvollen Männer zugute kam. Im Wahrnehmungshorizont der Zeit ehrte Protektion den Unterstützten, weil ein höhergestellter Mann sich seiner annahm, und sie zeichnete zugleich den Unterstützer aus, weil er beizeiten das junge Talent erkannt hatte.«45 Den Gepflogenheiten der Empfehlungsschreiben ähnelnd, fungierten Patronageverhältnisse als Mechanismus der Stellenbesetzung in Situationen und unter Bedingungen, in denen Fähigkeiten und Eignungskriterien nicht formal festgelegt waren, wenn also Standards und vor allem eine Institution fehlte, »die dem Bewerber bestätigte, dass er gewisse Anforderungen erfüllte oder dass bestimmte Dienste Voraussetzungen für eine spezifische Karriere waren«.46 Allerdings ist zu präzisieren: Der Effekt späterer Formalisierung und Standardisierung von Anforderungen und Qualifikationen besteht nicht zwingend im Bedeutungsverlust von Patronagebeziehungen, sondern zunächst einmal nur in der Neuregelung des infrage kommenden Personenkreises.
Eine Bestimmung für die Zukunft
Die Entstehung der Kulturtechnik der Bewerbung, in jedem Fall aber die Aufwertung und Verallgemeinerung des schriftlichen Gesuchs um Anstellung, spielte sich in einer Umbruchsituation ab. Den entscheidenden Einschnitt brachten die schrittweise Etablierung von Arbeitsmärkten sowie die Prekarisierung der Verhältnisse an der Wende zum 19. Jahrhundert. Der Historiker Reinhart Koselleck hat für die Jahrzehnte um 1800 das seither gängige Etikett der Sattelzeit gefunden. Das meint eine Epoche, in der anhaltende politische, ökonomische und soziale Veränderungen den »Erfahrungsraum«, so ein weiterer Begriff Kosellecks, öffneten. Die politisch-soziale Sprache wie auch die Verhaltensweisen gewannen nun auf die Zukunft gerichtete »Erwartungsmomente, die ihnen früher nicht innewohnten«.47 Es gehört zu den charakteristischen Merkmalen von Übergangsperioden, dass die sozialen und ökonomischen Gegebenheiten oft noch der vorangegangenen Epoche ähneln, während die Wahrnehmungsmuster sich bereits verändert haben. Diese Situation lässt sich nicht zuletzt mittels kulturtechnischer Kompetenzen verarbeiten. In Fortschreibung und Weiterentwicklung der Tradition der Bittschrift wurde die Bewerbung zu einem Instrument, um sich auf prekären Arbeitsmärkten zu behaupten und neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu erschließen. Das dürfte in ähnlicher Weise gewirkt haben, wie die über die Reformperiode des frühen 19. Jahrhunderts hinausweisende bildungspolitische Modernisierung, in deren Folge es nicht mehr als ausgemacht galt, dass die Kinder von Bauern, Tagelöhnern oder Handwerkern immer wieder nur Bauern, Tagelöhner oder Handwerker werden würden.48 Herkunft und Zukunft waren nicht länger dasselbe. Darin liegt eine für moderne Gesellschaften typische Form der Zukunftsaneignung, die auch im Problem der Bewerbung greifbar ist. Mit Blick auf Kosellecks These des Auseinandertretens von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont kann man konkretisieren: Die Notwendigkeit der Bewerbung ergibt sich aus einer Situation, in der die Sicherung eines Ein- und Auskommens nicht mehr wie bisher funktionierte. Anstellungsgesuche waren stets auch ein Versuch, sich mittels eines bestimmten Handelns in der Gegenwart eine zukünftige Beschäftigung zu sichern, weil die bisherige Beschäftigung keine Zukunft mehr zu haben schien. Bewerbungen verknüpfen damals wie heute nicht nur verschiedene Erwerbstätigkeiten, sondern schreiben immer auch bisherige Lebensläufe in eine projektierte Zukunft fort. Bei aller gebotenen Vorsicht gegenüber allzu weitreichenden Folgerungen: Vielleicht wurde das Konzept der Karriere zum lebensweltlichen Gegenstück des auf die Gesellschaft als Ganzes bezogenen Fortschrittsbegriffs, erlaubte doch vor allem das Curriculum Vitae, so eine These des Kulturwissenschaftlers Stephan Strunz, der sich der Literatur- und Wissensgeschichte dieser »kleinen Form« gewidmet hat, die Präsentation des Lebens als Karriere, das heißt als Sequenz aufeinanderfolgender Beschäftigungen und in die Zukunft verlängerbarer Lebenswege. Nicht zuletzt weist der Bedeutungswandel des Begriffs der Karriere selbst in diese Richtung. Seit der Wende zum 19. Jahrhundert verlor er seine pejorativen Konnotationen und bezeichnete nunmehr die Hierarchie von Rängen und Positionen im Verwaltungsdienst sowie berufliches Fortkommen insgesamt. Während der ältere Begriff der Laufbahn mit einer Kreislaufmetaphorik verbunden war und Lebensläufe in der Regel kurz vor dem nahenden Tod, wenn sich der Kreis schloss und der Weg zu Ende ging, verfasst wurden, kristallisierte sich um 1800 mit der »Karriere« ein Verlaufsmodell heraus, das »den Lebenslauf des Subjekts als offen, kontingent und linear vorstellte« und am Grad »beruflichen Erfolgs und Status bemessen wurde«.49 Damit stellt sich die – historisch zu beantwortende – Frage, wie Bewerberinnen und Bewerber ihre bisher ausgeübten und erhofften zukünftigen Beschäftigungen aufeinander bezogen und wie sie in ihren Bewerbungen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verknüpften. Leiteten sie beispielsweise aus ihrem bisherigen Lebenswandel oder bisher geleisteten Diensten Ansprüche, Hoffnungen oder Versprechen für die Zukunft ab? Erhofften sie sich von einer erfolgreichen Bewerbung einen nächsten Karriereschritt oder die Wiederherstellung früherer Zustände, in denen die Zeiten weniger schwer waren? Ein wesentliches Element der modernen Bewerbungskultur besteht jedenfalls darin, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ein spezifisches Verhältnis zu setzen und ein damit verbundenes zeitliches Ordnungsmodell individuell zu verankern.
1Ehrenreich, Qualifiziert und arbeitslos, S. 21.
2Nanz/Siegert, »Vorwort«, S. 7; siehe auch: Maye, »Was ist eine Kulturtechnik?«; Siegert, »Kulturtechnik«.
3Vgl. Macho, »Second-Order Animals«.
4Vgl. Karweick, »Tiefgebeugt von Nahrungssorgen und Gram«, S. 63–68; Saldern, Netzwerkökonomie, S. 245–312.
5Stattdessen konzentriert er sich auf Briefe und Tagebücher (vgl. Lyons, Writing Culture).
6Etwa: Goebel, »Diesterwegs Bewerbung«; Wollny, »Bachs Bewerbung um die Organistenstelle an der Marienkirche zu Halle und ihr Kontext«; ders.: »Über die Hintergründe von Johann Sebastian Bachs Bewerbung in Arnstadt«.
7Mit vornehmlich antiquarischem Interesse: Hohe, »Bewerbung um die freie Ochsenfurter Stadttürmerstelle«.
8Exemplarisch für einen industrie- und unternehmensgeschichtlichen Zuschnitt des Themas: Homburg, Rationalisierung und Industriearbeit. In eine ähnliche Richtung weist Bastian Heins Studie über das Auslese- und Beitrittsverfahren der SS. Hein geht es um die Anwerbestrategien der SS-Führung, also darum, »wie Männer zu einer Bewerbung gebracht wurden«, sowie die Praxis der Auswahl unter den Bewerbern (vgl. Hein, »Himmlers Orden«). Zur Thematisierung von Bewerbungen im Kontext der entstehenden Berufsberatung vgl. Bachem, »Beruf und Persönlichkeit«; Saxer, »Persönlichkeiten auf dem Prüfstand«.
9Vgl. Strunz, Lebenslauf und Bürokratie; ders., »Organizing Careers for Work«; ders., »Turbulente Lebensläufe«. Zum Formwandel des Lebenslaufs zwischen 1950 und den 2010er Jahren vgl. Hamann/Kaltenbrunner, »Biographical Representation«.
10Siehe: Scott, »The Evidence of Experience«.
11Ratgeberformate sind immer wieder Gegenstand der Forschung geworden, zuletzt vor allem für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und mit besonderem Fokus auf Techniken der (neoliberalen) Subjektivierung, etwa im Sinne des Aufstiegs von Selbstoptimierungsanforderungen, ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität, siehe dazu nur einige der jüngeren Beiträge: Bänziger, Sex als Problem; Duttweiler, »Beratung als Ort neoliberaler Subjektivierung«; Maasen u. a. (Hg.), Das beratene Selbst; Traue, Das Subjekt der Beratung. Die Gattung der self-help-Literatur ist in ähnlicher Weise als »strategy for enlisting subjects in the pursuit of self-improvement and autonomy« interpretiert und hinsichtlich der Effekte für die Formierung einer neoliberalen citizenship« befragt worden (dazu: Rimke, »Governing Citizens Through Self-Help Literature«; zu spezifischen Rezeptions- und Lesepraktiken im Umgang mit Selbsthilferatgebern vgl. Lichterman, »Self-Help Reading as a Thin Culture«). Bewerbungsratgebern – eigentlich eine naheliegende erste Frontlinie in Sachen Selbstoptimierung, Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität – wurde in diesem Zusammenhang keine gesonderte Aufmerksamkeit gewidmet.
12Nach wie vor grundlegend: Krusenstjern, »Was sind Selbstzeugnisse?«; Schulze (Hg.), Ego-Dokumente; sowie in kritischer Perspektive: Günther, »And now for something completely different«.
13Vgl. Hahn, »Biographie und Lebenslauf«.
14Vgl. Strunz, Lebenslauf und Bürokratie, S. 5–7.
15Dazu: Baasner, »Briefkultur im 19. Jahrhundert«.
16Die umfangreichen Forschungen zu Petitionen und Suppliken konzentrieren sich auf die Bitte als Form der Ehrerbietung und Verhandlung von Hierarchien, auf die Institutionalisierung von Verfahren der Konfliktregulierung und politische Partizipationschancen, auf Schriftlichkeit und Schriftkompetenz, aber auch auf die damit verbundenen Wertvorstellungen, vgl. Garnier, Kultur der Bitte; Grosse (Hg.), »Denn das Schreiben gehört nicht zu meiner täglichen Beschäftigung«; Mauerer (Hg.), Supplikationswesen und Petitionsrecht; Nubola/Würgler (Hg.), Bittschriften und Gravamina; Tenfelde/Trischler (Hg.), Bis vor die Stufen des Throns; Sokoll (Hg.), Essex Pauper Letters. Bitten um Anstellung wurden bisher nicht eigens thematisiert.
17Davis, Der Kopf in der Schlinge, S. 15. Zur Bedeutung dieses Geschichtenerzählens in einem anderen Kontext siehe: Noiriel, Die Tyrannei des Nationalen, S. 235–242.
18Adelung, Allgemeiner teutscher Briefsteller [1820], S. 247 f. Diese Bestimmung wurde in späteren Auflagen unverändert übernommen.
19Müller, Neuester Briefsteller [1801], S. 89. Der Verweis auf die Notwendigkeit, Herz und Verstand des Adressaten gleichermaßen zu berühren, findet sich in verschiedenen Briefstellern (vgl. Leipziger Briefsteller [1796], S. 242 f.; Schmalz, Haus-Sekretär für die Rheinlande [1834], S. 9).
20Campe, Briefsteller [1852], S. 174 f.
21Aabeck, Großer vollständiger Briefsteller [1921], S. 140 f.
22Rammler, Universal-Briefsteller [1907], S. 155–157.
23Die These einer deutlich früheren Entstehung überzeugt nur dann, wenn man unter dem CV kein eigenständiges, vornehmlich tabellarisches und nicht im engeren Sinn erzählendes Dokument versteht, sondern jede chronologische Abhandlung der Stationen eines Lebens. Was beispielsweise Stephan Strunz als frühe Lebensläufe identifiziert, ist Effekt eines bestimmten heuristisch-methodologischen Verfahrens der Vereinheitlichung. Dieses Verfahren erlaubt es ihm, unterschiedliche Dokumente als »Lebenslauf« zu behandeln und diesen damit als transhistorische Form zu konstruieren (alle Schriftstücke, »in denen der Supplikant mindestens einen Absatz zu seinem beruflichen Werdegang in das Bittschreiben einbaute und die Laufbahn gleichzeitig als Argument für sein Ansuchen verwendete. Fernerhin liegt gemäß meiner Konvention nur dann ein Lebenslauf vor, wenn die Erzählung aus einer narrativen Sequenz von mindestens drei unterschiedlichen zeitlichen Episoden besteht«, Strunz, Lebenslauf und Bürokratie, S. 42). Ich schlage vor, in solchen Fällen eher von Lebenslaufschilderungen zu sprechen und diese zunächst einmal vom CV zu unterscheiden.
24Dazu: Schikorsky, Private Schriftlichkeit im 19. Jahrhundert, S. 110; Ettl, Anleitungen zu schriftlicher Kommunikation, S. 159–176.
25Wolter-Rosendorf, Der neue Briefsteller, S. 98.
26Zitiert nach der Edition bei: Goebel, »Diesterwegs Bewerbung«, S. 59 f.
27Siehe dazu die Beiträge in: Kocka (Hg.), Work in a Modern Society; Leonhard/Steinmetz (Hg.), Semantiken von Arbeit.
28Polanyi, Great Transformation, S. 67 f. Kritisch hinsichtlich Polanyis Verortung der Marktgesellschaft im frühen 19. Jahrhundert: Eisenberg, Englands Weg in die Marktgesellschaft. Eisenberg fokussiert auf Prozesse der »Marktverdichtung«, verstanden als Wechselspiel von Kommerzialisierung und gewerblicher Produktion, seit Mittelalter und Früher Neuzeit. Sie weist darauf hin, dass Geldbeziehungen früh Einzug in den Bereich persönlicher Dienstleistungen gehalten hatten und es weit vor der Industrialisierung zu einer massiven Vergrößerung marktorientierter Klassen (Kaufleute, Rechtsanwälte, Makler usw.) kam. Das mag mit Blick auf die Verbreitung von Markthandeln und kommerzieller Orientierung stimmen, ist aber weit weg von einer Gesellschaft, die über die Notwendigkeit strukturiert ist, auf einem Arbeitsmarkt mit anderen »Arbeitskraftanbietern« um die Gunst verschiedener »Nachfrager« zu konkurrieren.
29Im Detail: Castel, Die Metamorphosen der sozialen Frage.
30Siehe dazu: Engel, »Konzepte ökonomischer Konkurrenz in der longue durée«.
31Dazu und zum Folgenden: Werron, »Wettbewerb als historischer Begriff«; ders., »Form und Typen der Konkurrenz«.
32Simmel, »Soziologie der Konkurrenz«, S. 229.
33Ebd., S. 226 f.
34Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 20.
35Dazu und zum Folgenden: Verheyen, »Liebe, Gehorsam oder Großes leisten?«; dies., Die Erfindung der Leistung.
36Im Detail: Schimank, »Leistung und Meritokratie in der Moderne«.
37Engelsing, »Der Arbeitsmarkt der Dienstboten«, S. 166 f.; siehe auch: Müller-Staats, Klagen über Dienstboten, S. 157–163, 209–235.
38Adlerjung, Theoretisch-praktischer Briefsteller [1790], S. 322–327. Im Bereich des Dienstpersonals war die Kultur der informellen Empfehlungen und Auskünfte derart fest etabliert, dass sich Beispiele dafür noch in Ratgebern der 1920er Jahre finden (vgl. Aabeck, Großer vollständiger Briefsteller [1927], S. 165).
39Adelung, Allgemeiner teutscher Briefsteller [1820], S. 239.
40Siehe etwa: Schleithoff, »Empfehlungsschreiben im deutschen Hochschulsystem«.
41Vgl. Gerlach, »Väter, Söhne, Beziehungen, Netzwerke«. Spätere Ratgeber erinnerten immerhin daran, dass über die Person des Empfohlenen zumindest »soviel gesagt sein« müsse, »als dem Empfänger zu wissen nötig ist, besonders müssen die verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen, in denen der Empfohlene zu dem Empfehlenden steht, deutlich ausgesprochen werden« (Übelacker, Großer deutscher Muster-Briefsteller [1907], S. 24 f.).
42Moritz, »Anleitung zum Briefeschreiben« [1783], S. 69 f. Spätere Musterbriefe variierten die Moritz’schen Vorlagen, ohne sich zu weit davon zu entfernen (vgl. Müller, Briefsteller [1801], S. 74–76).
43Salzmann, Allgemeiner deutscher Briefsteller [1826], S. 101.
44Engels/Köhler, »Moderne Patronage«, S. 45 f. Zur frühneuzeitlichen Patronageforschung vgl. Droste, »Patronage in der Frühen Neuzeit«; Emich u. a., »Stand und Perspektiven der Patronageforschung«; Hengerer, »Amtsträger als Klienten und Patrone?«.
45Brakensiek, Fürstendiener – Staatsbeamte – Bürger, S. 80. So war es beispielsweise für die Karrieren bürgerlicher Juristen im Staatsdienst »ungemein nützlich, wenn sie in den Reihen des Adels Fürsprecher fanden, die entweder selbst in die entscheidenden Ränge einrückten oder zumindest als Mittelsmänner zu Personen in den Spitzenpositionen unentbehrlich waren« (ebd., S. 288 f.).
46Droste, »Die Erziehung eines Klienten«, S. 25.
47Koselleck, »Einleitung«; ders., »Erfahrungsraum und Erwartungshorizont«. Für eine kluge Diskussion dieses Konzepts siehe: Motzkin, »Über den Begriff der geschichtlichen (Dis-)Kontinuität«.
48Vgl. Kuhlemann, Modernisierung und Disziplinierung, S. 57–76.
49Im Detail: Strunz, Lebenslauf und Bürokratie, S. 18–29.
IIDer Begriff der Bewerbung
In der heute selbstverständlichen Bedeutung ist der Begriff der Bewerbung gar nicht so alt. Der heute in erster Linie gemeinte Sachverhalt wurde in der Terminologie des 19. Jahrhunderts als Bitte oder Gesuch um Anstellung beziehungsweise Verleihung einer Stelle angesprochen. Bewerbung hatte dagegen eine weiter gefasste Bedeutung. In Jacob und Wilhelm Grimms Deutschem Wörterbuch1, im ersten Band aus dem Jahr 1854, begegnet uns der Bewerber als »Bewerber um ein Amt«, als »petitor« und »competitor«. Illustriert wird das mit einem Goethe-Vers: »freundlich reicht sie dem Bewerber Kalaf Herz und Hand«. Der Begriff der Bewerbung wiederum wird mit zwei Belegstellen bei Immanuel Kant veranschaulicht, in denen von der »Bewerbung um Glückseligkeit« die Rede ist. Dass es hier auch um eine Positionierung auf einem Arbeitsmarkt gehen könnte, lässt sich nur schwer herauslesen. Lediglich die »Bewerbung um ein Amt« legt eine Spur in diese Richtung. Assoziationen, die der Bewerber als »competitor« in Richtung des heutigen Begriffsverständnisses wecken mag (in Ratgebern und Anstellungsgesuchen wird diese Figur als »Kompetent« regelmäßig wiederkehren), bestätigen sich erst im sehr viel später erschienenen 29. Band des Grimm’schen Wörterbuchs (1960). Darin wird der Bewerber unter den Stichworten des Wettbewerbs und Wettbewerbers als Mitbewerber thematisiert. Wettbewerb wird dabei als sprachliche Neubildung des 19. Jahrhunderts (für das französische concurrence) im Sinn des »Leistungskampfs in Handel und Wirtschaft« vorgestellt.2 Diese Bezüge markieren den Fluchtpunkt einer Begriffsentwicklung, an deren Anfang man sich, so ein Briefratgeber aus dem Jahr 1796, in einem Bewerbungsschreiben »um ein Amt, oder um die Hand oder Gunst und Freundschaft einer Person oder um sonst irgendetwas« bewarb, »wodurch man sich in einer oder der anderen Hinsicht Nutzen und Vortheile und Vermehrung seines Glücks und seiner Zufriedenheit verspricht«.3 Das schloss beispielsweise das »Bewerbungsschreiben eines Candidaten um eine erledigte Amtsschreiberstelle« ein.4 Dieses Verständnis hatte auch Folgen für die Zuordnung der entsprechenden Schreiben zu verschiedenen Briefgattungen. In Claudius’ Allgemeinem Briefsteller (1808) finden sich unter den Vorlagen für Bittschriften keine Anstellungsgesuche, obwohl sie als Beispiel für diese Gattung genannt werden. Stattdessen umfasst das Kapitel zu den Bewerbungsschreiben ein Gesuch um Verleihung einer Verwalterstelle auf einem gräflichen Gut, die Bitte eines Schreibers um Anstellung als Kopist sowie diejenige eines jungen Manns um Anstellung als Rechnungsführer – eingereiht in »Bewerbungen« von Handwerksmeistern um Kundschaft und von jungen Männern um die Hand »lediger Frauenzimmer«.5
Die Wendung »sich um die Hand einer Dame zu bewerben« ist heutigen Leserinnen und Lesern vielleicht noch bekannt. Dass aber alles, was einen Nutzen, Vorteil, vermehrtes Glück oder Zufriedenheit verspricht, umstandslos und ohne jede Hierarchie im Begriff der Bewerbung gefasst wird, dass sich der Begriff über die Aneinanderreihung von – aus heutiger Sicht – sehr verschiedenen Aktivitäten (»er bewarb sich eifrig um ihre Hand, Gunst, Freundschaft, um die Stelle, den Dienst«, wie das Grimm’sche Wörterbuch den Gebrauch des Begriffs illustriert hatte) definieren ließ, dürfte doch irritieren. Unsere heutige Irritation liegt darin begründet, dass es für die Zeitgenossen um 1800 überhaupt nicht irritierend war, Arbeitsmarkt, Dienstverhältnisse und Sozialität, also freundschaftliche oder romantische Beziehungen, gemeinsam zu behandeln. Themen, die inzwischen aus historischer Gewohnheit getrennt gehalten werden, verwiesen um 1800 nicht auf unabhängig voneinander institutionalisierte Sphären. Wirtschaftsbeziehungen waren zu diesem Zeitpunkt stärker in Sozialbeziehungen eingebettet und ihnen untergeordnet.6 Wirtschaftliches Handeln diente der Sicherung des gesellschaftlichen Rangs und Ansehens, und es war auf Reziprozität, auf Gegenseitigkeit, angelegt. Die institutionelle Einrichtung der Gesellschaften folgte diesem Prinzip. Während Reziprozität auf einen Modus sozialer Integration zwischen symmetrischen Gruppen verweist, drängte mit voranschreitender gesellschaftlicher Zentralisierung ein neuer Mechanismus in den Vordergrund: derjenige der Redistribution. Gemeint ist damit, dass privilegierte Gruppen die Verteilung von Gütern und Dienstleistungen zunehmend kontrollierten. Ergänzen ließe sich: auch die Verteilung von Erwerbschancen, solange diese noch nicht ausschließlich einem Arbeitsmarkt überantwortet war. Unter den Voraussetzungen einer hierarchischen Sozialwelt, in der Einzelne über die Aussichten anderer entscheiden, kommt Bittschriften erhebliche Bedeutung zu. »Die verschiedenen Arten von Bittschriften«, so schreiben Cecilia Nubola und Andreas Würgler, setzen in unterschiedlichem Ausmaß »die Anwendung von Verhandlungs- und Tauschstrategien voraus, innerhalb derer der Bittsteller eine aktive Rolle spielt«.7 Diejenigen Bitten, die auf Gewährung einer Anstellung zielen, haben wir als Bewerbungsschreiben zu begreifen gelernt. Die Bitte (um ein Geschenk, eine Gunst, eine Gnade) auf der einen Seite, die Reziprozität von Leistung und Gegenleistung auf der anderen Seite – damit sind die zentralen Modi sozialer Beziehungen im 18. und frühen 19. Jahrhundert umrissen. Beides lässt sich nicht ohne Weiteres mit Marktbeziehungen in Deckung bringen. Als Bitte war die Bewerbung um 1800 nicht nur ein Instrument zur Positionierung auf einem Arbeitsmarkt, sondern vor allem eine Technik der Vergesellschaftung. Begriffsgeschichtlich war sie in ihrer Entstehungsphase eine Kulturtechnik, die auf eine Veränderung der eigenen Position in einem der genannten oder in allen Bereichen des sozialen Lebens zielte, also tatsächlich noch nicht auf ein arbeitsmarktliches Wettrüsten reduziert worden war.
Bitten um Anstellung waren im frühen und mittleren 19. Jahrhundert noch kein eigenes Genre. Dennoch spielten sie in den Ratgebern zum Briefeschreiben eine besondere Rolle. Einerseits verlief eine feine Grenze zwischen Recht und Moral, die sich in der zeitgenössischen Unterscheidung von Bittschreiben und Ansuchen spiegelte.
Der Bittende fühlt seine Abhängigkeit und gründet sein Verlangen auf gar kein Recht, sondern bloß auf sein Bedürfnis und die Liebe des Gebers; derjenige aber, der um etwas ansucht, darf voraussetzen, daß er ein gewisses Recht habe, eine Sache zu verlangen und darum zu bitten; er darf die Erfüllung seines Verlangens von der Verbindlichkeit des Gebers erwarten, die zwar nicht erzwungen werden kann, aber doch auf den Grundsätzen der Billigkeit beruhet. Der Ausdruck Ansuchen wird also in allen solchen schriftlichen Vorstellungen gebraucht, wenn man etwas verlangt, worauf man gegründete Ansprüche machen kann. So bittet z. B. eine arme Witwe um einen Gnadengehalt; ein alter Diener des Staats, den Alter und Schwachheit zur Erfüllung seiner Dienstpflicht unvermögend machen, sucht hingegen um seine Dienstentlassung an. – Um die Ertheilung einer Stelle, eines Amtes bittet man, so lange man kein besonderes Recht hat, es zu begehren; hat man aber schon auf gewisse Weise sich verdient gemacht, wodurch man gleichsam unwiderlegliche Gründe vor sich hat, diese Stelle, dieses Amt verlangen zu können, so sucht man um dasselbe an.8
Andererseits war entscheidend, dass man etwas anzubieten hatte und für den Fall der Gewährung des Gesuchs etwas zu tun in Aussicht stellte. Dafür bürgte man mit seiner Person, seinem Charakter und seinen Fähigkeiten.
Man bewirbt sich um irgend etwas, wenn man sich Mühe giebt, durch schickliche Mittel zu dem Besitze desselben zu gelangen, und sich deswegen derjenigen Person mittelbar oder unmittelbar gefällig zu machen sucht, von welcher man die Erfüllung seines Wunsches zu hoffen oder zu erwarten hat. Aus diesem Begriffe erhellet zwar allerdings, daß diese Gattung von Briefen in die Classe der Bittschreiben zu stellen sey; sich jedoch von diesen dadurch unterscheide, daß man die besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten, welche zur würdigen Erlangung und Behauptung dessen, worum man sich bewirbt, wirklich besitze, so daß derjenige, von dem wir wünschen, daß er sein Augenmerk auf uns richte, in den Stand gesetzt wird, über uns ein günstiges Urtheil zu fällen und unsern Wunsch zu befriedigen, wenn dieses in seiner Willkühr und unbedingten Gewalt stehet. So bittet man z. B. um eine Zulage; eine Wohlthat etc.; aber um die Hand eines Mädchens, um Kundschaft zu erhalten etc. reicht man kein Bittschreiben ein, sondern man bewirbt sich darum.9
In zeitgenössischen Bestimmungen gehörte die Bitte um Erlangung irgendeines Diensts oder Amts ebenso zu den Bittschriften wie Gesuche an den Landesherren, an Ministerien oder an die Regierung. Von Letzteren unterschieden sie sich jedoch dadurch, so Adelungs Allgemeiner teutscher Briefsteller (1820), »daß man nichts dergleichen als reines Geschenk, oder eine Gunst und Gnade begehrt, sondern sich anheischig macht, auch etwas dagegen zu leisten, z. B. Dienste für die Amtsbesoldung, Freundschaft für Freundschaft u. s. w.«10 Dass sich Bittschriften und damit Bewerbungen in einem komplizierten Geflecht aus Hierarchien, gegenseitigen Verpflichtungen, mehr oder weniger begründeten Ansprüchen und Erwartungen bewegten, die noch dazu nicht immer offen angesprochen werden durften, zeigt auch die Bestimmung in einem Ratgeber aus dem Jahr 1835. In einer Bittschrift, so hieß es da, vermeide man alles, was der »Freiheit« des Adressaten nahetreten könnte. Daher sei es »ebenso unzart als unschicklich, sich auf die bestehende Freundschaft, auf schon geleistete Dienste, oder auf zu erweisende Gegengefälligkeiten ausdrücklich zu berufen«. Vor allem aber dürfe man nicht »seine Erkenntlichkeit durch Verheißungen von Dankbarkeit geltend machen«, da damit unterstellt werde, der Adressat der Bitte handle eigennützig oder sei bestechlich.11
Bis in die 1830er Jahre verstand man unter Bewerbungsschreiben weiterhin »solche, wodurch man sich bemüht, zu dem Besitz einer wünschenswerthen Sache, z. B. eines Amtes, einer Kundschaft, der Freundschaft einer Person, der Hand eines Mädchens, eines Anlehens etc. zu gelangen«.12 Wenn eine Engführung stattfand, dann zugunsten der Romantik: »Bewerbungsschreiben«, so eine Definition aus dem Jahr 1838, »werden gewöhnlich nur an Frauenzimmer geschrieben, deren Freundschaft und Liebe man gern besitzen möchte, oder um deren Hand oder nähere Verbindung man sich bewirbt.«13