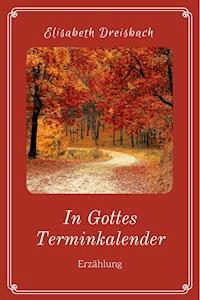
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Elisabeth Dreisbach-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Bilanzen zu ziehen, Termine zu setzen und Ziele zu stecken das ist Gottes Sache, und er erledigt alles recht im geheimen. Damit kann sich die junge Lehrerin Binia Jansen ebenso wenig abfinden wie der Albbauer Christoph Pfisterer. Enkelin und Großvater glauben, mit ihrem scharfen Verstand selber über ihr Leben verfügen zu können. Der Jungbauer Hans-Jörg Ottmar hat sich sein Leben auch anders vorgestellt. Seine Frau Olga heiratete er nicht aus Liebe, sondern weil er sich dazu verpflichtet fühlte. Schon bald muss er erleben, dass die Mutter seiner Kinder sich nicht nur über vieles hinwegsetzt, was ihm als unantastbar gilt, sondern sich auch dem Trunk ergibt. Binia ist dem jungen Bauern von Jugend an zugetan. Darf sie ihren geheimen Wünschen überhaupt noch Raum geben? Hat Gott nicht einen ganz anderen Plan für sie? Und ob der tüchtige, von sich selbst aber auch sehr überzeugte Albbauer am Ende seines Lebens noch zur Einsicht gelangt, dass er ohne Jesus Christus verloren ist? Nicht alle Fragen, die das Leben stellt, können beantwortet werden, und nicht alle Probleme finden in diesem Buch ihre Lösung. Im Leben der verschiedenartigen Menschen wird aber deutlich, dass Gott sich seinen Terminkalender nicht aus der Hand nehmen lässt. Er allein weiß, was für jeden gut ist. Fortsetzung im Buch: Kleiner Himmel in der Pfütze Elisabeth Dreisbach (1904 - 1996) zählt zu den beliebtesten christlichen Erzählerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihre zahlreichen Romane und Erzählungen erreichten ein Millionenpublikum. Sie schrieb spannende, glaubensfördernde und ermutigende Geschichten für alle Altersstufen. Unzählig Leserinnen und Leser bezeugen wie sehr sie die Bücher bewegt und im Glauben gestärkt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In Gottes Terminkalender
Band 23
Elisabeth Dreisbach
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Elisabeth Dreisbach
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-144-2
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Shop: www.ceBooks.de
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Folgen Verlag erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
Folgen Verlag, [email protected]
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen aus dem Folgen Verlag und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de/newsletter
Autor
Elisabeth Dreisbach (auch: Elisabeth Sauter-Dreisbach; * 20. April 1904 in Hamburg; † 14. Juni 1996 in Bad Überkingen) war eine deutsche Erzieherin, Missionarin und Schriftstellerin.
Elisabeth Dreisbach absolvierte – unterbrochen von einer schweren Erkrankung – eine Ausbildung zur Erzieherin in Königsberg und Berlin. Sie war anschließend auf dem Gebiet der Sozialarbeit tätig. Später besuchte sie die Ausbildungsschule der Heilsarmee – der ihre Eltern angehört hatten – wechselte dann aber zur Evangelischen Landeskirche in Württemberg, für die sie in den Bereichen Innere Mission und Evangelisation wirkte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gründete Dreisbach in Geislingen an der Steige ein Heim für Flüchtlingskinder, in dem im Laufe der Jahre 1500 Kinder betreut wurden. Dreisbach lebte zuletzt in Bad Überkingen.
Elisabeth Dreisbach war neben ihrer sozialen und missionarischen Tätigkeit Verfasserin zahlreicher Romane und Erzählungen – teilweise für Kinder und Jugendliche – die geprägt waren vom sozialen Engagement und vom christlichen Glauben der Autorin.1
1 Quelle: wikipedia.org
Inhalt
Titelblatt
Impressum
Autor
In Gottes Terminkalender
Unsere Empfehlungen
In Gottes Terminkalender
Christoph Pfisterer wurde mit der Vergangenheit einfach nicht fertig.
Immer wieder fing er damit an, obgleich Binia alles schon wer weiß wie oft gehört hatte. Wenn der Großvater wenigstens begreifen würde, dass sie nicht stundenlang an seinem Bett sitzen konnte! Sie hatte schon versucht, nebenher die Hefte ihrer Schüler zu korrigieren, war damit aber nicht weit gekommen. Der alte Mann begehrte dann fast eigensinnig auf: „Glaubst du, ich merke nicht, dass du im Grunde gar nicht zuhörst, wenn ich rede?“
Wagte sie zu sagen: „Großvater, das alles hast du mir schon so oft erzählt!“ schwieg er gekränkt, und das tat ihr dann auch wieder leid; denn Binia liebte den alten Mann, den Vater ihrer Mutter, der es nie ganz verwunden hatte, dass seine einzige Tochter den Hof verlassen hatte und nach Berlin gezogen war.
Der Albbauer hatte erst kürzlich sein achtzigstes Lebensjahr vollendet. Sein Geist war aber noch klar und sehr beweglich. Doch litt er oft an schweren Asthmaanfällen. Nach wie vor betrachtete er sich als Herr des Hauses, der er ja auch war; denn außer ihm und einer alten Magd lebte nur noch Binia, seine Enkeltochter, auf dem Hof, seitdem seine Frau Maria gestorben war.
Fast täglich jammerte er darüber, dass er alle seine Felder hatte verpachten und seinen Viehbestand verkaufen müssen. Wer auch hätte dies alles versorgen sollen?
Binia war als Lehrerin und mit einigen anderen Arbeiten im Haus vollständig ausgelastet. Unter keinen Umständen wollte der Großvater, dass sie schwere körperliche Arbeiten verrichtete. Wozu schließlich hatte man sie studieren lassen? Vor allem sollte sie für ihn, den kranken alten Mann, da sein.
Mit Angelika, seiner Tochter, Binias Mutter, war ohnehin nicht mehr zu rechnen. Die blieb – ja, so musste man es wohl sagen – für Zeit und Ewigkeit an ihren Mann, diesen Fanatiker, gebunden. Nur ein Glück, dass sie ihm Binia überlassen hatten, die die Schwäbische Alb als ihre Heimat liebte, obgleich sie in Berlin geboren war. Zum Glück hatte sie nichts von dieser großschnauzigen preußischen Art! Sie war tatsächlich wie ein Kind der Alb, vielleicht nicht so rau, und beschenkt mit einem warmen Herzen. Binia hatte aber auch von ihrem Vater einiges geerbt, der aus dem Osten kam und meist ruhig und gelassen blieb, auch dann, wenn der Schwiegervater ihm in ziemlicher Lautstärke und sehr eindeutig die Meinung gesagt hatte, was im Laufe der Jahre öfter vorgekommen war. Seine Gelassenheit und sein Beherrschtsein hatten den Schwiegervater manchmal geradezu herausgefordert, und er hätte es lieber gesehen, wenn der blonde Ostpreuße Peter ihm in gleicher Weise begegnet wäre. Aber das hatte er nie erlebt, und wenn er an Angelika dachte, konnte er darüber nur froh sein.
Einen aufbrausenden Ehemann hatte sie jedenfalls nicht bekommen. Sie hätte ihn auch nicht ertragen.
Unwillkürlich musste er an seine eigene Frau denken. Als er sie geheiratet hatte, war sie ein lebensfrohes, lustiges Ding von zwanzig Jahren gewesen. Mit der Zeit jedoch wurde sie recht schweigsam – wie die meisten Frauen hier oben auf der Alb. Oder war es seine eigene raue Art gewesen, die das Lachen in ihr zum Erlöschen gebracht hatte? Manchmal traf er sie in den ersten Jahren ihrer Ehe weinend an. In seiner schwerfälligen Art versuchte er sie dann zu trösten: „Nimm das doch nicht so schwer, Maria! Wir von der Rauen Alb haben eben einen rauen Ton. Aber du weißt doch, dass ich es nicht böse meine!“
In seinen Armen hatte sie ihre Tränen getrocknet und ihm zugelächelt. „Weißt du, Christoph, ich bin's halt anders gewöhnt – von daheim! Musst mir eben Zeit lassen!“
Da war er schon wieder hochgefahren. „Daheim – daheim! Immer wieder hör' ich das von dir. Wo bist du denn jetzt daheim? Fang endlich an, dich mit unserer Art abzufinden!“
Er hatte nicht gesehen, dass sie ihm mit traurigen Augen nachblickte, wenn er mit schweren Schritten auf den Hof hinaus oder in den Stall ging. Von ihrem Heimweh nach den Eltern und den kleinen Geschwistern hatte sie gar nichts zu sagen gewagt. Man konnte ihre Ehe nicht unglücklich nennen; doch Maria war immer stiller und zuletzt ganz schweigsam geworden. Ihm schien das ein Zeichen dafür zu sein, dass sie endlich heimisch geworden war. Die Frauen hier oben sprachen alle nicht viel. Wenn es etwas zu reden gab, dann tat es der Mann, und was er anordnete, geschah ohne Widerrede.
Binia hatte sich damit abgefunden, dass sie zum Korrigieren der Hefte erst kam, wenn der Großvater schlief. Sie konnte dem alten Mann keine größere Freude bereiten, als sich jetzt in der Abenddämmerung eine Stunde zu ihm zu setzen.
Plötzlich wurde der alte Pfisterer von dem begonnenen Gespräch abgelenkt. Etwas schien ihn zu beunruhigen. Sein Gesichtsausdruck bewies, dass er gespannt lauschte.
Jetzt war er seiner Sache sicher. „Hörst du's?“ fragte er die Enkelin. „Nun fangen sie schon wieder damit an. Und sie tun es nur, um uns, um vor allem dich zu reizen.“
„Aber Großvater, das kannst du doch nicht behaupten!“
Binia sagte es gegen ihre eigene Überzeugung. Natürlich hatte auch sie den Eindruck, dass Olga Ottmar, die junge Bäuerin vom gegenüberliegenden Hof, ihre Kinder gegen sie aufhetzte und diese alles nur Erdenkliche taten, um sie zu ärgern. Das war auch jetzt der Fall. Sie saßen auf einem Holzstoß vor dem Haus und sangen in den schauerlichsten Tönen ein Lied, das Binia den Kindern im Religionsunterricht beigebracht hatte. In den Kindergottesdienst durften Ottmars Kinder nicht gehen. Die Mutter hatte es ihnen verboten. Aber sie duldete es, ja sie amüsierte sich darüber, wenn die beiden kleinen Mädchen, angestiftet von ihrem zehnjährigen Bruder, absichtlich falsch und in langgezogenen Tönen ein Kirchenlied sangen.
Binia kümmerte sich wenig um diese primitive Art, sie zu reizen. Sie wusste seit Jahren, wie Olga über sie dachte, ja, sie geradezu hasste. Im Grunde war sie ein bedauernswerter Mensch. Wenn nur der Großvater sich nicht immer so maßlos auf regen würde! Sie versuchte, ihn auf alle mögliche Art zu beruhigen und abzulenken, aber es wollte ihr nicht gelingen.
„Hörst du's, Binia? Ich kann es nicht mehr aushalten. Die machen mich noch verrückt! Aber darauf haben sie es ja abgesehen.“
Der alte Mann hatte sich mühsam im Bett aufgesetzt. Seine ausgestreckte Hand zitterte vor Erregung, als er zum Fenster hin deutete, hinüber zum nachbarlichen Hof, wo, unterbrochen von Lachen, Streiten und Weinen, etliche Kinder in möglichst falschen Tönen sangen: „Jesu, geh voran auf der Lebensbahn.“
„Wenn du nicht auf der Stelle hinübergehst, Binia, und es ihnen verbietest, stehe ich auf und schlage Krach. Das ist mehr, als man ertragen kann.“ Der Schweiß stand dem alten Mann auf der Stirn. Seinen erregten Worten folgte ein heftiger Hustenanfall. Er rang nach Luft und fiel dann erschöpft in seine Kissen zurück.
Binia beugte sich über den Kranken. „Aber Großvater, warum regst du dich wieder so auf? Du siehst doch, wie es dir schadet.“
„Wenn sie – wenn sie – wenigstens nicht ein solches Lied singen würden, dieses gottlose Gesindel da drüben! Aber sie tun es nur, um uns zu ärgern!“
Binia wischte dem alten Mann mit dem Tuch den Schweiß von der Stirn, gab ihm seine Medizin und schüttelte ihm die Kissen auf. „Komm, Großvater, trink noch ein wenig von dem guten Holundersaft! Weißt du noch, wie du mir gesagt hast, als ich ein Kind war, vor dem Holunderstrauch müsse man den Hut ziehen, weil man von ihm alles verwenden könne – das Holz, die Blüten und die Früchte – außerdem liegen auch noch Heilkräfte in ihm verborgen.“
Über das Gesicht des alten Mannes huschte ein schwaches Lächeln. Aber es gelang der Enkelin nur für kurze Zeit, den Kranken abzulenken. Das Singen vom gegenüberliegenden Hof war zum Grölen geworden. „… Soll's uns hart ergehn, lass uns feste stehn …“
„Binia, geh! Befiehl ihnen zu schweigen! Auf dich, ihre Lehrerin, werden sie doch hören.“
„Ich fürchte, es wird wenig Sinn haben“, erwiderte diese, „zumal jetzt auch noch Olga hinzugekommen ist. Ich glaube, sie ist schon wieder betrunken.“
Tatsächlich, nun hörte man auch eine lallende Frauenstimme in den abstoßend wirkenden Gesang einstimmen. Aber Singen konnte man das nun wirklich nicht mehr nennen. Ein widerliches Grölen war es.
„Ich bitte dich, geh! Verbiete es ihnen, ehe ich verrückt werde.“
„Aber Großvater! – Gut, ich will gehen und sehen, ob ich etwas erreiche.“ Bei sich selbst aber dachte Binia:
Das Gegenteil wird der Fall sein. Die Olga ist ihrer Sinne nicht mehr mächtig. Mit meinem Dazwischentreten werde ich sie nur reizen.
So versuchte sie es mit einer kleinen List. „Großvater, wolltest du mir nicht erzählen, wie das war, als Mutter von hier nach Berlin ging?“
Tatsächlich, der alte Mann ließ sich ablenken. Binia, die froh war, nicht zum Nachbarhaus gehen zu müssen, ergab sich in ihr Schicksal und hörte die Geschichte aufs Neue, die der Großvater ihr wohl schon zehnmal berichtet hatte.
„Ich meine, ich hätt' es dir schon einmal erzählt“, begann er. „Aber ich kann mich auch irren. In meinem Alter vergisst man manches.“
Binia vermochte ein kleines Lächeln nicht zu unterdrücken. Nichts tat der Großvater lieber, als die Vergangenheit aufleben zu lassen.
Bald verstummte auch das johlende Singen auf dem nachbarlichen Hof, doch wurde es nach einer Weile abgelöst von dem erschreckten Aufschrei der Kinder. „Die Mutter! Die Mutter!“
Weil der Großvater davon nichts zu vernehmen schien und sie ihn nicht unnötig beunruhigen wollte, blieb Binia scheinbar ruhig, in ihrem Innern jedoch war sie mehr als erregt und blickte zum Hof des Jungbauern Ottmar hinüber. Sie sah, dass die junge Frau, die noch vor wenigen Minuten mit den Kindern gejohlt und gespottet hatte, zusammengebrochen war, auf der Erde lag und sich in Krämpfen wand. Wäre nicht Hans-Jörg, aufgeschreckt durch das Schreien der Kinder, aus dem Stall gekommen, Binia hätte sich verpflichtet gefühlt, nach der Frau zu sehen, obgleich sie es möglichst vermied, den nachbarlichen Hof zu betreten.
Hans-Jörg Ottmar, ein breitschultriger, blonder Mann von etwa 33 Jahren, stand für einen Augenblick regungslos vor seiner am Boden liegenden Frau, die von den erschrockenen Kindern umringt war. Ihr Körper wand sich in Zuckungen, Schaum stand vor dem Mund, der Kopf lag weit nach hinten gebogen. Binia sah deutlich, wie sich die Lippen des jungen Bauern zusammenpressten. Auf seiner Stirn zeigte sich eine steile Falte. Seinen Kindern befahl er: „Geht hinein ins Haus! Das ist kein Anblick für euch!“ Bis auf den ältesten Jungen, den zehnjährigen Emilio, gehorchten die Kinder.
Gerade als Hans-Jörg sich niederbeugte, um seine Frau aufzuheben und ins Haus zu tragen, schlurfte eine alte Frau über den Hof und rief, drohend die Faust erhebend: „Lass sie liegen, je eher sie verreckt, desto besser. Das ist die Strafe für ihr frevelhaftes Tun. Sie hat die Kinder dazu aufgewiegelt, über ein heiliges Lied zu spotten.“
Binia vermochte den Worten ihres Großvaters beim besten Willen nicht die volle Aufmerksamkeit zu schenken, zumal sie dies alles ja schon zur Genüge gehört hatte. Unruhig und voller Besorgnis fragte sie sich, ob es nicht doch nötiger wäre, jetzt in den nachbarlichen Hof zu eilen, um Hans-Jörg beizustehen; denn die alte Magd – damit war zu rechnen – würde sich weigern, es
zu tun. Noch nie hatte sie für die junge Bäuerin Sympathie aufgebracht, und sie würde keinen Finger krumm machen, ihr beizustehen. Ja, sie wünschte es wahrscheinlich sogar, dass sie „draufgehe“, wie sie sich unverblümt ausdrückte. Wäre der Jungbauer nicht gewesen, den sie bereits von Geburt an betreute – so lange lebte sie nun schon auf dem Ottmarschen Hof –, sie wäre längst zu ihrer Schwester in den Schwarzwald gezogen, die dort als Ledige ein kleines Haus besaß und seit Jahr und Tag darauf wartete, dass sie, die Sophie, zu ihr käme.
„Ich kann doch nicht mit sehenden Augen dulden, dass der Hans-Jörg ganz im Elend verkommt, Tag und Nacht wie ein Pferd schuftet und dabei im Dreck fast untergeht. Nicht einmal ein gescheites Essen bekommt er vorgesetzt“, hatte sie gesagt. „So halte ich's eben aus und bleibe, so lange es geht.“
Es entsprach der Wahrheit, wenn die alte Magd herumerzählte, dass die Olga Schamblovski – Sophie weigerte sich stur, sie Frau Ottmar zu nennen, obgleich sie schon bald sieben Jahre mit Hans-Jörg verheiratet war – neuerdings Krämpfe bekam, und sie senkte keineswegs ihre Stimme zum Flüstern, als sie fortfuhr: „Dem Suff hat es sich ergeben, das verkommene Weibstück, dem Suff! Außerdem raucht sie wie ein Schlot. Täglich mehr als vierzig Zigaretten, und bezahlen kann es der Hans-Jörg. Wenn die kleinen Mädchen nicht wären, er hätte sich bestimmt schon von ihr scheiden lassen. Manchmal meine ich, er schlägt sie eines Tages noch tot. Zu verwundern wäre es nicht. Ich würde imstande sein, ihm dabei noch zu helfen!“
Ja, so sprach die alte Sophie in ihrem Groll, und Binia erschrak jedes Mal, wenn sie solche rachsüchtigen Aussprüche der sonst friedlichen Magd hörte. Während sie dem umständlichen Erzählen des Großvaters scheinbar ihre Aufmerksamkeit schenkte, eilte sie in Gedanken ihrem Jugendfreund Hans-Jörg zu Hilfe. Aber nein – dieser hatte ihr ja das Haus verboten! Es war vor einem Jahr mit beinahe tränenerstickter Stimme geschehen, und sie wusste genau, dass er nicht aus Überzeugung gesprochen hatte, sondern aus Verzweiflung.
„Hörst du überhaupt, zu?“ fragte der alte Mann, plötzlich misstrauisch geworden. Binia schien ihm keineswegs bei der Sache zu sein.
„Erzähl nur weiter!“
„Na ja, du weißt doch, dass wir es möglich gemacht hatten, deine Großmutter und ich, unsere einzige Tochter, deine Mutter, trotz der damaligen schlechten Zeit in die Stadt auf die Oberschule zu schicken. Als sie geboren wurde, war der Erste Weltkrieg noch nicht zu Ende. Natürlich haben wir in jener Zeit auf dem Lande nicht Hunger leiden müssen, dafür aber die Städter desto mehr. Du darfst mir glauben, dass wir manchem armen Schlucker mit etwas Mehl oder einem Stück Speck ein größeres Geschenk gemacht haben, als wir es mit einem Goldstück hätten tun können. Dafür bekam er damals noch nicht einmal einen Laib Brot. Aber davon wisst ihr Jungen ja nichts, und die meisten wollen es auch gar nicht wissen. Es lebt sich so sicher und bequem im heutigen Überfluss! Und wenn man sagt, dass solche Zeiten wieder kommen könnten, in denen man auch für ein trockenes Stück Brot dankbar ist und wo man sich auf einem Acker gerne bückt, um nach zurückgebliebenen Kartoffeln zu suchen, dann halten sich viele die Ohren zu, weil ihnen solche Gedanken unangenehm sind. Aber eins ist gewiss, Binia, die ganze Unzufriedenheit unserer Jugend, ihre Aufstände und Demonstrationen und was sonst noch alles ist, sind nur darauf zurückzuführen, dass es den Menschen heute zu gut geht. Man lebt zu üppig, man wird immer anspruchsvoller und ist mit nichts mehr zufrieden. Du siehst ja, was sie sich alles leisten können. Kaum ist einer achtzehn Jahre alt, hat er schon seinen eigenen Wagen und sitzt hochnäsig hinter dem Steuer.
Ja, so war das damals nicht. Aber die Angelika hat nie über ihren weiten Weg in die Schule gemurrt. Jeden Morgen ist sie um sechs Uhr mit dem Sohn des Lehrers losgestapft, der auch in der Stadt zur Schule ging, und das jeden Tag, bei Regen und Schnee, bei Frost und hie und da auch bei großer Hitze. Wenn sie einer von den wenigen, die sich mit der Zeit ein Auto zulegten, ein Stück mitgenommen oder gar den Berg hinauf bis ins Dorf gefahren hatte, dann war das ein Fest, das kann ich dir sagen. Aber es kam höchst selten vor.
Immer vergnügt war unsere Angelika. Du weißt ja, dass sie in unserer Gegend den Namen abkürzen und einfach Engel sagen. Es fiel einem nicht schwer, ihr diesen Namen zu geben; denn immer war unser Kind fröhlich und guter Dinge, dabei so liebevoll wie kein anderes. Ob es nun eine alte Frau im Dorf oder ein verwundetes Tier war, ob ein Kind hingefallen war und sich wehgetan hatte, immer war sie zur Stelle, um zu helfen. Kein Wunder, dass dein Vater sich in sie verliebt hat.
Aber dass sie eines Tages uns, deine Großmutter und mich, einmal verlassen würde, um mit diesem wildfremden Menschen aus Ostpreußen in der Weltgeschichte herumzuvagabundieren, nein, das hätte ich meiner Tochter doch nicht zugetraut! Und wenn ich gewusst hätte, wie alles kommen würde, nie hätte ich ihr das Geld und die Erlaubnis gegeben, nach Berlin zu fahren.
In der Schule kam sie gut voran. Immer war Angelika eine der Ersten in der Klasse. Eines Tages ließ mich ihr Klassenlehrer kommen und sagte mir, sie sei ein außergewöhnlich begabtes Mädchen, wir sollten sie doch studieren lassen. Sie würde das Abitur spielend schaffen. Er meinte, sie sollte Lehrerin an einer Oberschule werden.
Na, das wurde mir aber doch zu bunt! Verstehst du das, Binia? Ob er mir sagen könne, habe ich den Lehrer gefragt, wer dann den Hof übernehmen soll? Unser einziger Sohn war ja tödlich verunglückt. Das habe ich dir bestimmt schon einige Male erzählt, dass ihn unser scheu gewordenes Pferd mitgerissen und wer weiß wie weit am Boden geschleift hat. Niemand konnte das Unglück aufhalten. Der Junge starb bald danach an den Folgen des Unfalls.
Aber was erzähle ich alter, geschwätziger Mann Dinge, die du längst weißt! Dass wir danach unsere ganze Hoffnung auf Angelika, deine Mutter, setzten, wirst du verstehen. Großmutter versank immer mehr ins Grübeln. Manchmal war sie direkt schwermütig. Aber seltsam, als Angelika mit der verrückten Idee nach Hause kam, diese Heilsarmee-Ausbildungsschule zu besuchen und später deinen Vater zu heiraten, da hat sie sich für sie eingesetzt. Ich weiß es noch gut, denn es führte damals zu einem regelrechten Streit zwischen uns.
Die Angelika soll tun dürfen, was sie mag und wozu sie Lust hat. Ihr soll es einmal nicht so gehen wie mir, dass sie das Lachen und das Reden verlernt, hat sie gesagt. Stell dir vor, Binia, so etwas hat deine Großmutter mir vorgeworfen! Dabei hat sie auf den schönsten Hof des ganzen Dorfes geheiratet. Natürlich, zu schaffen gab's vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Hier wurde ihr und mir nichts geschenkt. Aber zu beklagen hätte sie sich nicht brauchen. Wenn ich in der Stadt war, habe ich ihr fast immer etwas mitgebracht, mal ein Halstuch, dann eine Schürze. Als andere Frauen von hier oben noch längst keinen Mantel besaßen, sondern mit dem wollenen Dreiecktuch um die Schultern zur Kirche gingen, habe ich meiner Frau einen Mantel gekauft. Jawohl, Binia! Er muss noch im Kleiderschrank hängen – aus schwerem, dunkelbraunem Tuch. Vornehm sah sie darin aus, meine Maria. Die anderen Weiber haben sie darum nicht wenig beneidet.“
Der Großvater brauchte eine kleine Pause. Das Reden fiel ihm nicht leicht, weil das Asthma ihm zu schaffen machte. Die junge Lehrerin schaute verstohlen auf die Uhr.
„Ich glaube, ich sollte jetzt das Abendessen vorbereiten. Danach muss ich unbedingt Hefte korrigieren.“
„Ja, ja! Du hast wohl schon wieder Angst, dass du zu lange bei mir herumsitzt!“ Argwöhnisch blickte der Alte aus seinem Kissen zu der Enkelin. Er wurde immer misstrauischer. „Oder hast du etwas vor, von dem ich nichts wissen soll? Dann sag's am besten nur gleich. Auf einen alten Mann braucht man ja keine Rücksicht zu nehmen.“
„Aber Großvater, was redest du denn da? Ein kleines Weilchen kann ich dir noch zuhören, aber dann ist es höchste Zeit für mich. – Doch schau, da hält ein Auto vor unserem Haus. Tatsächlich, du bekommst Besuch. Es scheint der Pfarrer zu sein. Siehst du, er hat seinen langjährigen Kirchengemeinderat noch nicht vergessen. Ich gehe schnell, um ihn hereinzulassen. Vielleicht bleibt er zum Abendessen und leistet dir nachher noch ein wenig Gesellschaft.“
So wurde es dann auch. Pfarrer Braun, der viele Jahre die kleine Albgemeinde als Seelsorger betreut hatte, lebte seit seiner Pensionierung mit seiner Frau hier oben auf der Höhe, wo er sich am Waldrand, nicht weit vom Dorf entfernt, ein Häuschen hatte bauen lassen. Ohne seinem Nachfolger ins Gehege zu kommen, kümmerte er sich noch besonders um die alten Leute seiner ehemaligen Gemeinde.
Binia war froh. So konnte sie sich ihren notwendigen Arbeiten zuwenden. Rasch hatte sie einen kleinen Tisch an das Bett des Großvaters gerückt, einen Krug Most – anders tat es der alte Mann nicht –, Brot, Wurst, Butter und Käse dazugestellt und den Pfarrer ermuntert, herzhaft zuzugreifen und dem Großvater recht lange Gesellschaft zu leisten.
Pfarrer Braun nickte Binia wohlwollend zu. „Meine Frau ist verreist“, erklärte er. „Sie macht in Ulm einen Besuch bei unserer verheirateten Enkeltochter, die ihr drittes Kind zur Welt gebracht hat. So bin ich Strohwitwer und konnte mich gut frei machen. Im Übrigen hat meine Frau dauernd eine Reihe von Pflichten für mich. ,Vater, würdest du nicht schnell ins Dorf fahren. Auch aus der Apotheke unten in der Stadt müsste etwas besorgt werden.‘ Oder: ,Kannst du im Keller die Kartoffeln aussortieren? Du weißt, dass ich mich mit meinem Rücken so schlecht bücken kann. Nachher wäre im Garten noch Unkraut zu jäten. Würdest du mir dabei helfen?‘ – Ja, ja, Fräulein Binia, ein pensionierter Pfarrer hat auch noch nicht den Himmel auf Erden.“
Binia lachte. „Herr Pfarrer, wenn dem so wäre, würden wir uns wohl mit dem Diesseits begnügen. Aber für immer würde es mir hier gar nicht gefallen.“
„Nanu, nanu! So jung und schon resignieren?“ Scherzhaft drohte der alte Pfarrer der jungen Lehrerin mit dem Finger. „Gründen Sie erst einmal eine Familie, Fräulein Binia. Wenn Sie Mutter und Großmutter geworden sind, dann ist's immer noch Zeit für die Himmelssehnsucht, meinen Sie nicht auch, Herr Pfisterer?“
„Ja, das versuche ich ihr dauernd klarzumachen“, pflichtete der alte Mann im Bett seinem Besuch bei. „Aber die Binia ist eine Hochmütige und Stolze. Keiner ist ihr gut genug. In letzter Zeit hat sie zwei Heiratsanträge bekommen. Ein Bankbeamter aus der Stadt und der Lehrerssohn haben um sie angehalten. Aber nein –“
„Großvater, bitte lass das!“ Errötend versuchte Binia den Redestrom des Alten zu bremsen.
„Na ja, ich bin schon still!“ erwiderte er und griff zum Mostkrug, nachdem er sich mühsam aufgerichtet hatte. „Ein guter Tropfen, Herr Pfarrer, hält Leib und Seele zusammen.“
Binia wusste, jetzt benötigte der Großvater sie eine ganze Weile nicht mehr. Ermüdet, obgleich sie eine Stunde lang nur an seinem Bett gesessen und nichts getan hatte, setzte sie sich an den Schreibtisch in ihrem Zimmer. Das monotone Reden des alten Mannes strengte sie an. Aber sie wusste, dass er sie brauchte. Wer weiß, wie lange sie ihm die Freude des Zuhörens noch bereiten konnte! Er war immerhin 80 Jahre alt. Unwillkürlich fragte sie sich, ob er sich schon einmal bewusst mit dem Gedanken an den Tod auseinandergesetzt hatte. Aus seinem Reden ging das nicht hervor. Im Gegenteil, oft tat er, als habe er noch allerlei Pläne.
„Wenn es mir erst wieder besser geht, dann fliegen wir beide noch einmal nach Hamburg. In etwas mehr als einer Stunde ist man dort. Aber wir schreiben deiner Mutter nicht, dass wir kommen. Wir überraschen sie und den Peter – ich meine deinen Vater. Der traut mir ja doch nicht zu, dass ich das noch wage. Aber nachdem du mir erzählt hast, wie schön das Fliegen ist, will ich mir das nicht entgehen lassen.“
Binia wusste, ihr Vater, der ein Wahrheitsfanatiker ist, hätte an ihrer Stelle geantwortet: Großvater, ich glaube, mit dem Flug nach Hamburg wird es nichts mehr. Solltest du dich nicht langsam auf eine andere Reise vorbereiten?
Vater war ein überzeugter Christ. Seelenrettungsarbeit, das galt als Hauptsache in seinem Leben. Manchmal kam er ihr fast ein wenig fanatisch vor. Aber wenn sie dann wieder sah, mit welch unendlicher Liebe und Geduld er sich um die verkommenen Männer kümmerte, die in dem Obdachlosenheim untergebracht waren, das er leitete, und wie er den Rauschgiftsüchtigen nachging und mit ihnen darüber sprach, dass sie nur durch Jesus Christus von ihrer Gebundenheit frei werden könnten – wenn sie davon hörte, wie er in die Gefängnisse ging und sich um die Strafgefangenen kümmerte und bemüht war, den Entlassenen zu helfen, indem er sie in sein Heim aufnahm und ihnen Stellen vermittelte und auf alle nur mögliche Weise ihnen den Start ins normale Leben zurück zu ermöglichen versuchte –, dann erfüllte sie eine große Dankbarkeit, einen solchen Vater zu haben, und ihre Liebe zu ihm wurde immer inniger, je mehr sie sein Denken und Handeln begriff.
Aber ihr selbst wäre es nicht möglich gewesen, zum Großvater von seinem Tod zu sprechen. Unlängst hatte er ihr verschmitzt lächelnd einen Zeitungsausschnitt gezeigt, auf dem ein Hundertjähriger an seinem Hochzeitstag abgebildet war. Dessen Frau zählte auch schon achtzig Jahre. Sie hatten sich in einem Altersheim kennengelernt und waren von dort in eine eigene Wohnung gezogen, weil die übrigen Heimbewohner ihren Entschluss, in diesem Alter noch zu heiraten, nicht billigten und mit dem gehässigen Gerede nicht aufhörten.
„Siehst du, Binia“, hatte der Großvater gesagt, „ich habe noch Chancen. Ich warte nur, bis du einen Mann gefunden hast, und dann gibt's eine Doppelhochzeit. Was meinst du, wie die im Dorf sich darüber ärgern werden!“
„Aber Großvater“, hatte Binia geantwortet. „Was sagst du nur für unsinnige Sachen! Davon kann doch nicht die Rede sein. Wir beide bleiben ledig, das heißt, ich bleibe ledig, und du schlägst dir solche dummen Gedanken aus dem Kopf.“
Während sie über den Heften ihrer Schüler saß und da und dort Randbemerkungen niederschrieb oder Fehler anzeichnete, aber auch mit Belobigungen nicht sparte, schweiften ihre Blicke immer wieder durchs Fenster zum nachbarlichen Hof hinüber. Vorhin war der Wagen des Arztes aus dem Unterdorf vorgefahren. Ob der Sturz Olga doch geschadet hatte? Wie gerne wäre sie hinübergegangen, um Hans-Jörg ihre Hilfe anzubieten oder ihm wenigstens zu zeigen, dass sie seinen Jammer verstand. Aber er war völlig unansprechbar geworden und hatte ihr in einem Augenblick höchster Erregung zu verstehen gegeben, er wünsche es nicht, dass sie seinen Hof betrete. Fassungslos und mit aufs teigenden Tränen hatte sie damals vor ihm gestanden.
„Hans-Jörg, das sagst du mir? Hast du denn alles vergessen, was einmal war?“
Da hatte er sie angefahren: „Gerade deswegen!“ und ihr den Rücken zugewandt. Hans-Jörg, ihr Kindheitsgespiele und Jugendfreund! Damals wollten in ihr Trotz und Empörung die Oberhand gewinnen: „So geh mit den Deinen eben zugrunde, wenn du dir nicht helfen lassen willst!“ hatte sie gesagt, doch bald hatten bei ihr tiefes Mitleid und erbarmende Liebe gesiegt. Auch jetzt blickte sie mit verschleierten Augen hinüber: Armer, armer Hans-Jörg! Was soll bloß aus alledem werden? Wie lange noch bist du imstande, diese Last zu tragen?
In einem Rähmchen auf ihrem Schreibtisch stand eine Karte. Es war ein Ausspruch von Jochen Klepper. Ihr Vater hatte ihr die Karte gesandt.
Bilanzen zu ziehen, Termine zu setzen und Ziele zu stecken – das ist Gottes Sache, und er erledigt alles recht im geheimen.
Binia Jansen war ein Mensch, der plante. Sie musste organisieren. Nichts ärgerte sie so sehr, als wenn jemand gedankenlos in den Tag hineinlebte. Für sie war eine genaue Einteilung einfach notwendig. Schon als Kind konnte sie heftig und unglücklich werden, wenn ihre Pläne durchkreuzt oder gar zunichte gemacht wurden.
Auch heute noch, wo sie bereits einunddreißig Jahre alt war, hatte sie nicht nur auf dem Schreibtisch einen Terminkalender, sondern schien ihn auch in sich zu tragen.
„Das gehört einfach zur Ordnung!“ pflegte sie zu sagen. Wenn sie ihren Vater als Wahrheitsfanatiker bezeichnete, war es nicht falsch, sie Ordnungsfanatikerin zu nennen. Ob der Vater ihr eine Lektion erteilen wollte, als er ihr diese Karte sandte? Nein, so weit war sie noch nicht, dass sie es allein Gott überlassen wollte, für sie Termine zu setzen und Ziele zu stecken … Plötzlich spürte Binia, wie sie errötete. Erlebte sie es nicht gerade, wie ihre Pläne zunichte gemacht wurden?
In letzter Zeit kam es öfter vor, dass Binia Jansen nachts einige Stunden wach lag. Auch in dieser Nacht konnte sie nicht einschlafen. Nachdem sie mit dem Korrigieren der Hefte fertig geworden war, hatte sie sich noch einmal zu dem Großvater begeben. Dieser musste nach dem Besuch des Pfarrers gleich eingeschlafen sein. Glücklicherweise litt er bisher noch nicht an Schlaflosigkeit, behauptete aber gewöhnlich am Morgen, wenn sie nach ihm sah, dass er die ganze Nacht kein Auge zugetan hatte. Ihn vom Gegenteil zu überzeugen, wäre vergebliche Mühe gewesen.
Sie selbst aber fand dieses Mal auch lange keine Ruhe. In der Tat, was auf der einen Seite als Pluspunkt ihres Wesens zu verzeichnen war, ihre Organisationsfähigkeit und Ordnungsliebe, wurde ihr oft zum Verhängnis. Was nützte es sie denn, sich auszumalen, dass dieses und jenes gut und hilfreich war, wenn es doch nicht zur Ausführung kommen konnte? Wieder dachte sie an Hans-Jörg. Obgleich es sie große Überwindung kosten würde, schon um Olgas willen, aber sie hätte sich selbst besiegt und sich auf dem Nachbarhof einmal über den so dringend notwendigen Großputz gemacht. Aber selbst, wenn Hans-Jörg ihr wie in früheren Zeiten den Zutritt auf den Hof gestattet hätte, Olga würde es nie zugelassen haben –- und wenn sie mit ihren Kindern im Dreck versank.
Die Ungewissheit über ihre Zukunft wollte sich der jungen Lehrerin oft schwer aufs Herz legen. Was sollte werden, wenn der Großvater starb, womit bei seinen schweren Asthma-Anfällen eigentlich täglich zu rechnen war? Selbst wenn er noch einige Jahre leben sollte, war fest damit zu rechnen, dass die kleine Schule hier oben auf dem Berg aufgelöst wurde und alle Kinder täglich mit dem Schulbus in die Stadt hinunterzufahren hatten. Ob sie ebenfalls dort unten eine Anstellung finden würde? Wenn ja, war es dann aber möglich, den alten Mann den ganzen Tag über alleine zu lassen? Jetzt kam sie zwischen der Schulzeit immer wieder auf den Hof, um nach ihm zu sehen. In der Zehnuhrpause, zu Mittag und am Nachmittag erwartete er sie beinahe fieberhaft mit der Uhr in der Hand. Wehe, wenn sie sich auch nur ein wenig verspätete!
„Wo bleibst du denn so lange, Binia?“ konnte er dann vorwurfsvoll fragen. Ihre Gründe mochten noch so dringend sein, er ließ sie nicht gelten. Ja, manchmal war er schon ein richtiger Tyrann. Und doch liebte sie ihn, diesen in seiner Art aufrechten und charakterfesten Mann. Undenkbar, ihn allein zu lassen. Oder blieb sie letzten Endes gar nicht um seinetwillen da? War es nicht ein anderer Grund?
Binia Jansen warf sich in ihrem Bett hin und her. Der Schlaf wollte nicht kommen. Oh, wie sie diese Ungewissheit hasste! Wenn sie doch auch für ihr Leben einen Stundenplan aufstellen könnte, wie es in der Schule gar nicht anders denkbar war!
Aber hieß es nicht, das Wagnis des Lebens einfach auf sich zu nehmen und auf sich zukommen zu lassen, was einem das Leben brachte? Kürzlich hatte ihr eine Frau aus dem Dorf gestanden, dass sie zu einer Wahrsagerin gehen wolle, um den Schleier der Zukunft lüften zu lassen. So direkt hatte sie sich allerdings nicht ausgedrückt, aber trotz ihrer unbeholfenen Art war es Binia bewusst geworden, wie sehr auch diese Frau sich abquälte mit der Ungewissheit ihrer Tage. – „Ich will wissen, ob mein Mann noch eine andere Frau hat. Er kommt jetzt nachts oft sehr spät nach Hause, und ich fürchte, er betrügt mich.“
„Aber Sie werden doch das nicht tun und zu einer Wahrsagerin gehen!“ hatte Binia ihr erschrocken geantwortet. „Sie wissen doch, dass die Bibel es strikt verbietet. Wer sich mit Wahrsagerei und dergleichen abgibt, unterwirft sich satanischen Mächten.“
„Die Bibel!“ hatte die Frau achselzuckend gesagt. „Wer weiß denn, ob das alles stimmt, was darin steht?“
Binia hatte ihr geantwortet: „An die Bibel wollen Sie nicht glauben, aber an das, was so eine Wahrsagerin sagt, die Ihnen das Geld aus der Tasche zieht, glauben Sie.“
Binia hatte erst vor Jahren zur bewussten Hinwendung an Christus gefunden. Vorher war auch ihr der Glaube der Eltern manchmal ein wenig primitiv vorgekommen. Dass dem streng kirchlich eingestellten, herben Albbauer dafür ganz der Sinn fehlte und er das Handeln seiner Tochter und ihres Mannes schwärmerisch, ja wirklichkeitsfremd nannte, konnte sie aus ihrer früheren Lebenshaltung verstehen. Manchmal hatte sie sich die Frage gestellt, wessen Leben vor Gott mehr bleibende Werte aufzuweisen vermochte. Galt ein Bauer, der seine Äcker bebaute und sein Vieh gewissenhaft versorgte, vor Gott nicht ebenso viel wie einer, der sein Leben in den Dienst der Nächstenliebe stellte? Kam es nicht auf die Treue an, darauf, dass man da, wo man lebte, seinen Platz nach besten Kräften ausfüllte? Doch das allein genügte nicht. Binia wusste es wohl.
In dieser nächtlichen Stunde sehnte sie sich wie kaum zuvor nach einem Menschen, mit dem sie die Gedanken, die sie bewegten, durchsprechen konnte – nach einem Menschen, der sie verstand und ihr Heimat bieten würde. Heimat! Hatte sie die nicht bei ihrem Großvater? Es war anzunehmen, dass er ihr einmal den Hof vererben würde. Wer sollte ihn sonst übernehmen? Aber was wollte sie als alleinstehende Frau schließlich mit dem Hof? Sie war bereits über dreißig Jahre alt und noch nicht verheiratet. Gelegenheit dazu hätte sie schon etliche Male gehabt. Unter den Bewerbern waren solche, die ihr finanziell Verlockendes boten. Aber so sehr sie ein Mensch der Planung war, hier ließ sie nicht ihren Verstand sprechen. Eine Eheschließung war letztlich doch keine mathematische Aufgabe. Wenn ihr Herz zu einem solchen Entschluss kein Ja fand, wollte sie lieber ledig bleiben.





























