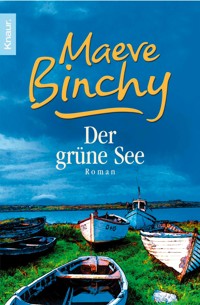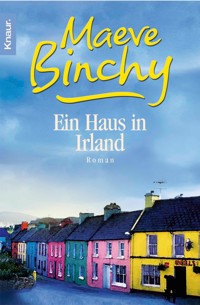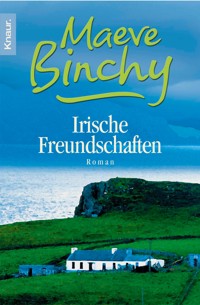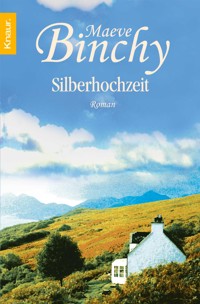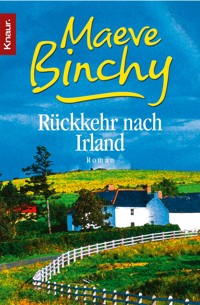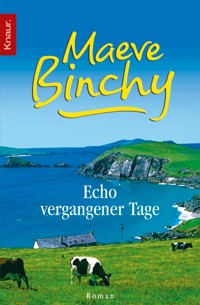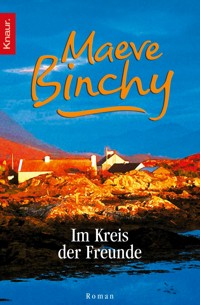6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Aus Irland, Amerika, Deutschland und England sind sie auf die griechische Insel gekommen, um Abstand zu ihrem Leben zu gewinnen: Fiona, die junge Irin, die verzweifelt nach ihrem eigenen Weg im Leben sucht; der Amerikaner Thomas, der schmerzlich seinen geliebten Sohn vermisst; die Deutsche Elsa, die von einer alten Liebe nicht loskommt; und der schüchterne David, der sich ein einziges Mal gegen seinen übermächtigen Vater durchsetzen will. Da ereignet sich eine Tragödie, die sie alle miteinander verbindet und ihnen zeigt, was im Leben wirklich wichtig ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Ähnliche
Maeve Binchy
Insel der Sterne
Roman
Aus dem Englischen von Gabriela Schönberger
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für Gordon, den besten und hilfreichsten aller Ehemänner. Wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich erfinden!Ich danke dir von ganzem Herzen.
Kapitel eins
Andreas war einer der Ersten, die das Feuer unten in der Bucht entdeckten. Er kniff die Augen zusammen und schüttelte ungläubig den Kopf. Nein, so etwas passierte hier nicht, nicht hier in Aghia Anna. Nicht der Olga, dem kleinen rot-weißen Ausflugsboot, das die Touristen hinaus in die Bucht schipperte. Und schon gar nicht Manos, dem verrückten, eigensinnigen Manos, den er bereits als kleinen Jungen gekannt hatte. Das musste ein Traum sein, eine optische Täuschung. Es konnten unmöglich Rauch und Flammen aus der Olga schlagen.
Vielleicht ging es ihm nicht gut.
Einige der älteren Leute aus dem Dorf erzählten hin und wieder, dass sie sich Dinge einbildeten – an heißen Tagen und wenn sie am Abend zuvor zu viel raki, einen scharfen Tresterschnaps, getrunken hatten. Aber Andreas war bereits früh zu Bett gegangen. Und er hatte in seinem Restaurant oben am Berg weder raki getrunken noch bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gesungen.
Andreas schirmte mit der Hand seine Augen ab. In dem Moment zog eine Wolke über den Himmel, der längst nicht mehr so strahlend wie noch kurz zuvor war. Er hatte sich bestimmt getäuscht. Aber jetzt musste er sich wirklich zusammenreißen. Schließlich hatte er ein Restaurant zu führen. Die Leute, die über den steilen Pfad zu ihm heraufkamen, wollten sicher keinen irren Tavernenwirt antreffen, dem die Sonne das Hirn verbrannt hatte und der sich Gott weiß welche Katastrophen in einem friedlichen griechischen Dorf einbildete.
Andreas betrachtete nachdenklich die rot-grünen, abwaschbaren Tischtücher, die mit eckigen Metallklammern an den langen Holztischen auf der Terrasse vor seiner Taverne befestigt waren. Ihm stand ein heißer Tag bevor, mit vielen Gästen zur Mittagszeit. In großen, deutlichen Buchstaben hatte er die Speisekarte auf eine Tafel geschrieben. Er fragte sich oft, wieso er das immer noch tat … es gab ohnehin jeden Tag das Gleiche. Aber seinen Gästen gefiel das, und außerdem schrieb er »Willkommen« in sechs Sprachen darunter. Auch das gefiel seinen Gästen.
Die Gerichte, die er anbot, waren nichts Ausgefallenes, zumindest nichts, das die Touristen nicht auch in einer der zwei Dutzend anderen kleinen Tavernen am Ort hätten bekommen können. Es gab souvlaki und Lamm-Kebab. Eigentlich war es ja Ziegenfleisch, aber den Gästen behagte Lamm besser. Auf der Karte stand auch moussaka, das er heiß und dampfend in einer großen Auflaufform servierte. Und es gab den üblichen griechischen Salat mit großen Stücken von dem salzigen Feta-Käse und saftigen roten Tomaten. Fisch durfte natürlich auch nicht fehlen: barbouni, ganze Meerbarben, die darauf warteten, auf den Grill gelegt zu werden, und Steaks vom Schwertfisch. In der Kühlung lagerten große Bleche voller landestypischer Nachspeisen wie kataïfi und baklava, das aus Nüssen, Honig und einer Art Blätterteig bestand. Der Weinkühlschrank enthielt geharzten Retsina und andere Weine aus der Gegend. Weshalb kamen Touristen aus der ganzen Welt nach Griechenland? Weil ihnen gefiel, was Andreas und andere wie er ihnen hier zu bieten hatten.
Andreas konnte jedem Touristen in Aghia Anna auf den Kopf zusagen, aus welchem Land er kam, und ihn mit ein paar Worten in seiner Sprache begrüßen. Es war ein Spiel für ihn, nachdem er jahrelang die Körpersprache und Gewohnheiten der unterschiedlichsten Nationalitäten studiert hatte.
So mochten die Engländer es nicht, wenn er ihnen eine Speisekarte auf Deutsch hinlegte, und die Kanadier wollten auf keinen Fall mit Amerikanern verwechselt werden. Italiener hassten es, auf Französisch mit bonjour begrüßt zu werden, und seine eigenen Landsleute wollten immer für wichtige Besucher aus Athen und nicht für ausländische Touristen gehalten werden. So hatte Andreas gelernt, erst mal kritisch hinzuschauen, ehe er den Mund aufmachte.
Als Andreas den steilen Pfad entlangschaute, sah er die ersten Gäste des Tages heraufkommen. Er ließ seinen Blick taxierend über sie wandern.
Als Erster kam ein unauffälliger Mann in Shorts, wie sie nur Amerikaner trugen. Sie waren unförmig und wenig schmeichelhaft für Po und Beine, unterstrichen dafür umso mehr die Lächerlichkeit der menschlichen Gestalt. Der Mann war ohne Begleitung und blieb stehen, um durch ein Fernglas auf das Feuer hinunterzusehen.
In kurzem Abstand folgte eine schöne, junge Frau, die auf den ersten Blick als Deutsche zu erkennen war. Sie war groß und braun gebrannt, mit blonden Strähnen im Haar, die entweder von der Sonne oder aber von einem sehr teuren Friseur stammten. Auch sie blieb stehen und blickte schweigend und ungläubig auf die rot und orangefarben züngelnden Flammen, die an dem Boot in der Bucht von Aghia Anna leckten.
Nach ihr kam ein junger Mann, der klein und verloren wirkte und ständig seine Brille abnahm, putzte und wieder aufsetzte. Mit offenem Mund starrte er entsetzt auf das brennende Schiff in der Bucht.
Und schließlich war da noch ein Paar, ebenfalls um die zwanzig, dem die Erschöpfung nach dem Aufstieg deutlich anzusehen war. Entweder Schotten oder Iren, dachte Andreas, doch er musste erst ihren Akzent hören. Der junge Mann bemühte sich mit arrogantem Gesichtsausdruck, den Eindruck zu erwecken, als hätte ihm der Weg auf den Berg nicht die geringste Mühe bereitet.
Als diese fünf Menschen nach oben blickten, sahen sie sich einem hochgewachsenen Mann mit fast vollständig ergrautem Haar und buschigen Augenbrauen gegenüber, der leicht schief dastand.
»Das ist doch das Boot, auf dem wir gestern waren.« Das Mädchen hatte entsetzt die Hand vor den Mund geschlagen. »O mein Gott. Das könnten wir sein.«
»Aber wir sind es nicht. Also reg dich nicht unnötig auf!«, erwiderte ihr Freund grimmig und musterte verächtlich Andreas’ Schnürstiefel.
Und dann drang von unten aus der Bucht das Geräusch einer Explosion zu ihnen herauf, und Andreas konnte sich angesichts der grausamen Endgültigkeit der Erkenntnis nicht mehr verschließen, dass die Olga tatsächlich brannte. Das waren echte Flammen, nicht irgendeine Lichtspiegelung. Die anderen hatten das Feuer schließlich auch gesehen. Andreas konnte nicht länger vorgeben, ein alter Mann mit schlechten Augen zu sein. Plötzlich fing er zu zittern an und musste sich an einer Stuhllehne festhalten.
»Ich muss unbedingt meinen Bruder Yorghis anrufen. Er ist Polizist … Vielleicht wissen die auf dem Polizeirevier ja noch nichts, weil sie das Feuer von unten nicht sehen können.«
»Doch, sie haben es schon entdeckt«, entgegnete der große Amerikaner leise. »Sehen Sie, es sind bereits Rettungsboote auf dem Weg.«
Aber Andreas eilte trotzdem zum Telefon.
Selbstverständlich meldete sich niemand in der kleinen Polizeistation, die oberhalb des Hafens lag.
Das junge Mädchen blickte auf das unschuldig erscheinende blaue Meer hinunter. Die aus dem Boot schlagenden roten Flammen und der dunkel aufsteigende Rauch wirkten wie groteske Farbkleckse auf einem Gemälde.
»Ich kann es nicht glauben«, wiederholte sie ein ums andere Mal. »Gestern erst hat er uns auf diesem Boot noch das Sirtaki-Tanzen beigebracht, auf der Olga, wie er das Schiff nach seiner Großmutter benannt hat.«
»Manos – das ist doch sein Boot, nicht wahr?«, fragte der junge Mann mit der Brille. »Ich bin auch mit ihm gefahren.«
»Ja, das ist Manos«, erwiderte Andreas dumpf. Dieser verrückte Manos. Bestimmt hatte er wie üblich zu viele Passagiere auf sein Schiff gepfercht. Und verpflegen konnte er sie auch nicht richtig. Aber er musste sie ja unbedingt mit reichlich Alkohol abfüllen und zu allem Überdruss auch noch versuchen, auf seinem altmodischen Gascampingkocher Fleischspieße zu braten. Doch von den Dorfbewohnern hätte das nie jemand laut geäußert. Manos hatte hier eine Familie. Deren Mitglieder standen jetzt bestimmt alle unten am Hafen und warteten auf eine Nachricht.
»Kennen Sie Manos?«, fragte der groß gewachsene Amerikaner mit der Brille.
»Ja, natürlich, wir kennen uns hier alle untereinander.« Andreas wischte sich mit der Serviette über die Augen.
Wie versteinert stand die kleine Gruppe da und beobachtete entsetzt, wie sich aus allen Richtungen Boote der Unglücksstelle näherten und versuchten, die Flammen zu löschen, während die Menschen im Wasser um ihr Überleben kämpften, in der Hoffnung, von den kleineren Booten gerettet zu werden.
Der Amerikaner ließ sein Fernglas reihum gehen. Keiner wusste so recht, was er sagen sollte. Zu weit weg, um helfen zu können, waren sie zur Untätigkeit verdammt. Aber sie starrten wie hypnotisiert auf die Tragödie, die sich unterhalb von ihnen auf dem so harmlos aussehenden, strahlend blauen Meer abspielte.
Andreas wusste, dass er sich zusammenreißen und seine Gäste bewirten sollte, doch er konnte den Blick nicht von dem abwenden, was von Manos, seinem Boot und den ahnungslosen Touristen, die zu einem fröhlichen Ausflug aufgebrochen waren, noch übrig war. Irgendwie kam es ihm geschmacklos vor und zeugte seiner Meinung nach nicht gerade von großer Sensibilität, seinen Gästen jetzt seine gefüllten Weinblätter anzupreisen und sie aufzufordern, an den Tischen Platz zu nehmen, die er eben noch gedeckt hatte.
Da legte sich eine Hand auf seinen Arm. Es war die junge blonde Deutsche. »Für Sie muss dieses Unglück ganz besonders schlimm sein – Sie leben schließlich hier«, sagte sie.
Andreas spürte, wie ihm erneut Tränen in die Augen stiegen. Sie hatte recht. Hier war sein Zuhause, hier war er geboren. Er kannte jeden in Aghia Anna, er hatte auch Olga gekannt, Manos’ Großmutter. Und er kannte die jungen Männer, die mit ihren Booten in die Flut ausliefen, um die Opfer zu bergen. Er kannte die Familien, die wartend am Hafen standen. Ja, für ihn war es besonders schlimm. Traurig sah er die junge Frau an.
Ihr Gesicht drückte Mitgefühl aus, aber sie schien auch ein praktisch veranlagter Mensch zu sein. »Wieso setzen Sie sich nicht? Bitte, kommen Sie«, forderte sie ihn freundlich auf. »Wir können ja doch nichts tun, um den Menschen dort unten zu helfen.«
Erst jetzt erwachte er aus seiner Lethargie. »Ich bin Andreas«, stellte er sich vor. »Sie haben recht, noch nie ist mein Dorf von einem so schrecklichen Unglück heimgesucht worden. Ich glaube, auf den Schock hin können wir alle einen Metaxa vertragen. Und dann würde ich gerne ein Gebet für die Menschen dort unten in der Bucht sprechen.«
»Können wir sonst nichts für sie tun?«, wollte der junge Engländer mit der Brille wissen.
»Wir haben ungefähr drei Stunden hier herauf gebraucht. Bis wir wieder ins Dorf kommen, stören wir die Helfer bestimmt nur«, meinte der Amerikaner. »Ich heiße übrigens Thomas, und ich bin der Ansicht, dass es besser ist, nicht den Hafen zu verstopfen. Sehen Sie, da stehen schon Dutzende von Schaulustigen herum.« Mit diesen Worten reichte er das Fernglas weiter, damit alle sich selbst ein Bild von der Lage machen konnten.
»Und ich heiße Elsa«, stellte sich die junge Deutsche vor. »Ich gehe schon mal und hole die Gläser.«
Dann bildeten sie einen Kreis, die Gläser mit der dunkelgelben Flüssigkeit in der Hand, und stießen verlegen im hellen Sonnenschein miteinander an.
Fiona, die junge Irin mit dem roten Haar und der Nase voller Sommersprossen, sagte feierlich: »Mögen ihre Seelen und die aller anderen gläubigen Verstorbenen in Frieden ruhen.«
Ihr Freund zuckte bei diesem Satz unwillig zusammen.
»Was hast du dagegen einzuwenden, Shane?«, rechtfertigte sie sich. »Das ist schließlich ein Segensspruch.«
»Geh in Frieden«, sagte Thomas und deutete auf das Wrack. Mittlerweile waren die Flammen erloschen, und die Helfer machten sich daran, die Überlebenden und die Toten zu bergen.
»L’chaim«, ließ David, der Engländer mit der Brille, sich vernehmen. »Das ist Hebräisch und bedeutet ›auf das Leben‹«, erklärte er.
»Ruhet in Frieden«, fügte Elsa auf Deutsch, mit Tränen in den Augen, hinzu.
»O Theos n’anapafsi tin psyhi tou«, beschloss Andreas die Runde und senkte bekümmert den Kopf, während er einen letzten Blick hinunter auf das größte Unglück warf, das Aghia Anna jemals getroffen hatte.
Seine Gäste bestellten nichts, aber Andreas servierte einfach etwas zu essen. Einen Salat mit Ziegenkäse, eine Platte mit Lammfleisch und gefüllten Tomaten und hinterher noch eine Schüssel Obst. Die jungen Leute fingen zögernd an, von sich zu erzählen und wo sie bisher schon überall gewesen waren. Keiner von ihnen gehörte zur Kategorie der üblichen Zwei-Wochen-Touristen. Sie waren alle länger unterwegs, mindestens ein paar Monate.
Thomas, der Amerikaner, war auf Weltreise und schickte hin und wieder einen Artikel für eine Zeitschrift nach Hause. Er hatte sich für ein einjähriges Sabbatical von seiner Universität beurlauben lassen. Dozenten wie er, die sich Zeit nahmen, die Welt zu sehen und ihren Horizont zu erweitern, waren bei ihrer Rückkehr sehr gefragt, erzählte er. Seiner Meinung nach war es dringend notwendig, dass jeder Universitätslehrer einmal die Gelegenheit hatte, in der Welt herumzureisen und Menschen anderer Nationalitäten kennenzulernen. Sonst bestand immer die Gefahr, dass sein Horizont nicht über die internen Probleme der eigenen Universität hinausreichte. Aber aus irgendeinem Grund wirkte der junge Amerikaner ziemlich abwesend bei seiner Erzählung, dachte Andreas, so, als wünschte er sehnlich etwas herbei, das er in Kalifornien zurückgelassen hatte.
Bei Elsa, der jungen Deutschen, lag die Sache anders. Sie schien nichts zu vermissen. Im Gegenteil. An einem bestimmten Punkt ihres Lebens war sie offensichtlich ihrer Arbeit überdrüssig geworden und hatte erkannt, dass das, was sie früher für so wichtig gehalten hatte, in Wirklichkeit nur seicht und hohl war. Sie hatte genügend Geld gespart, um sich ein Jahr reisen leisten zu können. Seit drei Wochen war sie nun unterwegs und wollte Griechenland am liebsten gar nicht mehr verlassen.
Fiona, die kleine Irin, schien sich ihrer Sache nicht ganz so sicher zu sein. Immer wieder blickte sie, um Bestätigung heischend, zu ihrem missgelaunten Freund hinüber und erklärte stockend, dass sie auf der Suche seien nach einem Ort, wo die Menschen keine Vorurteile hätten und nicht versuchen würden, sie ständig zu verbessern oder gar zu verändern. Ihr Freund äußerte sich nicht dazu, weder zustimmend noch ablehnend, sondern zuckte nur die Schultern, als würde ihn das alles grenzenlos langweilen.
David schließlich wollte einfach nur die Welt kennenlernen und vielleicht irgendwo seinen Platz im Leben finden, solange er noch jung genug war und wusste, was er wollte. Nichts war trauriger als ein Mensch, der um viele Jahrzehnte zu spät das fand, was er sein Leben lang gesucht hatte, oder der keinen Mut zur Veränderung aufbrachte, weil er gar nicht wusste, welche Möglichkeiten er hatte. David war erst seit einem Monat auf Entdeckungsreise, hatte aber bereits viele Eindrücke gesammelt.
Doch während sie sich Anekdoten über ihr Leben in Düsseldorf, Dublin, Kalifornien und Manchester erzählten, fiel Andreas auf, dass nicht einer ein Wort über seine Familie verlor, die sie zu Hause zurückgelassen hatten.
Also erzählte er ihnen von seinem Leben in Aghia Anna. Wohlhabend sei das Dorf mittlerweile im Vergleich zu seiner Kindheit, als noch keine Touristen hierhergekommen waren und die Bewohner ihren Lebensunterhalt im Olivenhain oder beim Ziegenhüten in den Bergen hatten verdienen müssen. Er erzählte ihnen von seinen Brüdern, die schon lange nach Amerika ausgewandert waren, und von seinem Sohn, der nach einem heftigen Streit vor neun Jahren das Restaurant verlassen hatte und niemals mehr zurückgekommen war.
»Und worum ging es bei diesem Streit?«, wollte die kleine Fiona mit den großen grünen Augen wissen.
»Ach, er wollte hier einen Nightclub aufmachen, und ich nicht – die übliche Auseinandersetzung zwischen Alter und Jugend, zwischen Veränderung und Beständigkeit.« Traurig zuckte Andreas die Schultern.
»Hätten Sie denn einen Nightclub aus Ihrer Taverne gemacht, wenn das bedeutet hätte, dass er zu Hause geblieben wäre?«, fragte Elsa.
»Ja, heute würde ich das tun. Hätte ich gewusst, wie einsam man sein kann, wenn der einzige Sohn in Chicago lebt, auf der anderen Hälfte der Erdkugel – nicht ein Mal hat er mir geschrieben – ja, dann hätte ich jetzt einen Nightclub. Aber damals wusste ich das nicht.«
»Und was ist mit Ihrer Frau?«, erkundigte sich Fiona. »Hat sie Sie denn nicht angefleht, Ihren Sohn zurückzuholen und seine Pläne zu verwirklichen?«
»Zu dem Zeitpunkt war sie bereits gestorben. Es war also keiner mehr da, der Frieden zwischen uns hätte stiften können.«
Verlegenes Schweigen senkte sich auf die Runde. Die Männer nickten verständnisvoll, während die Frauen nicht zu wissen schienen, wovon Andreas sprach.
Die nachmittäglichen Schatten wurden länger. Andreas servierte griechischen Kaffee in kleinen Tassen. Kein Einziger seiner Gäste schien es eilig zu haben, wieder hinunter an den Hafen zu kommen, wo sich grässliche Szenen abspielten, die sie von seiner Taverne hoch oben am Berg mitansehen mussten. Tod und Verderben hatten sich über einen von Sonne durchfluteten Tag gelegt. Mit Hilfe des Fernglases wurde das kleine Grüppchen oben am Berg Zeuge, wie leblose Körper auf Bahren gelegt wurden und wie die wartenden Menschen hin und her liefen und einzelne Leute sich vordrängten, um in Erfahrung zu bringen, ob ihre Familienangehörigen tot oder lebendig waren. Doch hier oben auf dem Berg konnten sich Andreas’ Gäste sicher fühlen. Hier hatte sie das Schicksal zusammengeführt, und obwohl sie nichts voneinander wussten, sprachen sie miteinander wie alte Freunde.
Sie unterhielten sich immer noch miteinander, als die ersten Sterne am Himmel erschienen.
Unten im Hafen flammten die Blitzlichter der Fotoapparate auf, und diverse Fernsehteams dokumentierten das Unglück, um die Welt darüber zu informieren. Die Nachricht von der Tragödie hatte rasch ihren Weg in die Medien gefunden.
»Das ist nun mal ihre Arbeit, schätze ich«, seufzte David resigniert. »Aber irgendwie ist es doch makaber, aus dem Unglück anderer Profit zu schlagen.«
»Es ist ungeheuerlich, glaub mir. Das ist mein Beruf, oder besser gesagt, er war es«, warf Elsa ein.
»Bist du Journalistin?«, wollte David interessiert wissen.
»Ich habe lange eine Nachrichtensendung moderiert. Genau jetzt in diesem Augenblick sitzt an meinem Schreibtisch im Studio ein anderer Moderator und stellt einem Reporter vor Ort unten im Hafen telefonisch die üblichen Fragen: Wie viele Tote wurden geborgen? Wie ist das Unglück passiert? Sind Deutsche unter den Opfern? Aber was du sagst, das stimmt – es ist makaber. Ich bin froh, nicht länger ein Teil davon zu sein.«
»Und trotzdem muss man die Menschen über Kriege und Hungersnöte informieren. Wie sollen wir sonst dagegen angehen?«, fragte Thomas.
»Wir werden diese Zustände nie stoppen können«, erwiderte Shane. »Dabei geht es doch immer nur um Geld. Mit Kriegen und anderen Katastrophen ist viel Geld zu machen. Nur deshalb gibt es sie, und Geld ist der Grund für alles auf dieser Welt.«
Shane war ganz anders als die anderen, dachte Andreas. Er wirkte abweisend und ruhelos und schien sich zu wünschen, weit weg zu sein. Aber schließlich war er noch jung, und da war es nur natürlich, dass er mit seiner hübschen kleinen Freundin Fiona am liebsten allein gewesen wäre, statt an einem brütend heißen Tag mit einer Gruppe Fremder oben am Berg zu diskutieren.
»Nicht alle sind ausschließlich an Geld interessiert«, wandte David milde ein.
»Ich behaupte ja nicht, dass jeder geldgierig ist. Ich sage nur, dass Geld die Triebfeder für alles ist, sonst nichts.«
Fiona warf einen verzweifelten Blick in die Runde, als würde sie diese Argumente bereits zur Genüge kennen. Trotzdem verteidigte sie Shanes Ansichten mit einem entschuldigenden Lächeln. »Shane meint doch nur, dass das System nun mal so funktioniert. Weder in seinem noch in meinem Leben spielt Geld eine große Rolle. Ich würde ganz sicherlich nicht als Krankenschwester arbeiten, wenn es mir nur ums Geld ginge.«
»Du bist Krankenschwester?«, fragte Elsa.
»Ja, und ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich unten an der Unglücksstelle nicht von Nutzen sein könnte, aber ich vermute …«
»Fiona, du bist keine Ärztin, die unter primitivsten Umständen in einem Café am Hafen irgendwelche Gliedmaßen amputiert«, wandte Shane höhnisch grinsend ein.
»Aber irgendetwas könnte ich doch bestimmt tun«, widersprach sie.
»Jetzt überschätz dich mal nicht, Fiona. Was willst du denn machen? Den Leuten auf Griechisch sagen, dass sie Ruhe bewahren sollen? Ausländische Krankenschwestern sind in Krisenzeiten nicht viel wert.«
Fiona errötete heftig.
Elsa kam ihr zu Hilfe. »Wenn wir jetzt unten am Hafen wären, wärst du bestimmt von unschätzbarem Wert, aber bis wir wieder hinunterkommen, dauert es zu lange. Deshalb halte ich es für besser, hier oben zu bleiben und den Helfern nicht im Weg herumzustehen.«
Thomas musste Elsa nach einem Blick durch seinen Feldstecher zustimmen. »Wahrscheinlich würdest du gar nicht bis zu den Verletzten durchkommen«, versicherte er Fiona. »Überzeug dich selbst von dem Chaos dort unten.« Er reichte ihr das Fernglas. Ihre Hände zitterten, als sie auf den Hafen und die Menschen hinunterblickte, die kreuz und quer durcheinanderliefen.
»Ja, du hast recht, ich sehe es«, antwortete Fiona kleinlaut.
»Es ist bestimmt ein gutes Gefühl, Krankenschwester zu sein. Dir kann wahrscheinlich nichts mehr Angst machen«, fuhr Thomas fort und bemühte sich, Fiona etwas aufzuheitern. »Außerdem ist es ein toller Beruf, auch wenn man lange arbeiten muss und viel zu wenig Geld dafür bekommt. Meine Mutter ist übrigens auch Krankenschwester.«
»Hat sie auch gearbeitet, als du noch klein warst?«
»Ja, und sie wird wahrscheinlich nie damit aufhören. Sie hat mich und meinen Bruder an die Universität geschickt, damit wir was Ordentliches lernen konnten. Jetzt versuchen wir, es ihr zu danken, indem wir ihr einen ruhigen Lebensabend bieten, aber sie kann einfach nicht mit dem Arbeiten aufhören. Sagt sie.«
»Was hast du nach dem College gemacht?«, wollte David wissen. »Ich habe einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, habe aber bisher nichts damit anfangen können.«
»Ich unterrichte an der Universität Literaturgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts«, erwiderte Thomas zögerlich und zuckte entschuldigend die Schultern, als wäre das keine großartige Sache.
»Und was machst du, Shane?«, fragte Elsa.
»Wieso willst du das wissen?«, sagte er und starrte sie misstrauisch an.
»Keine Ahnung, vielleicht weil ich es gewohnt bin, Fragen zu stellen. Aber alle anderen haben erzählt, was sie beruflich machen. Vielleicht wollte ich nicht, dass du dich ausgeschlossen fühlst.« Elsas Lächeln war unwiderstehlich.
Shane entspannte sich. »Klar. Also, ich bin auf verschiedenen Gebieten tätig.«
»Ich verstehe.« Elsa nickte, als hätte sie die Antwort völlig zufriedengestellt.
Auch die anderen nickten verständnisvoll.
In dem Moment meldete sich Andreas zu Wort. »Meiner Meinung nach solltet ihr zu Hause anrufen und sagen, dass es euch gut geht und dass ihr am Leben seid.«
Erstaunt sahen ihn alle an.
»Wie Elsa gesagt hat – die werden das Unglück heute Abend garantiert im Fernsehen zeigen«, erklärte Andreas. »Und alle werden es sehen. Wenn eure Leute zu Hause wissen, dass ihr hier in Aghia Anna seid, haben sie bestimmt Angst, dass ihr ebenfalls auf Manos’ Boot gewesen sein könntet.«
Andreas sah die fünf jungen Menschen aus unterschiedlichen Familien, mit unterschiedlicher Herkunft und aus unterschiedlichen Ländern fragend an.
»Mein Handy funktioniert hier aber nicht«, wiegelte Elsa ab. »Ich habe vor ein paar Tagen schon mal versucht, damit zu telefonieren. Umso besser, habe ich mir gedacht, dann kann mich wenigstens niemand erreichen.«
»In Kalifornien schlafen sie um diese Zeit noch«, sagte Thomas.
»Und ich würde nur dem Anrufbeantworter was erzählen können. Die sind um diese Zeit bestimmt bei irgendeiner Veranstaltung«, erklärte David.
»Und ich würde nur wieder die üblichen Vorwürfe zu hören bekommen. Das hätte ich nun davon, meinen sicheren Job hinzuwerfen und stattdessen lieber in der Welt herumzugondeln«, meinte Fiona.
Nur Shane sagte nichts. Ihm schien der Gedanke, zu Hause anzurufen, geradezu absurd zu erscheinen.
Andreas stand auf, um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen. »Glaubt mir, ich mache mir jedes Mal Sorgen und frage mich, wie es Adoni geht, wenn ich von einer Schießerei, einer Überschwemmung oder sonst einer Katastrophe in Chicago erfahre. Es würde mich sehr erleichtern, wenn er mich dann anrufen würde … nur eine kurze Nachricht, dass alles in Ordnung ist. Mehr würde ich ja gar nicht wollen.«
»Er hieß Adoni?«, fragte Fiona verwundert. »So wie Adonis, der Gott der Schönheit?«
»Er heißt immer noch Adoni«, verbesserte sie Elsa.
»Und? Ist er denn auch ein Adonis? Was die Frauen angeht, meine ich?«, wollte Shane grinsend wissen.
»Keine Ahnung, ich erfahre ja nichts von ihm«, erwiderte Andreas mit traurigem Gesicht.
»Weißt du was, Andreas … Wir dürfen doch du sagen, oder? Also, du bist ein Vater, der wirklich Anteil am Leben seiner Kinder nimmt. Das tun nicht viele Väter«, erklärte David.
»Alle Eltern nehmen Anteil am Leben ihrer Kinder. Sie zeigen es nur auf verschiedene Weise.«
»Und manche von uns haben keine Eltern mehr«, warf Elsa mit dünner Stimme ein. »Wie ich. Mein Vater hat sich schon vor langer Zeit aus dem Staub gemacht, und meine Mutter ist früh gestorben.«
»Aber irgendjemanden muss es doch in Deutschland geben, dem du am Herzen liegst«, sagte Andreas, bereute seine Bemerkung aber gleich wieder, da er befürchtete, zu weit gegangen zu sein. »Wie gesagt, das Telefon steht drinnen am Tresen … Ich mache uns jetzt eine schöne Flasche Wein auf, und dann stoßen wir darauf an, dass es uns allen vergönnt ist, heute Abend unter diesem Sternenhimmel zusammenzusitzen und noch hoffen und träumen zu dürfen.«
Mit diesen Worten ging Andreas ins Haus.
Von drinnen konnte er hören, wie die jungen Leute beratschlagten.
»Ich glaube, er will tatsächlich, dass wir zu Hause anrufen«, sagte Fiona.
»Du hast doch gerade erzählt, was du dann zu hören bekommst«, wandte Shane ein.
»Vielleicht sollten wir die Sache nicht dramatisieren«, versuchte Elsa die Wogen zu glätten.
Aber dann schauten sie wieder auf das Treiben unten im Hafen, und daraufhin fiel ihnen kein Argument mehr ein.
»Dann mache ich den Anfang«, meldete sich Thomas und ging ins Haus.
Andreas stand am Tresen und polierte Gläser, während sie telefonierten. Ein merkwürdiges Grüppchen, das sich heute in seiner Taverne eingefunden hatte. Keiner schien ein gutes Verhältnis zu den Menschen zu haben, die sie anriefen. Alle hörten sich an, als versuchten sie, sich aus einer misslichen Lage zu befreien und vor etwas davonzulaufen.
Thomas sprach mit harter, abgehackter Stimme. »Ja, ich weiß, dass er im Zeltlager ist … nein, ist nicht so wichtig … Glaub mir, ich hatte keinerlei Hintergedanken. Shirley, bitte, ich versuche nicht, dir Ärger zu machen, ich wollte nur … In Ordnung, Shirley, denk, was du willst. Nein, ich habe noch keine Pläne.«
David klang besorgt. »Dad, du bist zu Hause? Klar, natürlich ist das in Ordnung. Ich wollte dir nur über diesen Unfall Bescheid geben … nein, ich bin nicht verletzt … nein, ich war nicht auf dem Boot.« Er verstummte. »Ganz recht, Dad. Grüße bitte Mutter von mir. Nein, sag ihr, dass ich noch nicht weiß, wann ich wieder zurückkomme.«
Fionas Gespräch drehte sich nur am Rande um das Schiffsunglück. Sie schien überhaupt nicht zu Wort zu kommen. Wie Shane vorhergesagt hatte, ging es nur darum, sie zur Rückkehr zu bewegen. »Ich kann dir jetzt noch keinen festen Termin nennen, Mam. Das haben wir doch schon tausend Mal besprochen. Wo er hingeht, geh auch ich hin, Mam. Du musst dir selbst überlegen, was du tust. Das wäre für alle Beteiligten besser.«
Elsas Telefonate waren ein Rätsel für Andreas, obwohl er Deutsch sprach und sehr gut verstand. Sie hinterließ zwei Nachrichten auf Anrufbeantwortern.
Die erste Nachricht ließ auf ein herzliches Verhältnis schließen. »Hallo, Hannah, ich bin’s, Elsa. Ich bin in Griechenland, in einem sagenhaft schönen Ort namens Aghia Anna. Hier hat sich heute ein schreckliches Bootsunglück ereignet. Direkt vor unseren Augen. Es gab viele Tote. Ich kann dir gar nicht sagen, wie traurig das ist. Aber für den Fall, dass du Angst hast, ich könnte auch darunter sein … nein, ich habe Glück gehabt. Ach, Hannah, du fehlst mir so – du und deine starke Schulter zum Ausweinen. Aber momentan weine ich nicht mehr so viel, also habe ich wahrscheinlich das Richtige getan, als ich wegfuhr. Wie immer wäre es mir lieber, wenn du nicht erzählen würdest, dass du von mir gehört hast. Du bist so eine gute Freundin – ich verdiene dich gar nicht. Aber ich verspreche dir, ich melde mich bald wieder.«
Dann wählte Elsa eine zweite Nummer, und dieses Mal klang ihre Stimme eiskalt. »Ich habe das Bootsunglück überlebt. Aber du weißt, es gab Zeiten, da hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn es mich erwischt hätte. Ich schau mir meine E-Mails übrigens nicht an, also spar dir die Mühe. Es gibt nichts mehr, das du tun oder sagen könntest. Du hast bereits alles gesagt und getan. Ich rufe dich auch nur deswegen an, weil das Studio bestimmt hofft, dass ich verbrannt bin auf diesem Ausflugsboot oder aber dass ich jetzt am Hafen stehe und darauf brenne, einen Augenzeugenbericht zu drehen. Aber ich bin kilometerweit weg davon. Auch von dir. Und das allein zählt, glaub es mir.«
Als Elsa den Hörer auf die Gabel legte, sah Andreas Tränen auf ihrem Gesicht.
Kapitel zwei
Andreas hatte das Gefühl, dass seine Gäste am liebsten bei ihm geblieben wären. Hier auf seiner Terrasse fühlten sie sich sicher, weit weg von der Tragödie, die sich unterhalb von ihnen abspielte. Und weit weg von dem unglücklichen Leben, das sie offenbar zu Hause zurückgelassen hatten.
Wie so oft in schlaflosen Nächten dachte er darüber nach, was es war, das Familien zusammenhielt oder trennte. War es nur der Streit wegen des Nachtklubs gewesen, der Adoni aus dem Haus getrieben hatte? War es wirklich das Bedürfnis gewesen, frei zu sein, neue Wege zu gehen? Stünde er noch einmal vor dieser Entscheidung, wäre er dann offener und entgegenkommender und würde er seinen Sohn darin bestärken, sich erst mal in der Welt umzusehen, bevor er sesshaft wurde?
Genau das taten diese jungen Menschen hier, und trotzdem hatten alle Probleme zu Hause. Das hatte er ihren Gesprächen entnehmen können. Andreas stellte ihnen eine Flasche Wein auf den Tisch und zog sich in die Dunkelheit zurück, wo er ihrer Unterhaltung lauschte und sein komboloi, die traditionelle Perlenschnur der griechischen Männer, durch die Finger gleiten ließ. Mit fortschreitendem Abend und Weinkonsum wurden seine Gäste immer lockerer und ihre Zungen gelöster. Sie schienen geradezu froh zu sein, sich ihre Probleme von zu Hause von der Seele reden zu können.
Die arme kleine Fiona war am mitteilsamsten.
»Du hattest recht, Shane … Ich hätte nicht anrufen sollen. Damit habe ich ihnen nur wieder Gelegenheit gegeben, mir zu erklären, wie chaotisch mein Leben ist und dass sie ihre Silberhochzeit erst dann planen können, wenn sie wissen, wo ich zu dem Zeitpunkt bin. Fünf Monate sind es noch bis dahin, aber meine Mutter, die normalerweise schon diesen chinesischen Fraß zum Bestellen für ein Festmenü hält, macht sich bereits jetzt Gedanken wegen der Feier! Ich habe ihr gesagt, dass ich keinen blassen Schimmer habe, wo ich dann sein werde. Und ihr fällt nichts Besseres ein, als in Tränen auszubrechen. Sie weint doch tatsächlich wegen einer Party. Die Leute unten im Hafen haben wirklich Grund zum Weinen. So etwas kann einen krank machen.«
»Das habe ich dir doch gesagt.« Shane zog an dem Joint, den er und Fiona sich teilten. Die anderen hatten abgelehnt.
Andreas rümpfte die Nase, aber jetzt war nicht der Zeitpunkt, sich zum Moralisten aufzuschwingen.
»Mir ging es auch nicht viel besser«, sagte Thomas stockend. »Mein kleiner Sohn Bill, der Einzige, dem ich vielleicht noch etwas bedeute, war nicht zu Hause. Und meine Exfrau, die mich liebend gerne auf Manos’ Boot hätte ersaufen sehen, war alles andere als erfreut über meinen Anruf. Aber wenigstens schaut sich der Kleine noch keine Nachrichten an und macht sich Sorgen um mich«, fügte er resigniert hinzu.
»Woher soll er denn überhaupt wissen, dass du hier in dieser Gegend bist?« Shane schien die Telefonate nach Hause generell für eine Zeitverschwendung zu halten.
»Ich habe den beiden ein Fax mit meinen Telefonnummern geschickt, und Shirley sollte es eigentlich an das schwarze Brett in der Küche hängen.«
»Und, hat sie?«, fragte Shane.
»Sie hat es jedenfalls gesagt.«
»Hat dein Sohn schon angerufen?«
»Nein.«
»Dann hat sie es auch nicht aufgehängt.« Für Shane war der Fall klar.
»Wahrscheinlich nicht, und wahrscheinlich wird sie auch meine Mutter nicht anrufen.« Ein harter Ausdruck trat auf Thomas’ Gesicht. »Ich hätte stattdessen lieber gleich meine Mutter anrufen sollen. Aber ich wollte Bills Stimme hören, und dann habe ich mich so über Shirley geärgert …«
Schließlich meldete sich David zu Wort. »Eigentlich habe ich damit gerechnet, wieder mal eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen zu dürfen – aber meine Eltern waren tatsächlich zu Hause, und mein Vater ging sogar dran … Und er sagte … er fragte, warum ich überhaupt anrufen würde, wenn mir nichts passiert ist.«
»Das hat er bestimmt nicht so gemeint«, warf Thomas beschwichtigend ein.
»Du weißt doch, dass die Leute vor lauter Erleichterung immer das Falsche sagen«, fügte Elsa hinzu.
David schüttelte den Kopf. »Verlasst euch darauf, er hat es so gemeint. Er hat es wirklich nicht verstanden, und ich konnte noch hören, wie meine Mutter aus dem Wohnzimmer rief: ›Frag ihn wegen der Preisverleihung, Harold. Kommt er heim?‹«
»Was für ein Preis?«, wollten die anderen wissen.
»Eine Anerkennung dafür, dass mein alter Herr so viel Kohle gescheffelt hat, wie der Queen’s Award für die Industrie. Und dafür findet ein Riesenempfang mit allem Brimborium statt. Seitdem haben meine Eltern nichts anderes mehr im Kopf.«
»Gibt es jemanden, der sie an deiner Stelle zu der Verleihung begleiten könnte?«, fragte Elsa.
»Jede Menge – alle aus Vaters Firma, seine Freunde von den Rotariern und aus dem Golfklub, Mutters Cousinen …«
»Dann bist du also ihr einziges Kind?«, fuhr Elsa fort.
»Das ist ja das Problem«, entgegnete David traurig.
»Es ist dein Leben. Du kannst doch tun und lassen, was du willst«, erwiderte Shane schulterzuckend. Er begriff nicht, wo da ein Problem sein sollte.
»Ich vermute mal, sie hätten es gerne, wenn sie diese Ehre mit dir teilen könnten«, warf Thomas ein.
»Sicher, aber ich wollte vorhin am Telefon über das Unglück reden, die vielen Menschen, die umgekommen sind … Aber ihnen fiel nichts anderes ein, als mir wieder von dieser Veranstaltung zu erzählen und mich zu fragen, ob ich rechtzeitig nach Hause komme oder nicht. Ungeheuerlich ist so etwas.«
»Vielleicht wollen sie dir damit nur sagen, dass du nach Hause kommen sollst. Könnte doch sein, oder?«, meinte Elsa.
»Natürlich, das geben sie mir mit jeder Äußerung zu verstehen. Aber was sie sich darunter vorstellen – dass ich nach Hause komme, mir eine gute Stelle suche und meinem Vater im Geschäft helfe –, das werde ich ganz bestimmt nicht machen, nie und nimmer.« David nahm seine Brille ab und putzte sie heftig.
Elsa hatte noch nichts von sich erzählt. Nachdenklich blickte sie über die Olivenhaine hinweg auf das Meer und die Umrisse der kleinen Inseln, wo die Leute nichts anderes erwarteten, als einen weiteren friedlichen und sonnigen Ferientag zu verbringen. Plötzlich spürte sie, wie alle sie ansahen und offensichtlich darauf warteten, dass sie endlich über ihre Telefongespräche reden würde.
»Wie es bei mir war, wollt ihr wissen? Tja, mir scheint, dass im Moment in Deutschland kein Mensch zu Hause ist! Ich habe zwei Freunde angerufen, habe auf zwei Anrufbeantworter gesprochen, und wahrscheinlich denken jetzt beide, dass ich verrückt bin. Aber das macht nichts!« Elsa stieß ein leises Lachen aus. Keine Andeutung darüber, dass sie eine launige Nachricht auf dem einen und eine bitterböse, schon fast hasserfüllte auf dem anderen Band hinterlassen hatte.
Andreas musterte sie aus der Dunkelheit heraus. Die schöne Elsa, die ihre Arbeit bei einem Fernsehsender aufgegeben hatte, um ihren Frieden auf den Inseln Griechenlands zu finden, schien damit bisher kein Glück gehabt zu haben.
Auf der Terrasse war es still geworden. Alle ließen sich noch einmal ihre Gespräche mit ihren Angehörigen durch den Kopf gehen und überlegten, wie sie anders hätten reagieren können.
Fiona hätte ihrer Mutter schildern können, dass sie angesichts der vielen Mütter und Töchter unten am Hafen, die einander in panischer Angst suchten, plötzlich das dringende Bedürfnis verspürt habe, zu Hause anzurufen, und dass es ihr leid tue, wenn ihre Mutter sich Sorgen um sie mache. Nur weil sie eine erwachsene Frau war und ihr eigenes Leben führte, hieß das noch lange nicht, dass sie nicht auch gleichzeitig ihre Mutter und ihren Vater lieben konnte. Und ihre Eltern hätten am Telefon bestimmt nicht so aufgebracht reagiert, hätte sie sich verständnisvoller gezeigt, mit ihrer Mutter über deren Pläne gesprochen und ihr versichert, dass auch sie ihr fehlten und sie alles daransetzen würde, zu ihrer Silberhochzeit wieder nach Hause zu kommen.
David fiel ein, dass er hätte erzählen können, wie viel er auf dieser Reise von der Welt sah und wie viel Neues er lernte. Er hätte erklären können, dass das schreckliche Unglück, das sich heute auf dieser traumhaft schönen griechischen Insel ereignete, ihn veranlasst habe, darüber nachzudenken, wie kurz das Leben sei und wie plötzlich es zu Ende gehen könne.
Da sein Vater Sprüche und Redewendungen sammelte, hätte David ihm ein landestypisches Sprichwort präsentieren können: »Wer sein Kind liebt, schickt es auf Reisen.« Und er hätte hinzufügen können, dass er zwar noch keine festen Pläne für die Zukunft habe, aber täglich neue Erfahrungen mache, die ihn klarer sehen ließen. Vielleicht hätte er mit dieser Taktik Erfolg gehabt, vielleicht auch nicht. Aber alles wäre besser gewesen als die tiefe Kluft, die sich erneut zwischen ihm und seinen Eltern aufgetan hatte.
Und Thomas erkannte, dass er seine Mutter und nicht Shirley hätte anrufen sollen. Doch letztlich war sein Wunsch, mit Bill zu reden, so übermächtig gewesen, dass er der Versuchung nicht hatte widerstehen können. Der Junge hätte ja zu Hause sein können. Ja, er hätte seine Mutter anrufen und ihr sagen sollen, dass er nicht auf dem verunglückten Schiff war, und sie bitten sollen, es Bill auszurichten. Er hätte seiner Mutter sagen sollen, dass er sie vor all diesen fremden Menschen, die er eben erst kennengelernt hatte, in höchsten Tönen gelobt und ihnen geschildert habe, was für eine tolle Frau sie sei und wie dankbar er ihr war, dass sie ihm durch zahllose Nachtschichten sein Studium ermöglicht hatte. Seine Mutter hätte das sicher gefreut.
Nur Elsa war der Ansicht, dass sie am Telefon genau den richtigen Tonfall getroffen und das Richtige gesagt hatte. Beide Personen wussten, dass sie in Griechenland war, nur nicht genau, wo. Und erreichen konnten sie sie auch nicht. Elsa war vage und freundlich der einen, kalt und abweisend der anderen gegenüber gewesen. Sie konnte jedes Wort stehen lassen.
Das Klingeln des Telefons zerriss die Stille, und Andreas zuckte zusammen. Das konnte nur sein Bruder Yorghis sein, der von der Polizeiwache aus anrief, um ihn über die Zahl der Toten und Verletzten zu informieren.
Doch es war nicht Yorghis, sondern ein Mann, der deutsch sprach, Dieter hieß und auf der Suche nach Elsa war.
»Sie ist nicht hier«, sagte Andreas. »Sie sind alle schon vor einer Weile wieder hinunter zum Hafen gegangen. Wie kommen Sie überhaupt auf die Idee, dass sie hier sein könnte?«
»Aber sie kann noch gar nicht weg sein«, widersprach der Mann. »Sie hat mich doch erst vor zehn Minuten angerufen. Ich habe die Nummer zurückverfolgt … Wo ist Elsa? Bitte entschuldigen Sie, wenn ich aufdringlich erscheine, aber ich brauche diese Information ganz dringend.«
»Ich weiß es nicht, Dieter, wirklich nicht.«
»Und mit wem war sie zusammen?«
»Mit einer Gruppe, die morgen wieder weiterreist, soviel mir bekannt ist.«
»Aber ich muss sie unbedingt finden.«
»Ich bedauere sehr, Ihnen nicht helfen zu können, Dieter.« Andreas legte auf und drehte sich um. Hinter ihm stand Elsa und sah ihn fragend an. Sie war von der Terrasse ins Haus gekommen, als sie ihn deutsch hatte reden hören.
»Wieso hast du das für mich getan, Andreas?«, fragte sie. Ihre Stimme klang neutral.
»Ich dachte, das wäre dir recht so, aber wenn ich mich getäuscht habe – hier ist das Telefon, bitte, ruf ihn an.«
»Du hast dich nicht getäuscht. Du hast absolut korrekt gehandelt. Ich danke dir. Es war völlig richtig von dir, Dieter abzuweisen. Normalerweise reagiere ich nicht so empfindlich, aber heute Abend bin ich diesem Gespräch nicht gewachsen.«
»Ich weiß«, erwiderte Andreas verständnisvoll. »Es gibt Zeiten, da sagt man entweder zu wenig oder zu viel. Dann ist es das Beste, wenn man gar nichts sagen muss.«
Wieder klingelte das Telefon.
»Du weißt immer noch nicht, wo ich bin«, warnte sie ihn.
»Natürlich nicht«, erwiderte er und deutete eine Verbeugung an.
Dieses Mal war es sein Bruder Yorghis.
Es waren vierundzwanzig Tote zu beklagen.
Zwanzig der Opfer waren Fremde, die restlichen vier kamen aus Aghia Anna; darunter war nicht nur Manos, sondern auch sein kleiner Neffe, der an diesem Tag voller Stolz mit hinausgefahren war, um seinem Onkel zu helfen. Gerade mal acht Jahre war der Junge geworden. Ebenfalls zu beklagen waren zwei junge Männer, die auf dem Ausflugsboot arbeiteten und das Leben ebenfalls noch vor sich gehabt hätten.
»Dunkle Zeiten für dich, Andreas«, sagte Elsa, mit großer Anteilnahme in der Stimme.
»Sehr viel besser sieht es für dich offensichtlich auch nicht aus«, antwortete er ihr.
Schweigend saßen die beiden nebeneinander. Jeder hing seinen Gedanken nach. Es war, als würden sie sich seit ewigen Zeiten kennen. Sie würden schon wieder miteinander reden, wenn es etwas zu sagen gab.
»Andreas?«, sagte Elsa schließlich und sah nach draußen, wo die anderen sich unterhielten. Sie konnten sie nicht hören.
»Ja?«
»Würdest du mir noch einen Gefallen tun?«
»Wenn ich kann, sicher.«
»Schreib einen Brief an Adoni und bitte ihn, zurück nach Aghia Anna zu kommen. Und zwar jetzt gleich. Schreib ihm, dass euer Dorf den Tod dreier junger Männer und eines kleinen Jungen zu beklagen hat und dass ihr unbedingt das vertraute Gesicht eines Menschen sehen müsst, der gegangen ist, aber wieder zurückkommen kann.«
Andreas schüttelte heftig den Kopf. »Nein, Elsa. Bei aller Freundschaft, das funktioniert nicht.«
»Willst du damit sagen, dass du es nicht einmal versuchen willst? Was kann denn schon Schlimmes passieren? Er kann nur ablehnen – nein, danke. Aber davon geht die Welt auch nicht unter, verglichen mit dem, was heute hier passiert ist.«
»Was hast du davon, in das Leben von Menschen einzugreifen, die du überhaupt nicht kennst?«
Elsa warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Ach, Andreas, wenn du mich so kennen würdest, wie ich wirklich bin, dann wüsstest du, dass ich gar nicht anders kann. Ich bin als Journalistin so etwas wie eine Jeanne d’Arc der Unterdrückten. Jedenfalls nennen mich die Leute beim Sender so. Und meine Freunde behaupten auch, dass ich mich ständig überall einmischen muss. Stimmt. Permanent versuche ich, Familien an der Trennung zu hindern, Kinder von Drogen fernzuhalten, die Straßen sauberer und den Sport ehrlicher zu machen … Es liegt nun mal in meiner Natur, mich in das Leben wildfremder Menschen einzumischen.«
»Und, hast du Erfolg damit?«, fragte Andreas.
»Manchmal ja. Jedenfalls oft genug, dass ich es immer wieder aufs Neue probiere.«
»Aber du bist doch weggegangen?«
»Ja, aber nicht wegen der Arbeit.«
Andreas warf einen vielsagenden Blick in Richtung Telefon.
Elsa nickte. »Ja, genau, es war wegen Dieter. Aber das ist eine lange Geschichte. Eines Tages komme ich hierher zurück und erzähle sie dir.«
»Das musst du nicht.«
»Doch, das muss sein, auch wenn ich nicht genau sagen kann, warum. Außerdem will ich wissen, ob du diesen Brief an Adoni in Chicago geschrieben hast. Versprich mir, dass du es tun wirst.«
»Ich war noch nie ein großer Briefeschreiber.«
»Ich könnte dir dabei helfen«, erbot sie sich.
»Würdest du das wirklich tun?«, fragte er.
»Sicher. Und ich werde versuchen, mich in dich hineinzuversetzen, auch wenn ich vielleicht nicht ganz die richtigen Worte finde.«
»Das wird mir wahrscheinlich auch nicht gelingen«, sagte Andreas und machte ein trauriges Gesicht. »Manchmal glaube ich zwar, die richtigen Worte zu wissen, und dann stelle ich mir vor, wie ich meinen Sohn in die Arme nehme und wie er ›Papa‹ zu mir sagt. Aber dann habe ich wieder Angst, dass er hart und abweisend reagieren und mir zu verstehen geben könnte, dass meine Worte von damals nie mehr zurückgenommen werden können.«
»Dann muss der Brief eben so formuliert werden, dass er danach wieder ›Papa‹ zu dir sagt«, erklärte Elsa.
»Aber er merkt bestimmt, dass der Brief nicht von mir ist. Er weiß doch, dass sein alter Vater nicht sehr wortgewandt ist.«
»Oft ist der richtige Zeitpunkt viel wichtiger als ein bestimmter Wortlaut. Adoni wird sicher aus der Zeitung von dem Unglück hier in Aghia Anna erfahren. Darüber wird auch in Chicago berichtet. Und dann erwartet er garantiert ein Lebenszeichen von dir. Es gibt Dinge, die sind viel größer als wir und viel wichtiger als unsere kleinlichen Streitereien.«
»Für dich und diesen Dieter gilt das wohl nicht?«, fragte Andreas vorsichtig.
»Nein.« Elsa schüttelte den Kopf. »Nein, das ist etwas anderes. Eines Tages erzähle ich dir alles. Das verspreche ich dir.«
»Du musst mir gar nichts über dein Leben erzählen, Elsa«, erwiderte Andreas.
»Aber du bist mein Freund, ich will mit dir darüber reden.«
In dem Moment hörten sie die anderen kommen.
Thomas war ihr Wortführer. »Wir sollten jetzt aufbrechen, Andreas. Du brauchst sicher deine Ruhe. Morgen wird ein langer Tag«, sagte er.
»Ja, wir gehen jetzt besser wieder ins Dorf zurück«, erklärte David.
»Aber mein Bruder Yorghis hat einen Wagen heraufgeschickt. Der muss jeden Moment hier sein. Ich habe ihm von euch erzählt und gesagt, dass ihr ins Dorf hinunter müsst. Und der Weg dorthin ist lang.«
»Dann sollten wir jetzt zahlen. Wir haben lange genug deine Gastfreundschaft in Anspruch genommen«, warf Thomas ein.
»Wie ich bereits zu Yorghis sagte – ihr seid meine Freunde, und Freunde bezahlen nicht«, erklärte Andreas würdevoll.
Die kleine Gruppe betrachtete unschlüssig den von Alter und Arbeit gekrümmten Mann, der vor ihnen stand. Er besaß nicht viel und schuftete tagaus, tagein hier oben in seiner Taverne, deren einzige Gäste sie den ganzen Tag über gewesen waren.
Sie hätten ihn gerne für seine Dienste bezahlt, wollten ihn aber auch nicht beleidigen.
»Weißt du, Andreas, wir hätten ein ungutes Gefühl, uns hier auf deine Kosten satt zu essen. Auch wenn wir Freunde sind«, erklärte Fiona schließlich.
Shane sah die Sache natürlich anders. »Du hast doch gehört, was der Mann gesagt hat. Er will kein Geld.« Und dabei betrachtete er verständnislos die anderen, die offensichtlich Probleme damit hatten, sich kostenlos einen ganzen Tag lang durchfüttern zu lassen.
Elsa räusperte sich und setzte zum Sprechen an. Ihre Augen schimmerten verdächtig. Mit ihrer Art zog sie die Aufmerksamkeit der anderen auf sich, die verstummten.
»Was haltet ihr davon, wenn wir einen Teller herumgehen lassen und Geld für Manos’ Familie sammeln«, schlug sie vor. »Auch für seinen kleinen Neffen und alle anderen, die heute vor unseren Augen gestorben sind. Es wird bestimmt ein Fonds für die Opfer eingerichtet. Jeder legt so viel hinein, wie er für Essen und Trinken in einer anderen Taverne ausgegeben hätte. Das Geld tun wir dann in einen Umschlag und schreiben ›Von Andreas’ Freunden‹ darauf.«
Fiona hatte einen Briefumschlag im Rucksack und holte ihn heraus. Wortlos legten alle Geld auf den Sammelteller, den Elsa herumreichte. Im Hintergrund war bereits der Motor des Polizeifahrzeugs zu hören, das sich den Berg heraufkämpfte.
»Schreib doch noch ein paar Worte dazu, Elsa«, bat Fiona.
Elsa zögerte nicht lange.
»Ich würde ja gerne auf Griechisch schreiben«, sagte sie zu Andreas und zwinkerte ihm verschwörerisch zu.
»Das geht schon in Ordnung. Eure Großzügigkeit versteht man in jeder Sprache«, tröstete er sie. »Mir ist es noch nie leichtgefallen, irgendetwas zu schreiben«, fügte er heiser hinzu.
»Die ersten Worte sind am schwierigsten, Andreas.« So leicht gab Elsa nicht auf.
»Vielleicht sollte ich mit ›Adoni mou‹ anfangen«, fuhr Andreas unsicher fort.
»Das klingt doch schon mal gut«, sagte Elsa und drückte ihn kurz an sich, ehe sie zu den anderen in den kleinen Polizeibus stieg, der sie den Berg hinunter und in den kleinen Ort zurückbringen sollte, der sich seit dem gestrigen Abend so sehr verändert hatte, auch wenn die Sterne am Himmel noch dieselben waren.
Kapitel drei
Schweigend holperten sie in dem kleinen Polizeibus den Berg hinunter. Sie wussten, dass sie diesen Abend nie vergessen würden. Ein langer, emotional anstrengender Tag lag hinter ihnen, und sie hatten zu viel voneinander erfahren, als dass sie noch ungezwungen miteinander plaudern konnten. Aber alle wünschten sich, den alten Andreas unten im Dorf wiederzusehen. Er hatte ihnen von seinem Moped mit dem Anhänger erzählt, mit dem er täglich in die – wie er sich ausdrückte – »Stadt« fuhr, um Vorräte einzukaufen.
In dieser Nacht konnte keiner von ihnen gut schlafen, trotz des dunklen, mediterranen Himmels. Sogar die Sterne leuchteten aufdringlich hell in dieser Nacht und drangen als millionenfache Lichtblitze durch Vorhänge und Jalousien.
Elsa stand auf dem winzigen Balkon ihrer Ferienwohnung und blickte auf das dunkle Meer hinaus. Die Apartmentanlage, in der sie wohnte, wurde von einem jungen Griechen geführt, der das Immobiliengeschäft in Florida von der Pike auf gelernt hatte. Nach Hause zurückgekehrt, hatte er hier sechs kleine Apartments errichtet, einfach möbliert, mit gewebten Teppichen auf den Holzböden und buntem, griechischem Steingutgeschirr in den Regalen. Alle Wohnungen hatten einen kleinen Balkon mit traumhaftem Blick. Für die Verhältnisse in Aghia Anna kosteten die Wohnungen sehr viel Geld, sie waren aber trotzdem belegt.
Elsa hatte in einem Reisemagazin eine Anzeige dafür entdeckt und war nicht enttäuscht worden.
Von ihrem Balkon aus wirkte das dunkle Meer wie ein schwarzes Tuch aus Samt, das Sicherheit und Geborgenheit suggerierte. Und trotzdem hatten erst vor kurzer Zeit vierundzwanzig Menschen draußen vor der Hafeneinfahrt ihr Leben verloren. Das Wasser hatte die Flammen des brennenden Schiffes nicht zu löschen vermocht.
Elsa konnte zum ersten Mal nachvollziehen, wie ein trauriger, einsamer Mensch auf die Idee kommen konnte, in den Armen des Meeres sein Leben zu beenden. Natürlich war das dumm. Tod durch Ertrinken entbehrte jeglicher Romantik. Elsa wusste genau, dass es nicht damit getan war, einfach die Augen zu schließen und sich sanft aus dem Leben mit all seinen Problemen tragen zu lassen. Man schlug wild um sich und kämpfte panisch um Luft, ehe man endlich erlöst war.
Hatte sie das eigentlich ernst gemeint, was sie vorher auf Dieters Anrufbeantworter gesprochen hatte? Dass sie wünschte, sie wäre heute ebenfalls gestorben? Nein, hatte sie nicht. Sie hatte nicht das geringste Verlangen danach, mit aller Kraft gegen übermächtige Wasserstrudel anzukämpfen.
Aber andererseits hätte das alle ihre Probleme gelöst. Es hätte ein für alle Mal ihrer ausweglosen Situation, der sie verzweifelt zu entkommen suchte, die sie aber überallhin verfolgte, ein Ende bereitet. Elsa ahnte, dass sie die nächsten Stunden keinen Schlaf finden würde. Es hatte also wenig Sinn, sich überhaupt ins Bett zu legen. Sie zog ihren Stuhl nach draußen, setzte sich, stützte ihre Ellbogen auf die schmiedeeiserne Brüstung des Balkons und starrte auf die flirrenden Muster, die das Mondlicht auf die Wasseroberfläche zauberte.
Davids kleines Zimmer war heiß und stickig. Bisher hatte er sich hier sehr wohl gefühlt, aber heute Abend war alles anders. Die Bewohner des Hauses verliehen ihrem Schmerz so lautstark Ausdruck, dass kein Mensch schlafen konnte. Ihr Sohn war heute auf Manos’ Boot umgekommen.
Als David in das Haus zurückgekehrt war, in dem Familie und Freunde sich tröstend in den Armen lagen, hatte er zunächst nicht gewusst, wie er reagieren sollte. Verlegen hatte er Hände geschüttelt und um Worte gerungen, die ohnehin nur unzulänglich auszudrücken vermochten, was nicht in Worte zu fassen war. Seine Vermieter sprachen kaum Englisch und starrten ihn mit weit aufgerissenen Augen an, als hätten sie ihn noch nie zuvor gesehen. Sie bekamen kaum mit, dass er kurze Zeit später wieder die Treppe herunterkam und in die Nacht hinaustrat.
David fragte sich, was wohl geschehen wäre, wenn er auf dem Boot sein Leben verloren hätte. Wie leicht hätte das passieren können. Er hatte sich, Gott sei Dank, für einen anderen Tag entschieden, um den Ausflug mitzumachen. Zufälle wie dieser bestimmten über das Schicksal eines Menschen.
Hätte man bei ihm zu Hause auch so lautstark um ihn getrauert? Wäre sein Vater vor Schmerz mit dem Oberkörper vor und zurück geschaukelt? Oder hätte er nur grimmig bemerkt, dass der Junge sich nun mal für dieses Leben entschieden habe und deshalb auch diesen Tod in Kauf nehmen müsse.
Während er durch den verwaisten Ort lief, wurde David plötzlich unruhig. Vielleicht traf er ja jemanden aus der Gruppe, mit der er den ganzen Tag verbracht hatte. Nur hoffentlich nicht Fionas grässlichen Freund Shane, alle anderen gerne.
Er überlegte, ob er nicht in eine kleine Taverne gehen sollte, wo die Leute bestimmt noch zusammensaßen und die schrecklichen Ereignisse des Tages diskutierten. Vielleicht war Fiona dort, und er konnte mit ihr über Irland plaudern, ein Land, das er schon immer kennenlernen wollte.
Er könnte mit ihr auch über ihren Beruf reden und sie fragen, ob es wirklich so befriedigend war, Kranke zu pflegen, wie es immer hieß. War es tatsächlich eine persönliche Bereicherung, zu sehen, dass die Patienten auf dem Weg der Besserung waren? Schrieben sie wirklich Dankesbriefe an die Schwestern, die sie gepflegt hatten? Außerdem wollte er wissen, ob Engländer als Touristen oder Arbeitskräfte in ihrem Land willkommen waren oder ob sich die Feindseligkeiten gegen seine Landsleute mittlerweile gelegt hatten. Und da David oft überlegt hatte, töpfern zu lernen, etwas mit den Händen zu gestalten und eine Arbeit zu machen, die nichts mit der Welt des »making Money« zu tun hatte, interessierte ihn natürlich auch, ob im Westen Irlands kunsthandwerkliche Kurse angeboten wurden.
Oder er hätte mit Thomas über dessen Artikel sprechen und ihn fragen können, worüber er schrieb, warum er sich so lange von seiner Universität hatte beurlauben lassen und wie oft er seinen kleinen Sohn sah.
Für David gab es nichts Spannenderes als die Lebensgeschichten anderer Menschen. Das war der Grund, weshalb er in der Investmentfirma seines Vaters völlig fehl am Platz war.
Seine Aufgabe wäre es gewesen, den Klienten zu erklären, wie und wo sie am besten ihr Geld anlegten. Doch statt den Investitionswert ihrer Immobilien zu ermitteln, stellte er ihnen lieber Fragen nach ihrem häuslichen Umfeld. Da sie meist nichts anderes im Sinn hatten, als einen raschen Gewinn zu erzielen, nervte er sie mit seinem Gerede über Haustiere oder Obstgärten.
Er entdeckte Elsa, die auf ihrem Balkon saß, wagte aber nicht, sie zu stören, so ruhig und gelassen wirkte sie auf ihn. Sie wollte bestimmt nicht mitten in der Nacht von ihm belästigt werden.
Thomas hatte sich für zwei Wochen in einer Wohnung über einem Kunstgewerbeladen eingemietet, den eine exzentrische Frau namens Vonni betrieb. Sie war Ende vierzig und trug stets einen Rock mit grellem Blumenmuster und darüber irgendein schwarzes Oberteil. Am Anfang hätte Thomas ihr am liebsten ein paar Scheine für die nächste Mahlzeit zugesteckt, so bedürftig wirkte sie. Aber Vonni war auch die Besitzerin der für hiesige Verhältnisse geradezu luxuriösen Wohnung, die sie samt des teuren Mobiliars und einiger wertvoller Kunstgegenstände und Gemälde an Touristen vermietete.
Vonni war irischer Herkunft, so viel wusste Thomas mittlerweile, aber sie sprach nicht gern über sich selbst. Als Vermieterin war sie perfekt, da sie ihn in Ruhe ließ. Sie brachte seine Kleidung in eine Wäscherei am Ort und stellte ihm manchmal sogar einen Korb mit Trauben oder eine kleine Schale mit Oliven vor die Tür.
»Wo wohnen Sie eigentlich, während ich hier bin?«, hatte er sie am ersten Tag gefragt.
»Ich schlafe im Schuppen«, hatte sie erwidert.
Thomas wusste nicht, ob sie einen Witz machte oder einfach nur ein bisschen eigenartig war. Aber er ging ihr nicht weiter mit neugierigen Fragen auf die Nerven, da er sich ausgesprochen wohl in ihrer Wohnung fühlte.
Er wäre auch mit einer Unterkunft zufrieden gewesen, die nur ein Zehntel der Miete gekostet hätte, aber er brauchte unbedingt ein eigenes Telefon, für den Fall, dass Bill ihn anrufen wollte.
Zu Hause in den Staaten hatte Thomas sich vehement gegen ein Mobiltelefon ausgesprochen. Viele Menschen konnten ohne ihr Handy schon gar nicht mehr leben. Auf Reisen hätte Thomas so ein Gerät noch mehr als Belästigung empfunden. Alle jammerten ständig, dass sie meistens in irgendwelchen Funklöchern steckten und nicht zu erreichen waren. Außerdem, was spielte es schon für eine Rolle, wie viel er für eine Ferienwohnung mit Telefon ausgab? Wozu hätte er sein Dozentengehalt sonst ausgeben sollen? Und seine Schriftstellerei brachte ihm allmählich auch Geld ein.