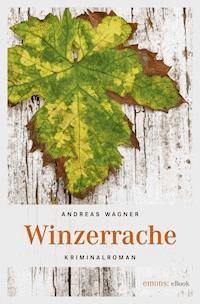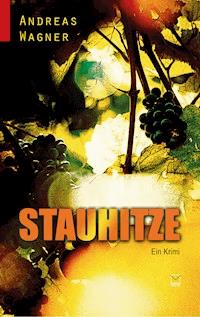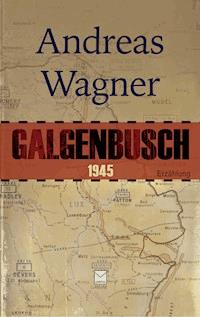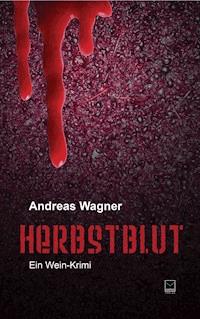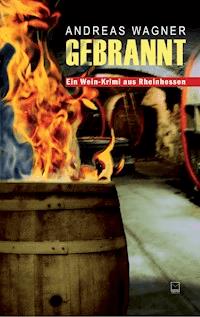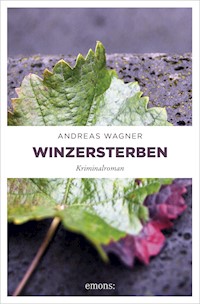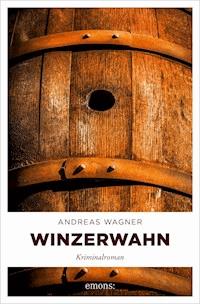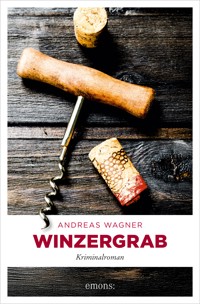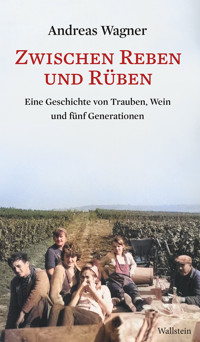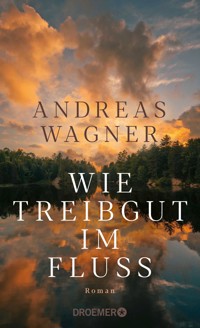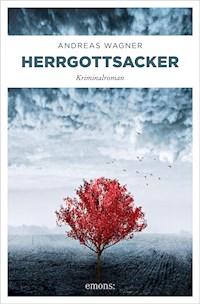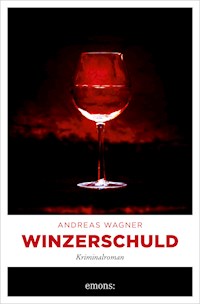9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Suche nach Heimat und uns selbst: eine große deutsche Familien-Geschichte am Rand des Hambacher Forstes Heimat, das ist für Leonore Klimkeit vor allem der Wald nahe des kleinen Dorfes, in dem die aus Ostpreußen Vertriebene Zuflucht gefunden hat. Zwischen den hohen Bäumen findet sie Trost und neuen Lebensmut. Doch als Leonores Sohn Paul zwölf Jahre alt ist, muss der Wald dem Braunkohle-Abbau weichen, das Dorf wird umgesiedelt. In einer Neubausiedlung am Rand der Kreisstadt versucht Leonore, für Paul und später die Enkel Jan und Sarah eine neue Heimat zu schaffen. Die immer weiter fortschreitende Rodung des Waldes treibt jedoch einen tiefen Keil in die Familie – bis sich die Geschwister schließlich als Gegner gegenüberstehen: Denn während Jan einen der gigantischen Schaufelradbagger des Braunkohle-Konzerns steuert, schließt sich seine Schwester Sarah den Wald-Besetzern im Hambacher Forst an. Unaufgeregt und einfühlsam erzählt Andreas Wagner eine berührende Familien-Geschichte, die immer wieder die Frage stellt, was Heimat bedeutet. Gleichzeitig porträtiert sein Roman auf anschauliche Weise die Nachkriegs- und Wirtschaftswunder-Zeit in Deutschland, die Folgen des Braunkohle-Abbaus nicht nur für die Landschaft und die Ereignisse rund um den Hambacher Forst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Andreas Wagner
Jahresringe
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Heimat, das ist für Leonore vor allem der Wald nahe des kleinen Dorfes, in dem die aus Ostpreußen Vertriebene Zuflucht gefunden hat. Zwischen den hohen Bäumen findet sie Trost und neuen Lebensmut. Doch als Leonores Sohn Paul zwölf Jahre alt ist, muss der Wald dem Braunkohleabbau weichen, das Dorf wird umgesiedelt. In der seelenlosen Neubausiedlung zieht Paul zwei Kinder groß – die sich schließlich als Gegner gegenüberstehen: Denn während Jan einen der gigantischen Schaufelradbagger steuert, schließt sich seine Schwester Sarah den Waldbesetzern im Hambacher Forst an.
Unaufgeregt und einfühlsam erzählt Andreas Wagner eine berührende Familiengeschichte, die immer wieder die Frage stellt: Was bedeutet Heimat?
Inhaltsübersicht
Widmung
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Teil 2
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Teil 3
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Danksagung
Für Lena, Frida, Juli, Nelly
Teil 1
1946–1964
1
Eine Menschentraube hatte sich um den dunkelblauen Pritschenwagen gebildet. Mit drei lauten Knallgeräuschen war er mitten im Dorf zum Stehen gekommen. Ein, vielleicht zwei Dutzend Leute, hauptsächlich Frauen und Kinder, waren zusammengekommen, um diesem bemerkenswerten Ereignis beizuwohnen: Wie ein gestrandeter Blauwal lag der Lastkraftwagen schwer schnaufend auf der Hauptstraße des Ortes, aber anstelle der Fontäne aus dem Atemloch dampfte und zischte es aus Kühler und Motor. Schwarzer, öliger Rauch vermischte sich mit weißem Qualm und verwandelte das Dorf mit seinen eng aneinandergerückten Backsteinbauten, die von der tief stehenden Abendsonne angeleuchtet wurden, in einen höllisch schimmernden Ort. Aber was war die Hölle gegen das, was Leonore in den letzten zwei Jahren erlebt hatte, seit sie sich ganz im Osten auf den Weg gemacht hatte, um so weit wie nur irgend möglich in den Westen zu gelangen? Angst oder gar Verzweiflung hätte man ihr mit Sicherheit nicht angesehen. Solche Gefühle zu zeigen hatte die Flucht ihr ausgetrieben.
Aber niemand sah sie an, als sie zögernd der Ladefläche des havarierten Wagens entstieg. Die ehemals schwarzen Lederschuhe, die ihre Füße kaum noch umhüllten, hatten abgewetzte Sohlen und waren dünn wie Pergamentpapier. Einen Hauch von Enttäuschung hätte man bemerken können: ein tiefer Atemzug. Augen für einen Moment geschlossen. Lippen aufeinandergepresst. Mehr erlaubte sie sich nicht. Ihre Furcht davor, wie es weitergehen sollte, hielt sie verborgen. Ob sie hier in diesem Weiler einen Platz für die Nacht auftreiben würde? Ob sie wieder einen Teil ihrer Seele würde eintauschen müssen, um einen halbwegs sicheren Ort zu finden? So wie sie es schon oft hatte tun müssen in den letzten zwei Jahren – zuletzt heute Morgen hinter den Trümmern eines zerbombten Hauses im Schatten des Kölner Doms für den Platz in dem blauen Pritschenwagen, dessen Fahrer mit seinem Passierschein und dem vollen Tank seines Lastwagens geprahlt hatte.
Leonore schob sich durch die Ansammlung der diskutierenden Dorfbewohner, die sich um den fluchenden und schwitzenden Fahrer gruppiert hatten und zu der sich nun auch die anderen zwei Mitfahrer gestellt hatten. Männer mittleren Alters; Kriegsheimkehrer? Tagelöhner? Wer wusste das schon? Niemand konnte dieser Tage einschätzen, wie alt man war, wo man herkam oder wo man hinwollte. Stattdessen interessierte sie nur das fauchende Ungetüm, das hier zu verenden drohte. Es war wie überall im Land: Die Menschen hatten verlernt, einander in die Augen zu sehen. Doch genau das war Leonores Glück gewesen. Ohne die ausweichenden Blicke ihrer Mitmenschen wäre sie auf ihrem Weg durch das Land niemals unentdeckt geblieben. Man hätte das Kind in ihr gesehen, das sie noch war, auch wenn sie anderes behauptete. Sie war groß gewachsen, aber bei Weitem noch nicht so alt, wie sie vorgab zu sein.
Als der Fahrer die seitliche Motorhaube anhob und Leonore das heiße Öl die Zylinder und Leitungen hinabrinnen sah, war ihr längst klar, dass ihre Reise wieder einmal ein vorläufiges Ende genommen hatte. Dass es schon wieder kein Weiter geben würde. Also tat sie, was sie in den letzten Monaten immer getan hatte, wenn sie an einem neuen Ort gestrandet war: Sie bewegte sich unauffällig aus dem Zentrum des Geschehens, um sich aus sicherer Entfernung einen Überblick zu verschaffen. Wer war ihr wohlgesinnt? Wo lauerte Gefahr? Wo konnte sie sich verstecken? Solange noch alle mit dem qualmenden Lastwagen beschäftigt waren, solange niemand sie bemerkt hatte, war sie in Sicherheit, aber sie brauchte einen Plan. Was sollte sie tun, sobald der Rauch verflogen war und sich die Aufregung im Dorf gelegt hatte? Zu oft hatte sie, seit sie Schirwindt im Spätsommer vor zwei Jahren verlassen hatte, gespürt, dass es für ein Mädchen wie sie keinen sicheren Ort gab. Zu viele Dörfer und Städte hatte sie schon kennengelernt, in denen man als Flüchtling aus Ostpreußen nicht willkommen war. Sie hatte sich antreiben, vertreiben lassen. Die Stimme ihrer Mutter im Rücken, als liefe sie noch immer hinter ihr: Nach Westen! Nur nach Westen!
Den letzten Winter hatte sie in den Trümmern einer halb zerstörten Volksschule vor Hannover verbracht. Sie hatte aufgeschnappt, dass die Schulen wieder öffnen sollten, um die Kinder von der Straße zu bekommen. Aber ihr Unterschlupf blieb zum Unterrichten unbrauchbar, und man hatte noch nicht mit der Instandsetzung begonnen. Gegen die Kälte hatte sie sich aus Filzdecken ein Nest gebaut. Wenn es nicht mehr auszuhalten war, hatte sie kleine Feuer aus den Schulbänken unter dem zerstörten Dach entfacht. Aber das war riskant gewesen. Wäre sie entdeckt worden, hätte sie ihren sicheren Unterschlupf und auch die Vorräte an eingeweckten Pflaumen im Keller der Lehrerwohnung verloren.
Auf der Karte des Deutschen Reiches, die trotzig im Kartenständer hing und im Windzug hin und her baumelte, hatte Leonore ihre Route immer und immer wieder mit dem Finger nachgezeichnet und die weiteren Stationen geplant. Nach Westen! Nur nach Westen!
Im Schutz einer Häuserecke besah sie sich nun ihre unfreiwillige Zwischenstation. Ihr Blick war geschult, und so erkannte sie schnell, in welchem der schmalen Häuschen noch Leben war und wo der Krieg seine Bewohner vertrieben hatte. Beschädigte Dächer, zersprungene Fensterscheiben – unreparierte Kriegsschäden – waren eindeutige Zeichen, aber auch Unkraut zwischen den Treppenstufen zur Haustür oder eine vertrocknete Pflanze auf der Fensterbank ließen vermuten, dass die entsprechenden Häuser schon seit längerer Zeit nicht mehr betreten worden waren. Im Laufe ihrer Flucht durch das Land war dieser Anblick seltener geworden. Zu viele Menschen drängten gemeinsam mit ihr von Osten her in das Land und wurden in den leer stehenden Gebäuden untergebracht. Doch hier entdeckte Leonore sofort ein verlassenes Haus. Als Versteck war es dennoch kaum geeignet, lag es doch Wand an Wand mit offensichtlich bewohnten Gebäuden direkt an der Hauptstraße des Dorfes. Hier einzudringen würde nicht leicht werden. Wenn überhaupt müsste sie den Weg über eine der Seitenstraßen nehmen und sich von hinten Zugang verschaffen.
Die letzten Atemzüge des verreckten Motors hatten sich mittlerweile als tief hängende Wolke über das Dorf gelegt. Alles war eingehüllt in Qualm und einen Gestank, der sofort in den Kopf stieg. Leonore spürte das Knurren ihres Magens. Sie hatte, seit sie sich gestern Abend in der Stadt einen Teller Suppe erbettelt hatte, nichts mehr gegessen. Und durstig war sie auch. Aus einer nach Norden abgehenden Straße sah sie eine Gestalt auf die Hauptstraße einbiegen. In seiner schneeweißen Kleidung stach der Mann selbst durch die alles vernebelnden Schwaden hervor. Leonore bemerkte die merkwürdige Stellung seines rechten Armes. Er schien wie ein Fremdkörper von seiner Schulter herabzuhängen. Sein Gang wirkte abgehackt. Leonore fragte sich, ob dies an dem Handkarren lag, den er hinter sich herzog, oder ob auch seine Beine versehrt waren. Er bewegte sich langsam auf sie zu, hatte dabei aber den Blick nach hinten gerichtet. Immer weiter ging er seinen offensichtlich gewohnten Weg entlang, schien sich aber nicht entgehen lassen zu wollen, was dort auf der Hauptstraße geschah. Ein paar seiner kantigen Schritte noch, dann würde er gegen sie stoßen. Sie war zu erschöpft, um es nicht darauf ankommen zu lassen. Vielleicht hatte sie sogar Glück, und er würde mit einem Stück Brot, einer Zigarette zum Tauschen oder zumindest einem freundlichen Lächeln um Entschuldigung bitten.
»Oh«, hörte sie die Stimme des weiß gekleideten Mannes, als er sie anrempelte. Hastig drehte er den Kopf, wobei seine ebenfalls weiße Schiffchenmütze und seine kreisrunde Brille verrutschten. Er schob beides umständlich mit dem linken Arm wieder zurecht, nachdem er den Griff des Handkarrens abgelegt hatte. Der rechte Arm blieb unbeweglich hängen.
»Verzeihung«, sagte der Mann und blickte sie an, wie man eine Katze ansieht, die abgemagert und mit stumpfem Fell vor einem steht und um Milch bettelt. Auch Leonore musterte ihn. Er war groß und dünn – niemand war dick dieser Tage. Seine Jacke und Hose schienen wie mit Mehl gepudert. Sein schwarzes Haar trug er, der Mode der Zeit entsprechend, kurz und mit Pomade nach hinten gelegt. Sie musste mit ihren strähnigen dunkelblonden Haaren, ihrem fleckigen schwarzen Mantel und der löchrigen und viel zu großen Soldatenhose wie das komplette Gegenteil wirken. Ein Duft stieg in Leonores Nase. Verlockend und so stark, dass er sogar durch die beißende Rauchwolke hindurchdrang. Während sie ihre Erinnerung nach einer Idee absuchte, um welche Art von Duft es sich handelte, fragte ihr Gegenüber:
»Wie alt bist du?«
»Einundzwanzig«, antwortete sie.
Der Mann schüttelte den Kopf.
»Ich bin einundzwanzig«, wiederholte sie, so wie sie es seit beinahe zwei Jahren jedem trotzig mitteilte, der eine Antwort verlangte. Es war ihr egal, dass es noch lange nicht stimmte.
»Du siehst aber jünger aus.«
»Ich bin noch nicht lange einundzwanzig.«
Der Mann sah sie fragend an.
»Heute ist mein Geburtstag.« Sie hatte keine Ahnung, warum sie das sagte. Vielleicht, so schoss es ihr durch den Kopf, war heute wirklich ihr Geburtstag. Nein, das konnte nicht sein, der war im März, und jetzt ging es schwer auf den Herbst zu. Der fremde Mann hob die Augenbrauen und ließ sie über dem Rand seiner Brille tänzeln. Leonore spürte, dass er ihr nicht glaubte, so wie schon viele Menschen zuvor ihr diese Lüge nicht abgekauft hatten. Aber bis zum tatsächlichen Eintreten ihrer Volljährigkeit war es die einzige Chance, sich durchschlagen zu können. Der Mann wandte sich seinem Wagen zu. Er lüftete das Leinentuch, mit dem seine Ladefläche bedeckt war. Leonore wich einen halben Schritt zurück.
»Dann habe ich ein Geburtstagsgeschenk für dich«, sagte er und hielt ihr etwas kleines Braunes hin. Leonore riss es ihm aus der Hand, bevor er seine großzügige Geste noch einmal überdenken konnte. Sie befühlte es vorsichtig. Es war hart und weich zugleich, die Oberfläche schimmerte zuckrig, und in der Mitte steckte eine halbe Haselnuss.
»Eigentlich gehört da eine Mandel hin«, sagte der Mann, »aber man muss improvisieren. Man kann nur mit dem backen, was man hat.«
Leonore führte das Gebäck zur Nase. Es roch köstlich, und jetzt fiel ihr auch ein, woran der Duft sie erinnerte.
»Weihnachten«, murmelte sie.
»Wie bitte?«, fragte der Mann, aber Leonore konnte nicht mehr antworten.
Sie verschlang das kleine Stückchen, als müsste sie es in ihrem Magen in Sicherheit bringen. Der Geschmack dieser Köstlichkeit hatte ihren Mut angestachelt.
»Kann ich noch mehr?«
»Wie bitte?«, fragte der Mann erneut.
»Kann ich noch mehr?«
»Von den Moppen?«
»Ist mir egal, wie sie heißen. Kann ich noch mehr?« Leonore schielte am lahmen rechten Arm ihres Gegenübers vorbei in das Innere des Handkarrens. Sie konnte drei oder vier Holzkisten auf der Ladefläche sehen. Allesamt bis obenhin gefüllt mit diesem leckeren Gebäck. Er folgte ihrem Blick.
»Das geht nicht«, schüttelte er den Kopf. »Ich liefere gerade aus. Die Ladung ist bestellt und bezahlt.«
Leonore sah ihm in die Augen. »Umso besser.«
»Was?«
»Na, wenn sie sowieso schon bezahlt sind, dann kannst du mir ja noch welche abgeben.«
»Du bist ganz schön hartnäckig«, stellte der Mann fest.
Leonore schwieg und sah ihn an.
»Bist du mit dem Lastwagen gekommen?«
Leonore nickte.
»Wo du herkommst, brauche ich dich nicht zu fragen. Ich war im Krieg, im Ersten, als junger Mann. Da hatte ich einen Kameraden aus Ostpreußen. Der sprach genau wie du.«
Leonore pulte mit ihrer Zunge die letzten Krümel zwischen den Zähnen hervor.
»Ihn hat eine Granate zerfetzt«, sagte er leise. »Ich hatte mehr Glück.« Er deutete auf seine versehrten Gliedmaßen.
Leonore schwieg.
»Hier«, er hielt ihr eine Handvoll Moppen hin und sah sich dabei verstohlen um. Leonore griff zu und steckte sich hastig eine nach der anderen in den Mund, während sie dem Mann dabei zusah, wie er seinen Handkarren wieder sorgfältig mit dem Tuch bedeckte und die Hauptstraße entlangzog.
Sie blickte in die Sonne. Nach Westen! Nur nach Westen! Bald schon würde es Herbst und damit wieder kälter werden. Bis dahin musste sie angekommen sein. Ganz egal wo. Die Wärme der Sonne zog sie in ihren Bann. Der weihnachtliche Geschmack in ihrem Mund tat sein Übriges. Ihre Sinne fuhren Karussell. Für einen Moment vergaß sie, dass sie noch immer auf der Flucht war, dass sie noch immer nicht in Sicherheit war und dass sie noch nicht einmal eine Idee hatte, wo und wann und ob sie überhaupt jemals wieder in Sicherheit würde leben können.
Ein paar Schritte von ihr entfernt standen Straßenschilder an einer Kreuzung. In die Richtung, aus der sie gekommen war, wies das Schild fünfunddreißig Kilometer bis Köln aus. In die andere Richtung die gleiche Entfernung bis Aachen.
Nach einer Weile tauchte der Mann mit dem Handkarren wieder am Ende der Straße auf. Als er sie passierte, grüßte er stumm mit einem Nicken und einem Lächeln und zog seinen Wagen weiter bis zu der Abbiegung, aus der er gekommen war, bevor sie zusammengestoßen waren. Es war ihr, als schöbe sie jemand an, als sie sich langsam in Bewegung setzte und ihm folgte. Sie ging einen Weg entlang, der sie zwischen Feldern hindurch, an einer steilen Böschung vorbei in einen Teil des Dorfes führte, der abseits der Hauptstraße lag. Leonore hielt genügend Abstand, um nicht den Eindruck zu erwecken, ihn zu verfolgen, sondern lediglich den gleichen Weg zu haben. Er schien keine Notiz von ihr zu nehmen. Auf einem unbewirtschafteten Acker sprang ihr etwas ins Auge, das wie ein Fremdkörper in diesem ansonsten grauen, braunen, bestenfalls rotbraunen Ort wirkte: Inmitten des Feldes stand, umwuchert von hohem Gras, ein in allen Farben leuchtendes Karussell. Unter dem kreisrunden Himmel, der mit Motiven aus Märchen und Sagen bemalt war, hingen an langen Stangen verschiedenste Tiere: Pferde, Schweine, sogar ein Hahn. Leonore verspürte unmittelbar den Drang, auf einem der hölzernen Pferde mit ihren stolzen Mähnen und dem goldenen Zaumzeug Platz zu nehmen. Sie war eben doch noch ein Kind, und der Krieg und die lange Flucht hatten dafür gesorgt, dass sie sich kaum noch erinnern konnte, wann sie das letzte Mal wirklich ein Kind gewesen war und in solch einem Fahrgeschäft gesessen hatte. War es in Schirwindt gewesen? Oder in Schloßberg, wo ihre Großtante gelebt hatte?
Welche Rolle spielte das, wenn doch sowieso alles verloren war? So vieles war unwichtig geworden in den letzten zwei Jahren – sie hoffte, nur vorübergehend. Das Karussell mitten auf dem Acker und ihre Lust, damit zu fahren, ließen etwas in ihr keimen, das sich wie Zuversicht anfühlte.
Später sollte sie erfahren, dass amerikanische Soldaten das zusammengefaltete Karussell nach der Eroberung des Dorfes aus der Scheune der Caspers gezogen und aufgebaut hatten, um sich johlend und feixend die Zeit und die Erinnerungen an die Schlachten in den Wäldern des nahen Grenzgebietes zu vertreiben. Nachdem sie abgezogen worden waren, hatte Maria Caspers darauf bestanden, dass das Karussell dort auf dem Kleinfeldchen, dem Acker, an dem Leonore entlanggelaufen war, stehen blieb, bis ihr Mann oder wenigstens einer ihrer drei Söhne, von denen seit Kriegsende niemand etwas gehört hatte, aus Gefecht oder Gefangenschaft heimgekehrt waren, um ihren Besitz höchstselbst wieder in der Scheune zu verstauen. Das Karussell sollte noch zwei Winter dort stehen, bis der Pfarrer – das Kleinfeldchen war in kirchlichem Besitz – entschied, es von erfahrenen Männern einer anderen Schaustellerfamilie fachgerecht abbauen und einlagern zu lassen. Der Acker musste schließlich wieder bewirtschaftet werden. Maria Caspers starb kurz darauf an ihrem gebrochenen Herzen.
Leonore blickte dem Mann hinterher, dem sie gefolgt war, und setzte ihren Weg fort. Als er an einer Wegkreuzung ankam und Leonore etwas aufgeholt hatte, sagte er plötzlich, ohne seinen Gang zu unterbrechen oder sich umzusehen: »Wie heißt du?«
Leonore zuckte zusammen.
»Mädchen, sag! Wie ist dein Name?« Er musste sie gemeint haben. Niemand anders war zu sehen oder hatte ihren Weg gekreuzt, seit sie die Hauptstraße verlassen hatten.
»Ich?«, fragte sie zaghaft, während sie ihren Gang beinahe auf Zehenspitzen fortsetzte.
»Ja, du«, sang der Mann beinahe. »Ich bin Jean. Jean Immerath. Aber du kannst mich Hannes nennen. Nur meine Mutter nennt mich Jean.« Er blieb stehen. Leonore tat es ihm gleich und sah, wie sich sein Kopf zu ihr neigte und sich sein verschmitztes Lächeln zeigte.
»Also?«
Leonore schluckte. Sie wusste, wenn sie ihren Namen verriet, machte sie sich verletzlich. Ihr Name war beinahe das Einzige, was sie noch hatte. Zwischen Danzig und Köln hatte sie nicht einmal einer Handvoll Menschen verraten, wie sie wirklich hieß. Sie war Lotte Schneider gewesen oder Veronika Herrmann. Jean oder Hannes wirkte jedoch wie jemand, dem man verraten konnte, wie man hieß. Auf ihre Menschenkenntnis konnte sie sich verlassen, sonst wäre sie nie so weit gekommen. Sie holte tief Luft, streckte die Brust heraus, hob den Kopf und sagte mit fester Stimme: »Leonore Klimkeit.«
»So, so«, sagte Hannes. »Leonore.« Er zog seinen Karren weiter.
Herrenstraße las Leonore auf dem emaillierten Schild.
»Leonore, du hast einen starken Willen. Das gefällt mir. Wir haben Platz im Haus, meine Mutter und ich. Und wir könnten eine helfende Hand gut gebrauchen. Du könntest in der vorderen Wohnung wohnen.« Sein Blick deutete die Straße entlang. »Na ja, es ist ein Zimmer mit Waschraum, mehr nicht. Aber es steht sowieso leer.«
Es war nicht der erste Schlafplatz, der Leonore aus dem Nichts heraus angeboten wurde. Zu oft hatten zwielichtige Gestalten versucht, sie zu überreden, mit ihnen zu kommen. Aber keiner dieser Männer, die ihrer kleinen Seele Schmerzen zugefügt hatten, war so reinlich weiß gekleidet gewesen, keiner hatte sie aus tiefstem Herzen angelächelt und keiner hatte ihr Moppen geschenkt.
»Ich werde morgen mit Mutter reden«, sagte Hannes. »Sie hat sich bereits hingelegt, aber sie wird schon einverstanden sein.« Wieder war da dieses Lächeln, von dem Leonore gar nicht glauben konnte, dass es ihr galt. »Wenn du willst, kannst du erst einmal bleiben.«
2
Leonore blieb. Nicht nur über Nacht, nicht nur vorübergehend. Sie blieb. Die Herrenstraße Nummer sieben in diesem fremden Dorf namens Lich-Steinstraß wurde ihr neues Zuhause. Leonore bewohnte einen kleinen separaten Teil des Hauses. Es war die rechte weiß getünchte Hälfte. Auf der linken Seite befand sich der kleine Laden, in dem Hannes seine süßen Backwaren verkaufte und später, nach der Währungsreform, auch noch andere Lebensmittel, Zeitschriften und Haushaltswaren aller Art feilbot. Dahinter befanden sich die kleine Wohnung, die Hannes mit seiner Mutter teilte, und die Backstube mit dem alten Königswinterer Holzofen. Alles ging ineinander über: Laden, Wohnung, Backstube.
Leonore wanderte zwischen den Welten. Überall ging sie dem Moppenbäcker zur Hand. Sie bediente die Kundschaft im Geschäft, half der alten Frau Immerath aus dem Sessel, wenn Hannes gerade mehlige Hände hatte, knetete für ihn den Teig, wenn er gerade mit einer Stammkundin ein Schwätzchen hielt, oder erledigte manche der Auslieferungen an Schausteller im Ort, die seine Moppen und andere Leckereien auf den Volksfesten im ganzen Umland verkauften. Überall zwischen Düren und Neuss schätzte man die Backkunst von Jean Immerath.
Weniger geschätzt im Dorf war Leonore. Das Ausfahren der Waren erledigte sie zwar pflichtbewusst – schließlich wurde es für Hannes mit zunehmendem Alter und seinen Kriegsverletzungen immer schwerer, den Handkarren zu ziehen – aber sie empfand stets Abscheu. Oft ließ man sie spüren, dass sie als Ortsfremde, noch dazu ein Flüchtlingsmädchen, noch dazu eine Evangelische, nicht willkommen war. Wenn sie bei Kieven oder Eßling oder den anderen Schaustellern ihre bestellten Moppen und Lebkuchenherzen ablieferte, redete man mit ihr nur das Nötigste. Kein Lächeln wurde an sie verschwendet, kein Wort des Dankes oder der Anerkennung. Von einem Groschen Trinkgeld ganz zu schweigen. Sie lief mit gesenktem Kopf durch den Ort, der ihr zwar ein sicheres Dach über dem Kopf beschert hatte und in dem sie mit Hannes auch einen Menschen gefunden hatte, dem sie vertrauen konnte, aber in dem sie allein blieb. Nicht einmal Änne Immerath, die schon seit Jahrzehnten darauf gewartet hatte, dass ihr Jean endlich mit einem Mädchen nach Hause käme, ließ sich auf Leonore ein. Sie hatte eingewilligt, dass die junge Fremde – vorübergehend, wie sie streng betont hatte – im leer stehenden Gebäudeteil bleiben konnte, aber sie hatte ebenso schnell begriffen, dass ihr Sohn das Mädchen nicht mitgebracht hatte, um sie zu heiraten. Genauso gut hätte er ihr eine streunende Katze vorstellen können. Die hätte wenigstens nicht diesen fremd klingenden Dialekt gehabt. Aber von ihrem Sessel aus, in dem sie die meiste Zeit des Tages vor sich hin dämmerte, konnte Änne sehen, dass Leonore über Geschick und Fleiß verfügte. »Besser ein eifriges Mädchen als irgendeine Pimock-Bagage!«, raunte sie mehr als einmal in Leonores Anfangsjahren, und das war wohl die größte Anerkennung, die sie der jungen Frau entgegenzubringen vermochte. Immerhin war man so um die erzwungene Einquartierung irgendeiner Flüchtlingsfamilie herumgekommen.
Selbst im Bäckereigeschäft war sie vor den Anfeindungen mancher Dorfbewohner nicht sicher. An gut besuchten Tagen, in der Vorweihnachtszeit, wenn sie sich den Platz hinter der Theke mit Hannes teilte, fand sich kaum jemand, der sich freiwillig von ihr bedienen ließ. Vor allem die weibliche Kundschaft behandelte sie wie Luft. Sie sahen sie nicht nur mit Verachtung und Hochmut an, sie schienen in ihr auch eine Nebenbuhlerin zu sehen. Männer galten als Mangelware – hier wie anderswo –, und so versuchten nicht wenige der unverheirateten Töchter des Dorfes in ihrer Verzweiflung, selbst dem ewigen Junggesellen Jean Immerath schöne Augen zu machen. Sein fortgeschrittenes Alter schien egal zu sein, ebenso sein lahmer Arm, sein verletztes Bein. Er war stets freundlich und führte einen gut gehenden Betrieb. Doch Hannes zeigte sich unbeeindruckt. Weder konnte eine der Frauen sein Herz gewinnen, noch kam ihm in den Sinn, Leonore in der Backstube zu verstecken.
»Sollen sie doch warten, wenn sie sich zu fein sind, von dir bedient zu werden«, sagte er.
»Aber es bedrückt mich, wie sie mich schneiden«, antwortete Leonore.
Hannes jedoch blieb hart: »Du bleibst hier. Wie sollen sie sich denn sonst an dich gewöhnen? Du gehörst hierher: in dieses Dorf und in diesen Laden.«
Leonore empfand es als Qual. Viel lieber knetete sie Teig, oder sie führte die Gänse hinaus über die Wiesen am Escherpfädchen. Die Tiere glotzten sie wenigstens nicht blöd an. Das Escherpfädchen war nicht viel mehr als ein Feldweg, der nur ein paar Meter von Leonores neuem Zuhause von der Herrenstraße in östlicher Richtung aus dem Dorf hinausführte. Am Ende des letzten Gartens, dort, wo der Weg nach Oberembt führte, stand ein steinernes Wegkreuz neben einer Linde. Man musste einen kleinen Anstieg überwinden, den Leonore jedoch im langsamen Tempo der ihr hinterherwatschelnden Gänse kaum bemerkte. Von dort aus überblickte man den gesamten Doppelort: Im Westen lag Lich, mit seiner weithin sichtbaren, dem heiligen Andreas geweihten Kirche. Im Süden erstreckte sich Steinstraß entlang der römischen Verbindung zwischen Köln und Jülich, die dem Dorf zu seinem Namen verholfen hatte. Kurz dahinter begann der riesige Bürgewald. Wie eine schwarze Wand standen die mächtigen Buchen und Eichen hinter der Ortschaft. Ihre Kronen überragten alle Dächer des Ortes.
Leonore betrachtete das Wegkreuz. Es stand aufrecht da, von einem dunklen, kniehohen Jägerzaun umschlossen. Auf einem steinernen Fundament befand sich ein Aufbau mit einer hell getünchten Aussparung, in deren Mitte die Figur einer weiß gewandeten Mutter Gottes stand. Sie fußte auf einem kleinen Sockel. Ihr andächtig zur Seite geneigtes Haupt zierte eine goldene Krone. Die kleinen Hände hatte sie zum Gebet gefaltet, und ihre Füße wurden von Maiglöckchen umrankt. Die kleine Statue war so hoch, wie Leonores Unterarm lang war. Ob sie aus Gips gegossen war oder aus Holz geschnitzt, vermochte Leonore nicht zu sagen. Sie wagte nicht, über den Zaun zu steigen und die Madonna zu berühren. Oberhalb der Figur thronte auf dem spitzen Dach des Aufbaus ein großes, steinernes Kruzifix mit einem Gekreuzigten aus Eisen. Rost lief den grauen Stein hinab, als blutete der Heiland aus seinem ganzen Leib. In Schirwindt hatte sie ihn das letzte Mal bewusst angesehen. Das riesige Kreuz in der Immanuelkirche hatte sie als Kind jeden Sonntag aufs Neue beeindruckt. Sie hatte das Gefühl gehabt, als spürte sie seine Wunden am eigenen Leib. Noch vor ihrer Konfirmation hatte sie Schirwindt verlassen müssen. Hals über Kopf. Zusammen mit ihrem Elternhaus und ihrer Kindheit war auch ihr Glaube dortgeblieben.
Jetzt betrachtete Leonore den getöteten Christus und spürte nichts. Der Ruf eines Falken am Himmel über ihr traf nicht mehr als ihr Trommelfell. Sie fühlte den Westwind und die Sonnenstrahlen auf ihrer Haut, aber tiefer schien nichts in sie dringen zu können. Nicht einmal Zeit war mehr eine Größe, die für Leonore fühlbar war. Stand sie schon seit mehreren Stunden vor dem Wegkreuz oder erst seit wenigen Augenblicken? War dies ihr erster Sommer im Dorf oder ihr zweiter, ihr vierter?
Leonore zuckte zusammen. Die Gänse schlugen aufs Fürchterlichste Alarm. Sie drehte sich um und sah, wie die Vögel auseinanderstoben. Der Falke, dachte Leonore, ohne zu wissen, warum, aber die Gefahr kam nicht aus der Luft. Sie kam das Escherpfädchen heraufgaloppiert und grunzte. Eine Sau hatte es offenbar zum Spaß auf die Gänse abgesehen. Sie bremste ihren Lauf abrupt ab, als sie den Platz erreicht hatte, den zuvor die Vögel besetzt hatten. Diese verteilten sich nun rings um das schwarz und rosa gefärbte Schwein und begafften es noch immer aufgeregt schnatternd. Auch Leonore glotzte das Tier verblüfft an.
»Die Sau ist ausgebüxt. Bis nach Rödingen ist sie gerannt«, hörte Leonore plötzlich eine quakende Stimme. »Bis nach Rödingen – zum Eber!« Der Klang erinnerte sie an ein verstimmtes Klavier.
»Die Sau ist ausgebüxt. Bis nach Rödingen ist sie gerannt. Bis nach Rödingen – zum Eber!« Die Stimme klang wie eine Tonaufnahme, keine Veränderung in Klangfärbung oder Betonung. Dann sah sie ihren Urheber: An seinen Gesichtszügen konnte Leonore abschätzen, dass er kein Kind mehr war, aber auch noch nicht erwachsen. Seine Körpergröße entsprach der eines Achtjährigen.
»Nanu, Gänse«, stutzte der Kleine. Er stand vor den Tieren und betrachtete sie staunend, wie auch Leonore noch immer verblüfft dastand und das Schauspiel verfolgte. Der Junge hatte Leonore höchstens aus dem Augenwinkel angesehen. Sein Blick schien sie beinahe absichtlich zu verfehlen.
»Ich bin der Harbinger Arnold«, sagte er und betonte dabei die erste Silbe seines in dörflicher Sitte vorangestellten Nachnamens derart, dass es klang, als wollte er den Satz auf seinem misstönenden Klavier in ein Lied verwandeln. »Ich bin der Harbinger Arnold.«
Leonore schwieg. Sie besah sich das seltsame, winzige Wesen. Er trug Kleidung, die offensichtlich für Erwachsene gemacht war. Eine einfache Schnur als Gürtel sorgte dafür, dass ihm die Hose nicht herunterrutschte. Auf der Flucht war sie Kindern begegnet, die so aussahen. Sie war selbst eines gewesen.
»Ich bin der Harbinger Arnold. Und wer bist du?«
Leonore schwieg noch immer.
»Das sind die Gänse vom Immerath. Ich kenne doch ihr Schnattern«, sagte er, und Leonore wartete auf die Wiederholung des Satzes. Aber die blieb aus. Stattdessen sprang er wieder zurück: »Ich bin der Harbinger Arnold. Und wer bist du?«
»Ich bin die Klimkeit Leonore«, antwortete sie und bemerkte erst beim Sprechen des Satzes, dass sie die Betonung des Harbinger Arnold übernommen hatte, sodass die erste Silbe ihres Nachnamens klang wie eine ziemlich weit rechts liegende Taste auf einem ziemlich verstimmten Piano.
»Das Flüchtlingsmädchen vom Immerath«, ergänzte der kleine Harbinger und sah knapp an ihr vorbei, sodass Leonore kurz dachte, er meinte jemand anders – ein anderes Flüchtlingsmädchen, das bei Jean Immerath und seiner Mutter untergekommen war und das er schräg hinter ihr wähnte.
»Die Evangelische aus dem Osten.« Offensichtlich wusste dieser Arnold, wer sie war. Sie selbst hatte von diesem seltsamen kleinen Menschlein jedoch noch nie Notiz genommen.
»Was ist mit der Sau?«, fragte Leonore und deutete auf das Schwein, das noch immer inmitten der mittlerweile zur Ruhe gekommenen Gänse auf der Wiese stand.
»Die Sau ist ausgebüxt. Bis nach Rödingen ist sie gerannt. Bis nach Rödingen – zum Eber!« Wieder wiederholte Arnold seinen Satz, der für Leonore nun schon wie der Kehrreim eines altvertrauten Liedes klang. Dennoch verstand sie nicht, was dieses Tier zu ihren Füßen mit der Geschichte zu tun hatte, die sich im Satz des Jungen verbarg. Arnold zeigte keine Mimik, die darauf hindeutete, dass er ihr Unverständnis begriff. Er sagte nur trocken: »Das war neunzehnachtunddreißig. Die Sau kannte den Weg. Sie wurde jedes Jahr dorthin gebracht. Das hier ist eines ihrer Ferkelchen.« Er deutete auf das längst ausgewachsene Tier, nahm das Seil, das er in den Händen hielt, und knotete es dem bereitwillig wartenden Schwein um den Hals.
»Wer einen Bauern betrügen will, muss einen Bauern mitbringen«, sagte er schnell und lief, ohne Leonore ein einziges Mal angesehen zu haben, auf dem Escherpfädchen hinab ins Dorf. »Wer einen Bauern betrügen will, muss einen Bauern mitbringen«, hörte sie ihn noch einige Male in der Ferne krächzen.
Am Abendbrottisch erzählte Leonore Hannes vom Zusammentreffen mit Arnold.
»Oh, da hast du eine echte Rarität kennengelernt«, sagte er. »Normalerweise weiß er sich zu verstecken. Ich selbst sehe ihn oft jahrelang nicht.«
»Wovor versteckt er sich?«
»Na, vor den Leuten«, antwortete Hannes, als sei es eine Selbstverständlichkeit.
»Aber warum?«
Hannes kaute auf seinem Brot herum, setzte die Teetasse an, blätterte in der Zeitung. Dann erst hob er zu einer Antwort an: »Weißt du, als er klein war, ich meine richtig klein, da war er ein normaler Junge. Er kam oft mit seiner Mutter in den Laden. Er grüßte höflich, wie man es ihm beigebracht hatte, und wartete gespannt darauf, dass ich ihm eine oder zwei Moppen gab, wie ich es bei allen Kindern tue. Aber eines Tages war er anders. Er sah mich nicht mehr an. Ich schenkte ihm natürlich trotzdem immer etwas Süßes, aber es half nichts. Ich spürte, wie seine Mutter zunehmend verzweifelte. Irgendwann hat er auch das Sprechen komplett eingestellt. Wenn überhaupt, dann redete er wirres Zeug. Ich bat seine Mutter, ihn nicht zu schelten für seine Unhöflichkeit, denn jedes Mal setzte es Ohrfeigen, wenn er mich nicht grüßen wollte. Er tat mir leid.«
»Warum ist er so geworden?«
»Das kann keiner sagen. Die Leute begannen natürlich zu tuscheln und Gerüchte zu verbreiten. Irgendwelche Sünden, für die der Herrgott die Familie bestrafte. Aber was soll das bitte für ein Gott sein, der auf diese Weise züchtigt?«
Leonore nickte und biss in ein Stück Graubrot.
»Wir bekamen achtunddreißig einen neuen Pfarrer hier im Ort. Der kam aus dem Ruhrgebiet und hatte mitbekommen, wie man anderenorts bereits mit solchen Kindern umging. Die Familie bat den Geistlichen eindringlich um Hilfe. Sie wollten nicht, dass ihr einziger Sohn, so sehr sie auch an ihm verzweifelten, einfach abgeholt und in eine Anstalt gebracht wurde. Gemeinsam mit dem Schulmeister entschied der Pfarrer, dass Arnold versteckt gehalten werden sollte. Er schwor die Gläubigen sogar von der Kanzel darauf ein, was sehr riskant war. Er erwähnte nicht Arnolds Namen und auch nicht die Familie Harbinger, aber allen war klar, wer gemeint war. Arnold sollte nicht eingeschult werden, den elterlichen Hof auf der Prämienstraße am besten gar nicht mehr verlassen, und niemand im Dorf sollte ihn jemals wieder erwähnen. Der Plan ging auf, und selbst die größten Hitler-Verehrer im Ort wagten es nicht, sich den Worten des Pfarrers zu widersetzen, und vergaßen den Harbinger Arnold.« Hannes tauchte seinen Löffel in die Suppe und aß, ganz so, als wäre die Geschichte an dieser Stelle zu Ende.
Leonore begriff auch ohne ein weiteres Wort, warum sich Arnold heute noch versteckte. Es hatten sich nur die Zeiten geändert. Die Menschen waren noch immer dieselben.
3
Schon oft in den letzten fünf Jahren, seit sie in Lich-Steinstraß war, hatte Leonore gedacht, Hannes’ Mutter sei gestorben, friedlich eingeschlafen bei dem, was sie eigentlich immer tat: dasitzen und Kreuzworträtsel lösen. Sie fand Änne Immerath vornübergebeugt sitzend an ihrem Tisch in der Wohnstube zwischen Laden und Bäckerei vor. Der Oberkörper lag flach auf der Zeitung, die Augen waren geschlossen, aus dem Mund lief Speichel und tropfte auf das halb fertig gelöste Rätsel. Aber immer, wenn Leonore die Schulter der greisen Frau berührte, wenn sie ihren Namen sagte, erwachte die Alte und richtete sich blitzschnell auf, wischte ihre Mundwinkel mit dem Handrücken ab und versuchte, den Eindruck zu vermitteln, sie habe nicht geschlafen. Vom Schlaf übermannt zu werden, selbst wenn man keinerlei Verpflichtungen mehr hatte, nicht einmal mehr Kartoffeln schälen oder Bohnen puhlen, galt ihr offenbar als dermaßen anstößig, als Verlust der Kontrolle über das eigene Dasein, dass sie stets beteuerte, nur kurz die Augen geschlossen zu haben.
So auch dieses Mal. Leonore spielte ihr Spiel mit, nickte stumm und wandte sich wieder ihrer Arbeit in der Backstube zu. Hannes, der mit seinem Handkarren im Dorf unterwegs war, hatte sie mittlerweile mehr und mehr mit den verantwortungsvollen Aufgaben eines Bäckers betraut. Er hatte sie in die Geheimnisse des betagten Ofens eingeweiht und ihr sogar einige der alten Familienrezepte verraten.
»Leonore«, rief Änne von nebenan.
Leonore klopfte sich die mehligen Hände an der Schürze ab und ging in die Stube. »Ja, Frau Immerath?«
Die alte Frau deutete auf den Sessel ihr gegenüber. Leonore blickte kurz zurück in die Backstube, zögerte und nahm dann doch Platz.
»Habe ich dir eigentlich schon erzählt, wie das hier war im Krieg?«, fragte Änne mit heiserer Stimme.
Leonore zweifelte an Ännes Verstand. Noch nie, seit sie von dem gestrandeten Pritschenwagen auf der Hauptstraße ausgespuckt worden war, hatte Änne Immerath ihr überhaupt irgendetwas erzählt. All die Jahre hatte sie in den Augen der alten Frau doch nur als notwendiges Übel existiert, als jemand, die dem ebenfalls schon in die Jahre gekommenen und versehrten Sohn unter die Arme greifen konnte, die ihr das eine oder andere Mal das Kissen richten, ihr aus dem Sessel helfen konnte. Von Anfang an hatte Änne ihr zu verstehen gegeben, dass sie zwar geduldet war, aber nicht mehr. Nur die notwendigsten Worte wurden gewechselt. Da ihr Sohn bei Leonore, wie auch bei allen anderen Frauen, keine Anstalten machte, sie zur Frau nehmen zu wollen, handelte es sich bei ihr somit lediglich um Gesinde. Und nun plötzlich, aus dem Nichts heraus erwacht aus einem hastig fortgewischten Traum, stellte sie Leonore diese Frage, die klang, als hätten sich die beiden Frauen bereits über alles andere, das in ihrem Leben von Bedeutung war, ausgetauscht.
»Nein, Frau Immerath, bislang nicht«, erwiderte Leonore langsam, eher fragend, und sah der Alten dabei tief in die Augen.
Sie zeigte keine Anzeichen von Verwirrung oder Wahn. Stattdessen fuhr sie klar und deutlich fort: »Der Krieg kam schon im September neununddreißig in den Ort. Nur wenige Tage nach dem Ausbruch war die Hauptstraße in Steinstraß voller Soldaten. Es schien bald so, als liefe alles, was nach Westen, nach Frankreich fuhr, durch unser Dorf. Wir hatten Einquartierungen, erst nur in der Schule, dann auch in Privathäusern. Auch hier bei uns. Drüben in deiner Wohnung und sogar hinten in der alten Werkstatt. Ständig wechselte die Belegung, aber alle waren frohen Mutes und sehr freundlich. Alle lachten. Hinten am Oberembter Weg haben sie Bunker gebaut, Gräben zur Verteidigung ausgehoben. Und auch im großen Wald errichteten sie Befestigungsanlagen. Wir haben zuerst gar nicht begriffen, warum. Die Front war doch zig Kilometer entfernt. Aber dann kamen schon bald die ersten Angriffe aus der Luft. Sie hatten es auf die Straße abgesehen, jagten mit Tieffliegern über die Köpfe der Soldaten hinweg und schossen mit Maschinengewehren auf sie. Später, dreiundvierzig, kamen dann auch die Bombardements hinzu. Es wurde immer grässlicher. Die Zahl der Familien, die einen Vater oder einen Sohn zu beklagen hatten, die nicht aus dem Krieg zurückkehrten, wuchs von Woche zu Woche. Den Soldaten, die in halb zerschossenen Lastern von Westen kommend durch Steinstraß gefahren wurden, fehlten Arme, Beine oder manchmal auch das halbe Gesicht. Da lachte keiner mehr. Wenn nachts der Fliegeralarm aufheulte, rannte alles in die Bunker. Aber nur selten schlugen Bomben ein. Die großen Verbände nutzten lediglich die alte Römerstraße zur Orientierung. Immer mehr Frauen und Kinder flohen zu Verwandten oder begaben sich auf den Weg ins Ungewisse. Richtung Köln, Richtung Eifel. Als ob es anderswo besser gewesen wäre. Es kam der dreizehnte Juni. In der Nacht gab es Alarm. Ich wollte liegen bleiben, aber Jean, der mir erhalten geblieben war, weil er wegen seiner Verwundungen aus dem Ersten Weltkrieg nicht eingezogen worden war, versuchte mich aus dem Bett zu zerren. Ich sagte ihm, er solle vorlaufen, ich käme nach, aber das war nicht meine Absicht. Ich wollte im Haus bleiben. Es würde schon nichts passieren. Ich ging im Schlafrock in den Laden und sah aus dem Fenster hinaus in den Himmel. Irgendwann hörte ich die Flieger. Sie kamen von Nordwesten, würden vielleicht nach Koblenz fliegen, dachte ich, oder noch weiter. Aber dann explodierten die ersten Bomben. Es gab einen unvorstellbaren Lärm. Die Fensterscheiben klirrten, aber blieben zum Glück heil. Es folgte Einschlag um Einschlag. Von überallher aus dem Dorf schien es zu dröhnen und zu donnern. Bei jeder Explosion bebte das Haus. Ich dachte, jetzt ist es aus. Ich dachte, der Herrgott holt mich zu sich. Jeden Moment würde es so weit sein. Ich war ganz ruhig. Und dann war es vorbei. Das Brummen der Motoren wurde leiser, und über dem ausgebombten Ort lag eine schwere Stille. Ich war noch am Leben. Die Herrenstraße war verschont geblieben, aber ich ahnte, dass drüben in der Prämienstraße und oben in Steinstraß viele Häuser einen Treffer abbekommen hatten. Ich weiß nicht, warum – es gab noch keine Entwarnung, es war stockfinster, und der Gestank von Schwefel lag über dem Dorf –, aber ich ging hinaus auf die Straße. Ich ging, wie ich war, im Nachthemd und mit offenem Haar. Irgendwo auf einem entfernten Hof brüllten Kühe. Sie sind das einzige Geräusch, an das ich mich erinnere. Die Nacht war mild, und meine Füße froren nicht. Ich ging am Pastorat vorbei und blickte auf die Kirche, deren Turm im Rauch verschwand. Ich ging am Kleinfeldchen entlang bis hinauf nach Steinstraß und lief mitten auf der Hauptstraße durch den dunklen und leeren Ort. Mir kam ein Gedanke: War ich vielleicht doch nicht verschont geblieben? War ich vielleicht doch tot? Lief ich deshalb wie von Sinnen im Nachthemd und barfuß durch diesen gottverlassenen Ort? Sollte es nicht auch in der Hölle nach Schwefel riechen?«
Leonore hörte gebannt zu. Sie hatte Steinstraß am Tag ihres Eintreffens ebenfalls als Hölle wahrgenommen. Ein wenig schämte sie sich jetzt dafür. Dieses Dorf war ihr ein Zuhause geworden. Niemand hatte es ihr leicht gemacht, aber sie hatte hier ein sicheres Dach über dem Kopf gefunden, eine Arbeit und nicht zuletzt Hannes, der ihr ein väterlicher Freund geworden war. Seine Mutter hingegen hatte wirklich die Hölle gesehen.