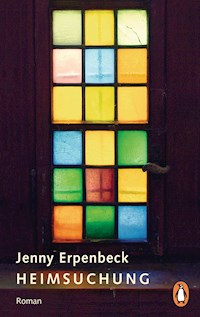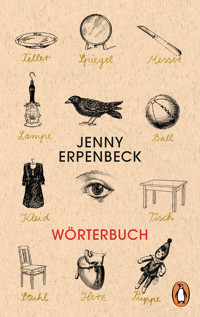16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bücher meines Lebens
- Sprache: Deutsch
»Menschen können gut ohne Gedichte sein, aber ein Gedicht nicht ohne Menschen.« Wie kann es sein, dass eine Strickerin aus dem Lavanttal in Kärnten zu einer der größten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts wird? Jenny Erpenbeck lässt uns an ihrer Faszination für Christine Lavant (1915–1973) teilhaben, deren Gedichte sie zum ersten Mal liest, als sie Mitte der Neunziger in Graz lebt. An der Faszination für eine Frau, die sich durch ihre Lesewut, Sensibilität und Klugheit aus dem elenden Dasein, das ihr durch Krankheit und Armut vorgezeichnet war, herausgeschrieben hat. Christine Lavants tiefgründiger Wahrnehmung des eigenen Leidens steht das zornige Fragen nach dem abwesenden Gott gegenüber, ihrem Stolz als Dichterin die Bescheidenheit der persönlichen Existenz, der Einsamkeit einer Außenseiterin ein unbändiger Humor. Befreundet mit Thomas Bernhard und den Lampersbergers, im Briefwechsel mit Martin Buber und Hilde Domin, in ihrer Liebe zum Maler Werner Berg ist sie zeit ihres Lebens eng verbunden mit Künstlern und Denkern, die in ihr, jenseits der Äußerlichkeiten ihrer zufälligen Existenz, die große Autorin und den warmherzigen Menschen erkennen und schätzen. Ein kraftvoller, ein poetischer Essay, der anschaulich macht, dass eine fremde Welt, die uns durchs Lesen aufgeschlossen wird, immer auch unsere eigene ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jenny Erpenbeck
Jenny Erpenbeck über Christine Lavant
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jenny Erpenbeck
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jenny Erpenbeck
Jenny Erpenbeck, geboren 1967 in Ost-Berlin, debütierte 1999 mit der Novelle »Geschichte vom alten Kind«. Es folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter Romane, Erzählungen und Theaterstücke. Ihr Roman »Aller Tage Abend« wurde von Lesern und Kritik gleichermaßen gefeiert und vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Joseph-Breitbach-Preis und dem Independent Foreign Fiction Prize. Für »Gehen, ging, gegangen« erhielt sie u. a. den Thomas-Mann-Preis. 2017 gewann Jenny Erpenbeck den Premio Strega Europeo und wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Volker Weidermann, geboren 1969 in Darmstadt, war Gastgeber des Literarischen Quartetts im ZDF. Seit 2021 leitet er das Feuilleton der Zeit. Er ist Autor zahlreicher Bücher, u. a. »Ostende. 1936, Sommer der Freundschaft« und »Träumer. Als die Dichter die Macht übernahmen« und Herausgeber der Reihe »Bücher meines Lebens».
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Menschen können gut ohne Gedichte sein, aber ein Gedicht nicht ohne Menschen.« Wie kann es sein, dass eine Strickerin aus dem Lavanttal in Kärnten zu einer der größten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts wird?
Jenny Erpenbeck lässt uns an ihrer Faszination für Christine Lavant (1915–1973) teilhaben, deren Gedichte sie zum ersten Mal liest, als sie Mitte der Neunziger in Graz lebt. An der Faszination für eine Frau, die sich durch ihre Lesewut, Sensibilität und Klugheit aus dem elenden Dasein, das ihr durch Krankheit und Armut vorgezeichnet war, herausgeschrieben hat. Christine Lavants tiefgründiger Wahrnehmung des eigenen Leidens steht das zornige Fragen nach dem abwesenden Gott gegenüber, ihrem Stolz als Dichterin die Bescheidenheit der persönlichen Existenz, der Einsamkeit einer Außenseiterin ein unbändiger Humor.
Befreundet mit Thomas Bernhard und den Lampersbergers, im Briefwechsel mit Martin Buber und Hilde Domin, in ihrer Liebe zum Maler Werner Berg ist sie zeit ihres Lebens eng verbunden mit Künstlern und Denkern, die in ihr, jenseits der Äußerlichkeiten ihrer zufälligen Existenz, die große Autorin und den warmherzigen Menschen erkennen und schätzen.
Ein kraftvoller, ein poetischer Essay, der anschaulich macht, dass eine fremde Welt, die uns durchs Lesen aufgeschlossen wird, immer auch unsere eigene ist.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Dank
Lebensdaten
Vorwort
Ich stelle mir das sehr laut vor und turbulent, tröstlich und eigentlich auch ein bisschen lustig, wenn die Bücher in Jenny Erpenbecks Regalen eines Tages anfangen, miteinander zu sprechen. Was für eine Befreiung wird das sein, nach einem langen, stummen Leben Rücken an Rücken. So viel zu sagen und so lang geschwiegen.
Einmal bin ich mit Jenny Erpenbeck ihre langen Bücherreihen entlanggegangen in ihrer Wohnung im Prenzlauer Berg. Sie zog Buch auf Buch heraus und erzählte ihr Lesen und ihr Leben. Was eine lebendige Bibliothek ist, das habe ich an diesem Nachmittag erfahren. Jenny Erpenbeck lebt die Literatur, sie schreibt all die alten Bücher aus den Regalen in ihrem eigenen Leben fort. Schreibt auch fort, was ihre gleichfalls schreibenden Großeltern und Eltern begonnen hatten.
»Die Bücher sprechen, sie sprechen miteinander im Bücherregal, und sie sprechen miteinander in meinem Kopf«, schreibt Jenny Erpenbeck in dem Buch, das hier vor uns liegt. Es geht darin um das Lesen und was das mit uns macht, wie unser Leben durch die richtigen Bücher von den Füßen auf den Kopf gestellt werden kann, wie wir mit Verzweiflungen umgehen lernen, wie man eine Kühle gewinnt und so die Einsamkeit und Todesnähe und Todesversuchung vielleicht verwandeln kann in etwas Geschriebenes. Es geht darin um das einsame, harte, immer wieder von Verzweiflungen umstellte, in Dichtung gestaltete Leben von Christine Lavant. Wie sie lebte, wie sie schrieb und wie ihr Schreiben Jenny Erpenbeck begleitet, erfüllt, ermutigt hat.
Jenny Erpenbeck ist vor vielen Jahren schreibend in die Welt getreten mit ihrer »Geschichte vom alten Kind«, in der sie ein Mädchen beschreibt, »umgeben von Nichts«, plötzlich in die leere Welt gestellt. Es ist eine der einsamsten Figuren, die ich aus der Literatur kenne.
Dieses alte Kind, so scheint es mir jetzt, ist eine späte, einsame Schwester der Christine Lavant, wie wir sie hier kennenlernen. Leise, aber gewaltig. Die über sich selbst und die Möglichkeiten ihrer Dichtung diesen ungeheuren Satz sagte: »Wenn ich dichtete, risse ich jede Stelle Eures Daseins unter Euren Füßen weg und stellte es als etwas noch nie von Euch Wahrgenommenes in Euer innerstes Gesicht.«
Was das alles bedeutet und bedeuten kann, das hat Jenny Erpenbeck hier für uns aufgeschrieben.
Volker Weidermann
1
Wann ist der richtige Moment, um ein Gedicht zu lesen?
Wenn der Bildschirm meines Computers flimmert und die Neuinstallierung eines sogenannten Treibers dreieinhalb Stunden dauert?
Wenn ich auf einem Flughafen warte oder auf einem Bahnhof, wenn ich in einem Flugzeug sitze oder in einem Zug?
Wenn ich in einem Hotelzimmer bin und zwischen Ankunft und Veranstaltung einen Nachmittag freihabe?
Wenn ein Termin ausfällt und ich in der unverhofft freien Zeit auch Anrufe machen könnte, das Formular für die Steuer ausfüllen, Fenster putzen oder einen Brief an einen Freund schreiben?
Wenn ich weiß, ich könnte auch diesen oder jenen Roman zu lesen beginnen, der schon seit Jahren auf einem Stapel zusammen mit anderen Büchern darauf wartet, von mir gelesen zu werden?
Warum sollte ich, wenn ich Prosa lesen könnte, ein Gedicht lesen?
Während der wenigen Minuten, in denen ich diese Zeilen geschrieben habe, sind in der rechten unteren Ecke meines Bildschirms ungefragt drei Fenster aufgeklappt. Zuerst ein Angebot für eine Software: »15 Euro – nur noch bis morgen.« Dann eine Anzeige »Sie haben neue Nachrichten«. Drittens ein blau-weißer Hinweis: »Es ist eine kostenlose Programmaktualisierung verfügbar.« Mit meinem Computer bin ich in der Welt, auch wenn ich mutterseelenallein an meinem Schreibtisch sitze. Was ist das für eine Welt?
Der Herbst legt, wie jedes Jahr, den Ausblick aus meinem Fenster schichtweise wieder frei, Baum für Baum wird gelb, wird kahl. Unten ist der allwöchentliche Flohmarkt, Geschirr gibt es da aus Haushalten, die längst aufgelöst sind, auch Fotoalben. Letzten Sonntag erst habe ich im Vorbeigehen eines in die Hand genommen und aufgeschlagen: Mit meiner Inge im Harz – Juli 1953, stand da in weißer Tinte auf dem schwarzen Fotokarton zu lesen, darunter war das Bild einer jungen Frau eingeklebt, die lächelnd auf einem Felsen steht. Hab weitergeblättert: Hochzeitsfotos, Kinderfotos. Wir müssen alle sterben, das ist uns wohlbekannt, habe ich gedacht und das Album wieder zurückgelegt, es nicht dem Vergessen entrissen, es nicht gekauft, die fremde tote Familie, die niemanden mehr etwas angeht, nicht zu meiner eigenen gemacht. Die, die wir lieben, werden uns verloren gehen. Und wir uns selbst. Und unsere Erdkugel ist ein einsamer Ball, hingehängt in einen riesigen schwarzen Raum.
2
»Gedichte mochte ich überhaupt nicht lesen, weil man dabei nicht stricken kann«[1], schreibt die österreichische Schriftstellerin Christine Lavant 1957 in einer biografischen »Selbstdarstellung«. Da ist sie knapp über vierzig und hat den größten Teil ihres Werkes – an die zweitausend Gedichte und tausende Seiten Prosa – bereits geschrieben. In einer der beiden Filmaufnahmen, die es von ihr gibt, sieht man, wie sie beim Lesen strickt. Die strickenden Hände in Bewegung unter dem Tisch, auf dem Tisch vor ihr ein dickes Buch und sie, die stark Kurzsichtige, mit der Nase direkt über den Seiten. Mit dem Stricken hat sie sich, und von ihrer Heirat an auch ihren Ehemann, den Landschaftsmaler und verarmten Gutsherrn Josef Habernig, erhalten. »Ja, und es ist so, dass ich froh sein muss, soviel Strickarbeit zu haben, obwohl mir dies die Nerven kleinweis zerhämmert, bis ich jede Nacht jeden einzelnen in mir frei zittern spüre, als bestünde ich aus lauter dünnen Fäden, die einmal ein Netz waren und nun lose winzige Stücke sind, und als hinge der Kopf in einem tanzenden Ballon. Aber das ist dennoch gut so, denn es hält die andere Pein – die des Nimmerkönnens in einem gewissen Abstand von mir.«[2] Des Nimmerkönnens. Als neuntes Kind eines Bergarbeiters und einer Flickschneiderin in einem kärntnerischen Straßendorf geboren, seit der Geburt von schwersten Krankheiten gepeinigt, immer am Rande des Todes, hat sie Erfahrung damit, auf der Kippe zu stehen. Körperlich – ebenso wie sozial. Geliebt von der Familie, ausgestoßen von den Schulkameraden, hat sie unter Schmerzen ihr Selbstbewusstsein entwickelt, hat wie besessen gelesen und schon als Zwölfjährige zu schreiben begonnen, aber ist sich auch später, nachdem sie für die Veröffentlichung ihres ersten Buchs den Künstlernamen Lavant angenommen und die erste Anerkennung als Autorin erfahren hat, ihrer gespaltenen Existenz bewusst geblieben. »Wenn ich nicht mehr dichten kann, dann habe ich auch nicht das Recht, Menschen zu treffen, welche ich als Chr. Lavant kennengelernt habe. Das ist doch klar? Was kann euch an dem armseligen Strickweiblein liegen? Mit diesem habt ihr gar nichts gemein. Dieses hat ein schlechtes, zusammengeschrumpftes Stück Leben, den abgenutzten Lappen eines von Haus aus wertlosen Lebens. Niemand von euch würde diesen Lappen auch nur mit Handschuhen anfassen wollen, so ist es.«[3]
Ab 1950 bekommt sie nach der ersten öffentlichen Lesung ihrer Gedichte, die die anwesenden anderen Schriftsteller und Künstler tief beeindruckt, eine monatliche Künstlerhilfe vom Land Kärnten in Höhe von 1200 Schilling zugesprochen, das entspricht damals einem Angestelltengehalt. In einem Brief schreibt sie: »Heut Nachmittag muss ich noch das Notwendigste waschen und dann bis weit über Mitternacht stricken. Wegen dem Geld müsste es momentan ja nicht sein, aber ich darf nicht um einer augenblicks besseren Lage willen alle Kundschaften verlieren, und so muss man halt sich abmühen.«[4] Auch, nachdem sie für ihre Lyrik sowohl 1954 zusammen mit drei anderen Dichtern als auch 1964 als einzige Preisträgerin zum zweiten Mal den Georg-Trakl-Preis erhalten hat, sowie 1970 den Großen Österreichischen Staatspreis, lebt sie, abgesehen von anderthalb Jahren, die sie in Klagenfurt verbringt, in ihrer Dachkammer bei den Lintschnigs, einer befreundeten Kaufmannsfamilie, in ihrem Geburtsort St. Stefan bei Wolfsberg in Kärnten. Beinahe fünfundzwanzig Jahre in einer kleinen Dachkammer mit Ölofen, zu der später noch eine Küche dazukommt. Erst in den letzten Lebensjahren hat sie dort fließend Wasser. Das Haus, unter dessen Dach sie bis zu ihrem Tode lebt, ist einen kurzen Fußweg von dem Haus entfernt, in dem sie 1915 geboren wurde und mit ihren Eltern und Geschwistern in einer einzigen Stube aufgewachsen ist. Und auch nur einen kurzen Fußweg entfernt von dem Friedhof, auf dem sie begraben liegt.
3
Fünf Jahre meines Lebens habe ich in Österreich gelebt. Bin Mitte der Neunziger einem Arbeitsangebot nachgereist und dabei vor der Frage »Sie waren sicher sehr froh, als die Mauer fiel …?« entwichen in den Süden, wo kaum jemand danach gefragt hat. Den Container für meinen Umzug packte ich auf einem Ostberliner Hinterhof ein. Abgestellt wurde er zwei Wochen später auf einem Schlosshof in der Nähe von Graz. In dem Schloss war ein Zimmer zu vermieten gewesen, zu ebener Erde links am Schlosshof, ein ehemaliger Wirtschaftsraum ohne viel Komfort – aber mit gewölbter Decke, vierhundert Jahre alten Beschlägen an der Tür und zwei Meter dicken Mauern.
Grüß Gott, sagt die siebzigjährige Miezel, als sie mir das Tor aufschließt, und reicht mir zur Begrüßung die Hand hin. So eine Hand ist das, sehe ich, die ein ganzes Leben lang in der Erde gegraben, in Haushalten geputzt, gekocht und geschleppt hat. Dünne Haut über Knochen. Guten Tag, antworte ich und versuche, diese Hand nur vorsichtig zu drücken, damit sie nicht entzweigeht. Vom Fenster aus kann man den Schekl sehen, zeigt Miezel mir den Ausblick aus meinem zukünftigen Zimmer. Den Schekl? Ich blicke aus dem Fenster, sehe eine flache Kuppe über Bäumen, aber weiß nicht, was sie meint. Der Berg da, das ist der Schekl. Mit der knochigen, jahrhundertealten Hand zeigt sie ihn mir, den Schöckl, den Hausberg von Graz. Ich lache, weil ich so fremd bin und nicht wusste, was der Schekl ist, und sie lacht auch, weil ich so fremd bin und nicht wusste, was jeder hier weiß. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen, sagt sie, und ich sage, ja, das glaube ich auch. Dann fange ich mit dem Auspacken an, trage meine Stehlampe aus dem Container ins Zimmer hinüber, und meinen kleinen quadratischen Holztisch, und einen Kleiderständer, der mir den Schrank, für den ich hier keinen Platz habe, ersetzen wird. Der Schrank ist in Berlin geblieben, meine Tagebücher habe ich hineingelegt und den Schrank dann abgeschlossen, sozusagen als Kern der nun untervermieteten Wohnung, als das, was meine Anwesenheit dort sein soll für die Zeit meiner Abwesenheit. Damit meine Heimatstadt mir nicht verloren geht und ich nicht meiner Heimatstadt. Kleider und Bücher und Schuhe und Geschirr bringe ich aus dem Container in mein neues Zimmer. Bei Einbruch der Dämmerung erscheint der junge Graf mit geschultertem Gewehr, grüß Gott!, um auf die Jagd zu gehen. Auf die Jagd? Mit meinem Kopf, in dem Marx/Engels/Lenin stecken, stehe ich auf dem Buckelpflaster des Schlosshofs, im Rücken einen gekreuzigten Jesus, und blicke dem Jäger nach. Wohin bin ich umgezogen?
4
Das Kind Christl Thonhauser muss Hals, Kopf, oft auch die Augen verbunden tragen und ist von Erblindung bedroht. Lungenentzündungen. Eine halbseitige Ertaubung. Zwei Kinder der Mutter sind kurz nach der Geburt gestorben, die übrigen sieben wohnen mit den Eltern in einer einzigen Stube. Die Verwandten, die der Familie die Stube vermieten, weigern sich, ihnen noch ein weiteres Zimmer, das verfügbar wäre, zu geben. Und so schlafen drei Kinder im Bett der Mutter, eins auf dem alten Diwan, zwei im Keller und das jüngste in einer Schublade, die tagsüber unter das Bett geschoben wird. Dieses jüngste ist Christl. Ihre ersten Jahre überlebt sie nur durch die Zuwendung und Rücksicht ihrer Geschwister, durch die Liebe der Mutter. »Ich habe Mutter nie wirklich essen sehen, sie hat immer nur das für sich behalten, was sie von dem Boden der Häfen [d.i. Schüsseln] noch abschaben konnte«[5], schreibt sie im Rückblick. Die Geschwister unternehmen stundenlange Wanderungen, um bei Bergbauern Milch für die Schwester zu erbetteln. Die Mutter legt das Mädchen, das oft zu krank ist, um draußen zu spielen, neben sich auf das Fensterbrett, wenn sie an der Nähmaschine sitzt. Damit es Sonne hat. »Zwei Fäuste breit«[6], schreibt Christine Lavant, war dieses Fensterbrett. Ihr Vater, der Bergarbeiter, ist nach einer Explosion unter Tage schwerhörig und kann nur noch die schlechter bezahlte Arbeit über Tage machen, manchmal stellt er Fallen für Iltisse auf und verkauft die Felle, manchmal macht er kleine Steinmetzarbeiten, zeitweise ist er ganz arbeitslos. Auch der Bruder von Christl hat keine Arbeit. Um die Kinder eine Lehre machen zu lassen, fehlt es den Eltern an Geld. Die Schwestern von Christl gehen, wenn sie Glück haben, »in Stellung« als Küchenhilfen und Dienstmädchen nach Wolfsberg, Klagenfurt oder St. Andrä. Sie, Christl, die Jüngste, ist dafür zu krank.
Unsere Mutter ist keine Dame gewesen.
Einmal hat sie dem Rauchfangkehrer
seinen Glückwunsch zu Neujahr nicht bezahlt
weil kein Bissen im Haus war.
Der hat dann bei allen Bauern erzählt
dass sie ein geiziges Weiblein sei
und schon so ausschaut wie eine Hexe.
Im Winter haben die Bäurinnen Zeit
und da sind gleich drei auf einmal gekommen
mit Wäsche zum Flicken und anderen Fetzen
und haben ihr alles wiedererzählt
von dem Lümmel dem Rauchfangkehrer.
Damals ist mir zum ersten Mal
in Mutters winzigem Mundwinkellächeln
die Blume der Armut so aufgefallen
dass ich die Stube verlassen musste
weil niemand wert ist das anzuschauen
und gar zu erkennen.
Seit diesem Tage habe ich Gott
immer um diese Blume gebeten
aber die Armut allein tuts wohl nicht
denn mein Lächeln ist bloß eine Distel.[7]