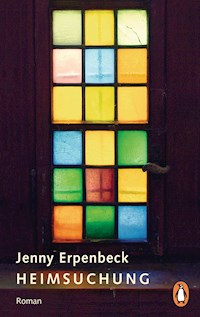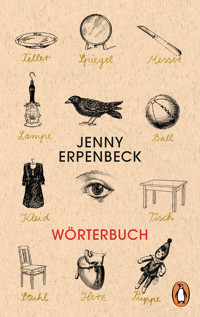12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine der größten lebenden Erzählerinnen, die (nicht nur) wir haben.« Andreas Platthaus, FAZ
Die neunzehnjährige Katharina und Hans, ein verheirateter Mann Mitte fünfzig, begegnen sich Ende der achtziger Jahre in Ostberlin, zufällig, und kommen für die nächsten Jahre nicht voneinander los. Vor dem Hintergrund der untergehenden DDR und des Umbruchs nach 1989 erzählt Jenny Erpenbeck in ihrer unverwechselbaren Sprache von den Abgründen des Glücks – vom Weg zweier Liebender im Grenzgebiet zwischen Wahrheit und Lüge, von Obsession und Gewalt, Hass und Hoffnung. Alles in ihrem Leben verwandelt sich noch in derselben Sekunde, in der es geschieht, in etwas Verlorenes. Die Grenze ist immer nur ein Augenblick.
»Erpenbecks beklemmende Entfaltung einer Amour fou, die mit dem Untergang des Staates synchronisiert wird, entwickelt einen beispiellosen Sog. Es ist ein großer, schöner und grausamer Liebesroman, der zu Recht ausgezeichnet worden ist.« Adam Soboczynski, Die Zeit
»Jenny Erpenbeck erzählt in ›Kairos‹ von der existentiellen Verlorenheit einer ganzen Generation.« Maike Albath, Deutschlandfunk ›Büchermarkt‹
»Erpenbeck demonstriert in ›Kairos‹ ihre sprachlichen und literarischen Qualitäten.« Gerrit Bartels, Tagesspiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jenny Erpenbeck
KAIROS
Roman
Dieser Roman ist ein Werk der Fiktion. Handlung und handelnde Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären rein zufällig.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Copyright © 2021 Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenISBN978-3-641-23871-1V007www.penguin-verlag.de
PROLOG
Wirst du zu meiner Beerdigung kommen?
Sie sieht nach unten, auf die Kaffeetasse, die vor ihr steht, und sagt nichts.
Wirst du zu meiner Beerdigung kommen, fragt er noch einmal.
Sie sagt, du bist doch noch ganz lebendig.
Aber er fragt ein drittes Mal: Wirst du zu meiner Beerdigung kommen?
Ja, sagt sie, natürlich werde ich zu deiner Beerdigung kommen.
Eine Birke steht neben dem Platz, den ich mir ausgesucht habe.
Schön, sagt sie.
Vier Monate später ist sie in Pittsburgh, als sie die Nachricht erreicht, dass er gestorben sei.
Es ist ihr Geburtstag, aber noch vor der ersten Gratulation aus Europa ruft Ludwig sie an, sein Sohn, und sagt: Vater ist heute gestorben.
An ihrem Geburtstag.
Als seine Beerdigung stattfindet, ist sie noch immer in Pittsburgh.
Früh um fünf, zehn Uhr Berliner Ortszeit, steht sie pünktlich zum Beginn der Zeremonie auf, stellt eine Kerze auf den Hotelzimmertisch, zündet sie an und spielt Musik für ihn aus dem Internet.
Den 2. Satz des d-Moll-Konzerts von Mozart.
Die Aria der Goldberg-Variationen von Bach.
Die Chopin-Mazurka in As.
Jedes dieser Musikstücke hat Unterbrechungen, in denen Werbung gezeigt wird.
Der neue Hyundai. Eine Bank, die Hauskredite vergibt. Ein Medikament gegen Schnupfen.
Als sie sechs Wochen später aus Pittsburgh nach Berlin zurückkehrt, sieht sie den frischen Sandhügel und daneben die Birke. Die Rosen, die sie ihm von einem Freund hat aufs Grab legen lassen, sind schon weggeräumt. Der Freund erzählt ihr, wie die Beerdigung war. Musik wurde gespielt.
Was denn?, fragt sie.
Mozart, Bach und Chopin, sagt der Freund.
Sie nickt.
Ein halbes Jahr später ist ihr Mann zu Hause, als eine Frau zwei große Kartons abgibt.
Sie hat geweint, sagt er, ich hab ihr ein Taschentuch gegeben.
Bis in den Herbst hinein stehen die Kartons bei Katharina im Arbeitszimmer.
Wenn die Putzfrau kommt, räumt Katharina sie aufs Sofa, und wenn das Zimmer sauber ist, wieder zurück auf den Fußboden. Wenn sie die Bücherleiter aufstellen muss, schiebt sie sie beiseite. In ihrem Regal ist kein Platz für zwei große Kartons. Der Keller war gerade überschwemmt. Ob sie sie einfach so, wie sie sind, zum Müll bringen soll? Sie macht den oberen Karton auf und schaut hinein. Dann macht sie ihn wieder zu.
Kairos, der Gott des glücklichen Augenblicks, habe, so heißt es, vorn über der Stirn eine Locke, einzig an der kann man ihn halten. Ist aber der Gott erst einmal auf seinen geflügelten Füßen vorübergeglitten, präsentiert er einem die kahle Hinterseite des Schädels, blank ist die und nichts daran ist mit Händen zu greifen. War der Augenblick ein glücklicher, in dem sie damals, als neunzehnjähriges Mädchen, Hans traf? An einem Tag Anfang November setzt sie sich auf den Fußboden und beginnt, Blatt für Blatt, Mappe für Mappe, den Inhalt des ersten, dann des zweiten Kartons durchzusehen. Im Grunde genommen ist es ein Trümmerfeld. Die ältesten Aufzeichnungen sind aus dem Jahr 86, die jüngsten von 92. Briefe findet sie und Durchschläge von Briefen, Notizen, Einkaufszettel, Jahreskalender, Fotos und Negative von Fotos, Postkarten, Collagen, hier und da einen Zeitungsartikel. Ein Stück Zucker aus dem Café Kranzler zerbröselt ihr in den Händen. Gepresste Blätter fallen zwischen Seiten heraus, Passfotos sind mit Büroklammern an Seiten geheftet, in einer Streichholzschachtel steckt ein Büschel Haare.
Auch sie hat einen Koffer mit Briefen, Durchschlägen von Briefen und Erinnerungsstücken, Flachware das meiste davon, wie das in der Sprache der Archive heißt. Hat ihre Tagebücher und Kalender. Am nächsten Tag steigt sie auf die Bücherleiter und holt den Koffer aus dem obersten Fach, staubig ist der, außen und innen. Vor langer Zeit haben die Papiere, die aus seinen Kartons und die aus ihrem Koffer, einen Dialog miteinander geführt. Jetzt führen sie einen Dialog mit der Zeit. In so einem Koffer, in so einem Karton, liegen Ende, Anfang und Mitte gleichgültig miteinander im Staub der Jahrzehnte, liegt das, was zum Täuschen geschrieben wurde, und das, was als Wahrheit gedacht war, das Verschwiegene und das Beschriebene, liegt all das, ob es will oder nicht, eng ineinandergefaltet, liegt das sich Widersprechende, liegen der stummgewordene Zorn ebenso wie die stummgewordene Liebe miteinander in einem Umschlag, in ein und derselben Mappe, ist Vergessenes genauso vergilbt und zerknickt wie das, woran man sich noch, dunkel oder auch hell, erinnert. Katharina muss, während ihre Hände beim Durchsehen der alten Mappen auch staubig werden, daran denken, wie ihr Vater bei ihren Kindergeburtstagen immer als Zauberer auftrat. Einen ganzen Stoß Spielkarten hatte er in die Luft geworfen und dann aus den herumfliegenden Karten doch die eine herausgezogen, die sie oder eines der anderen Kinder sich vorher gemerkt hatte.
Nichts ist als Ich und Du:
und wenn wir zwei nicht sein,
So ist Gott nicht mehr Gott,
und fällt der Himmel ein.
Angelus Silesius
KARTON I
I/1
An diesem Freitag im Juli dachte sie: Wenn der jetzt noch kommt, bin ich fort.
An diesem Freitag im Juli arbeitete er an zwei Zeilen den ganzen Tag. Das Brot ist saurer verdient, als einer sich vorstellen kann, dachte er.
Sie dachte: Dann soll er zusehen.
Er dachte: Und heut wird’s nicht mehr besser.
Sie: Vielleicht ist die Schallplatte schon da.
Er: Bei den Ungarn soll es den Lukács geben.
Sie nahm Handtasche und Jacke und ging hinaus auf die Straße.
Er griff sein Jackett und die Zigaretten.
Sie überquerte die Brücke.
Er ging die Friedrichstraße hinauf.
Und sie, weil der Bus noch nicht in Sicht war, auf einen Sprung nur ins Antiquariat.
Er passierte die Französische Straße.
Sie kaufte ein Buch. Und der Preis für das Buch war 12 Mark.
Und als der Bus hielt, stieg er ein.
Das Geld hatte sie passend.
Und als der Bus eben die Türen schloss, kam sie aus dem Laden.
Und als sie den Bus noch warten sah, begann sie zu laufen.
Und der Busfahrer öffnete für sie, ausnahmsweise, noch einmal die hintere Tür.
Und sie stieg ein.
Auf Höhe des Operncafés verfinsterte sich der Himmel, beim Kronprinzenpalais brach das Gewitter los, ein Regenschauer wehte die Passagiere an, als der Bus am Marx-Engels-Platz hielt und die Türen auftat. Etliche Menschen drängten herein, um sich ins Trockne zu retten. Und so wurde sie, die zunächst dem Eingang stand, zur Mitte geschoben.
Die Türen schlossen sich wieder, der Bus fuhr an, sie suchte nach einem Haltegriff.
Und da sah sie ihn.
Und er sah sie.
Draußen ging eine wahre Sintflut hernieder, drinnen dampfte es von den feuchten Kleidern der Zugestiegenen.
Nun hielt der Bus am Alex. Die Haltestelle aber war unter der S-Bahn-Brücke.
Nach dem Aussteigen blieb sie unter der Brücke stehen, um auf das Ende des Regens zu warten.
Und auch alle anderen, die ausgestiegen waren, blieben unter der Brücke stehen, um auf das Ende des Regens zu warten.
Und auch er war ausgestiegen und blieb stehen.
Und da sah sie ihn ein zweites Mal an.
Und er sah sie an.
Und weil sich durch den Regen die Luft abgekühlt hatte, zog sie nun ihre Jacke über.
Sie sah ihn lächeln, und lächelte auch.
Aber dann verstand sie, dass sie ihre Jacke über den Riemen ihrer Handtasche gezogen hatte. Da schämte sie sich vor seinem Lächeln. Sie ordnete alles richtig an und wartete weiter.
Dann hörte der Regen auf.
Bevor sie unter der Brücke hervortrat und losging, sah sie ihn ein drittes Mal an.
Er erwiderte ihren Blick und setzte sich in die gleiche Richtung wie sie in Bewegung.
Nach wenigen Schritten blieb sie mit ihrem Absatz im Pflaster stecken, da verlangsamte auch er seinen Schritt. Es gelang ihr, den Schuh schnell herauszuziehen und weiterzugehen. Und er nahm das Tempo, in dem sie ging, sogleich wieder auf.
Nun lächelten beide im Gehen, den Blick zu Boden gerichtet.
So gingen sie – treppab, durch den langen Tunnel, dann wieder aufwärts, auf die andere Seite der Straße.
Das Ungarische Kulturzentrum schloss um 18 Uhr, und es war fünf Minuten über die Zeit.
Sie wendete sich zu ihm und sagte: Es ist schon geschlossen.
Und er antwortete ihr: Trinken wir einen Kaffee?
Und sie sagte: Ja.
Das war alles. Alles war so gekommen, wie es hatte kommen müssen.
An diesem 11. Juli im Jahr 86.
Wie wurde er das junge Ding nun wieder los? Was, wenn ihn jemand hier mit dem Mädchen sah? Wie alt mochte sie sein? Ich trink den Kaffee schwarz, denkt sie, und ohne Zucker, dann nimmt er mich ernst. Konversation machen und dann schnell wieder weg, denkt er. Wie heißt sie? Katharina. Und er? Hans.
Zehn Sätze später weiß er, dass er sie schon einmal gesehen hat. Bei einer Maidemonstration vor vielen Jahren war sie das schreiende Kind an der Hand ihrer Mutter gewesen. Erika Ambach, die Mutter. Sie erzählt etwas von »Zopf abgeschnitten« und nippt an ihrem schwarzen Kaffee. Ihre Mutter hatte damals als Doktorandin in demselben Akademiegebäude gearbeitet, in dem auch das erste Forschungslabor seiner Frau untergebracht war. Sie sind verheiratet? Jaja. Er erinnert sich tatsächlich an sie, das heißt an die kurzgeschorene Göre, die erst aufhörte mit dem Schreien, als die Mutter sie sich oben auf die Schultern setzte. Der Wechsel der Perspektive hatte den Kummer des Kindes gestillt. Den Trick hatte er sich gemerkt und ihn später auch bei seinem eigenen Sohn angewandt. Sie haben einen Sohn? Ja. Wie heißt er denn? Ludwig. Der Ludewig, der Ludewig, das ist ein arger Wüterich, sagt sie und hofft, dass er lacht. Er lacht und sagt: Meine Lieblingsstelle ist die: Er schrie: Wer hat mich da verbrannt? / Und hielt den Löffel in der Hand. Zur Illustration hebt er seinen Kaffeelöffel an. Nur zehn Jahre zurück, da saß die Mutter also bei ihr noch auf der Bettkante und las ihr aus dem »Struwwelpeter« vor, bis sie in Schlaf fiel, er legt den Löffel wieder ab und nimmt sich eine Zigarette. Rauchen Sie? Nein. An den abgeschnittenen Zopf erinnert sie sich, auch an die Demonstration und an ihre Scham, so entstellt unter Leute zu gehen. Aber sie hat vergessen, dass die Mutter sie damals zum Trost auf die Schultern hob und an der Tribüne vorbeitrug. Seltsam, denkt sie, da hat in diesem fremden Kopf all die Jahre ein kleines Stück aus meinem Leben gesteckt. Und jetzt gibt er es mir wieder. Sind ihre Augen blau oder grün? Ich muss bald gehen, sagt er. Sieht sie ihm an, dass er lügt, dass heute weder Frau noch Sohn auf ihn warten? Der Sohn ist vierzehn, sie muss dann wohl achtzehn oder neunzehn sein. Denn schon 70 hat seine Frau das Institut gewechselt und ist im Jahr drauf schwanger geworden. Neunzehn, sagt sie und versenkt nun doch ein Stück Würfelzucker im schwarzen Kaffee. Aber die Haare sind nachgewachsen inzwischen. Ja, gottseidank. Aussehen tut sie wie sechzehneinhalb. Höchstens. Dann studieren Sie schon? Ich lerne Setzer, bin im Staatsverlag, will dann Gebrauchsgrafik studieren in Halle. Kunst machen also. Naja, wenn ich die Eignungsprüfung bestehe. Und Sie? Ich schreibe. Romane? Ja. Richtige Bücher, die es im Buchladen gibt? Aber ja, sagt er und denkt, dass sie ihn jetzt gleich nach seinem Nachnamen fragen wird. Hans wie?, fragt sie nun auch, und er sagt ihr den Namen, sie nickt, aber kennt ihn offenbar nicht. Das wird nichts für Sie sein, was ich schreibe. Woher wollen Sie das wissen, sagt sie, und greift nun doch nach der Sahne. Als sein erstes Buch erschien, war sie gerade geboren. Laufen gelernt hat er unter Hitler. Warum sollte ein Mädchen wie sie ein Buch lesen, in dem es um Sterben und Tod geht? Sie denkt, dass er ihr das Lesen nicht zutraut. Und er denkt, dass er Angst davor hat, in diesen jungen Augen ein alter Mann zu sein. Und was macht Ihre Mutter inzwischen? Die arbeitet im Naturkundemuseum. Und Ihr Vater? Der ist seit fünf Jahren Professor in Leipzig. Wofür? Kulturgeschichte. So. Es fallen noch einige Namen, der Freundeskreis ihrer Eltern, ihr Freundeskreis und die Eltern dazu. Er kennt all die alten Geschichten, jeder hat mit jeder mal was gehabt, erst waren sie jung, dann haben sie überkreuz Kinder gezeugt, haben geheiratet und sich wieder getrennt, waren verliebt, verfeindet, befreundet, haben intrigiert oder sich rausgehalten. Immer dieselben Leute auf Feten, in Kneipen, bei Ausstellungseröffnungen oder Theaterpremieren. In so einem kleinen Land, aus dem man nicht ohne weiteres wegkam, lief alles zwangsläufig auf Inzucht hinaus. Mit der Tochter von dieser Ambach sitzt er jetzt also da im Café. Die Sonne blinkt von den verspiegelten Fenstern des Palasthotels herüber. Das sieht aus wie in New York, sagt er. Waren Sie schon mal da? Ja, für meine Arbeit. Ich fahre im August vielleicht nach Köln, sagt sie, wenn es genehmigt wird. Westverwandtschaft? Meine Großmutter wird siebzig. Köln ist ein scheußliches Nest, sagt er. Immerhin steht da der Kölner Dom, sagt sie, und der ist sicher nicht scheußlich. Was ist der Kölner Dom, verglichen mit einer Kremlkirche in Moskau? Ich war noch nie in Moskau. Irgendwann sind die Tassen leer und auch das kleine Wodkaglas, das vor Hans steht, er sieht sich um nach dem Kellner. Aber nun hat das Mädchen ihr Gesicht auf die Hände gestützt und schaut ihn wieder an. Schaut so klar aus ihrem Gesicht heraus. Lauter. Ein Wort, das aus der Mode gekommen ist. Die Absicht ist edel, und lauter und rein. »Zauberflöte«, I. Akt. Ihre Arme sehen so glatt aus. Ob sie am ganzen Körper so ist?
Jetzt muss er zusehen, dass die Rechnung schnell kommt.
Am Ausgang vermeidet er, ihr die Hand zu geben, und sagt nur: Man sieht sich.
Die drei Schritte bis hinaus auf die Straße gehen sie noch zusammen, dann nickt er ihr zu, dreht sich um und geht los. Sie geht auch los, in die andere Richtung, aber nur bis zur Ampel. Da bleibt sie stehen. Seinen Nachnamen weiß sie. Die Adresse bringt sie sicher leicht in Erfahrung. Einen Brief in den Briefkasten oder vor seinem Haus auf ihn warten. Die Straßenbahn klingelt, Autos fahren durch Pfützen, die Fußgängerampel wird grün, wird wieder rot. Bis in die Fingerspitzen hinein tut dieses Gefühl ihr weh. Sie steht immer noch da, die Fußgängerampel wird grün, wird wieder rot. Sie hört das Schmatzen der Autoreifen auf dem nassen Asphalt. Ohne ihn will sie nirgends mehr hingehen. Man sieht sich, hat er gesagt. Man sieht sich. Hat ihr nicht einmal die Hand gegeben. Hat sie sich so geirrt? Aber da sagt er plötzlich in ihren Rücken hinein: Oder wollen wir den Abend vielleicht doch zusammen verbringen? Frau und Sohn seien für eine Nacht auf dem Land bei einer Freundin.
Vom Alex fährt man mit der U-Bahn bis Pankow, von dort mit der Straßenbahn noch drei Stationen, dann schräg über den Platz, unter dem Baum mit den abgeschnittenen Zweigen hindurch. Der hat eine seltsame Frisur, dieser Baum, sagt er, sie lächelt, aber weil sie die ganze Zeit über schon lächelt, sieht man den Unterschied nicht, dann ins Haus und hinauf in den vierten Stock.
Die Wohnung riecht nach Parfum. Ein Teppich im Vorraum und eine Truhe, an der Wand Ölbilder, Grafiken, Fotos, Petersburger Hängung, sagt er, sie nickt und schaut. Seit zwanzig Jahren wohnen wir hier, sagt er, kommen Sie, ich führ Sie herum. Sie folgt ihm in den schmalen Flur, der nach links abzweigt, bis zu einer offenstehenden Tür. Die Küche, sagt er, sie sieht eine Anrichte, ein Abwaschbecken, einen Küchentisch, blau angestrichen, und eine hölzerne Eckbank, hinter der Bank ist ein Fenster zum Hof. Es gibt nicht einmal einen Baum, sagt er, aber jeden Morgen singt da eine Amsel, wer weiß, warum es ihr ausgerechnet da gefällt. Im Abwaschbecken ein Topf und ein paar Gläser. Das Geschirr vom Frühstück steht noch auf dem Tisch, und ein Honigglas, sie sieht Eierschalen auf den Tellern, eine Teekanne aus weißer Emaille, drei Tassen. Da hinten ist das Schlafzimmer, sagt er im Weitergehen und deutet in die dunkle Tiefe des Flurs, und hier das Bad, er klopft mit dem Fingerknöchel an die kleine Tür neben der Küche. Gegenüber sieht sie ein selbstgeschriebenes Schild an einer weiteren Tür: Betreten verboten. Das ist das Zimmer von Ludwig, sagt er und fasst die Klinke an, jedoch ohne zu öffnen. Dann wieder zurück, an der Petersburger Hängung vorüber, und weiter, auf die andere Seite der Wohnung. Es ist ja ein Eckhaus, sagt er.
In dem großen Zimmer, in das er sie nun führt, steht ein runder, hölzerner Esstisch, sechs Stühle, jeder der Stühle sieht anders aus. Über einem hängt eine Damenstrickjacke. In der Ecke eine Biedermeier-Vitrine, darin Meißner Tassen und Teller. Er geht zu den beiden Fenstern und macht sie weit auf. Wenn man die Fenster aufmacht, ist man hier oben schon fast im Himmel, sagt er. Durch den großen Durchgang links geht er nun in den Raum, der offenbar das Wohnzimmer ist, auf dem Boden ein blaugemusterter Teppich, weiße Wände, ein Ledersofa auf wackligen Füßen, links daneben ein Ofen, rechts eine Stehlampe. Design Lutz Rudolph, sagt sie, die haben wir auch. Er ist ein Freund von uns, sagt er, während er auch dort die Fenster weit aufmacht. Sie steht im Durchgang, lehnt sich an den Rahmen. Wie sie da beim Anlehnen aussieht, das wird er sich merken. Er kommt zurück, an ihr vorbei, nur nicht zu dicht, dann um den Esstisch herum, er stößt die vergilbte Flügeltür zu dem anderen Durchgang, nach rechts, auf. Dahinter sieht sie ein schmales Zimmer mit Bücherregalen bis an die Decke, besonders geschickt bin ich nicht, sagt er mit Blick auf die schief zusammengeschraubten Bretter. Sie kommt näher. Aber die Bücher wachsen immerfort nach, sagt er und zeigt auf die Stapel, die auf dem Fußboden liegen. Mit ihr schaut er in sein eigenes Zimmer hinein wie in etwas Fremdes. Ein Schreibtisch im Erker. Da schreiben Sie? Eigentlich selten. Ich hab noch ein Arbeitszimmer in der Glinkastraße, geh zum Arbeiten gern woandershin. Aha, sagt sie. In der Glinkastraße ist auch mein ganzer Kram für die Arbeit im Rundfunk, bin da offiziell angestellt. Als was denn? Neugierig ist sie, und erinnert ihn, wenn sie so fragt, an ein Eichhörnchen. Als Autor – »fester Freier«, so heißt das. »Fester Freier«? Eine Sendung im Jahr muss ich schreiben, die übrigen werden extra bezahlt. Was für Sendungen? Das Eichhörnchen wieder. Manchmal über Geschichte, wenn mir bei den Recherchen für meine Bücher etwas Interessantes begegnet, sagt er, aber sonst über Musik – Komponisten, Musiker. Ich hab mal Musikwissenschaft studiert, für Sie wahrscheinlich weniger interessant. Ich mag Bach, sagt sie und überlegt, ob sie vielleicht schon einmal eine Sendung von ihm im Radio gehört hat. Ich auch, sagt er. Rotwein?, fragt er. Und sie sagt: Gern.
Während er nun den Wein aus der Küche holt, geht sie ein paar Schritte in den Raum hinein und sieht sich um. Vor den Büchern stehen kleine Figuren und Blechspielzeug, Postkarten sind an die Buchrücken gelehnt, Fotos an die Bretter gepinnt: Ein kleines Kind, offenbar der Sohn, auf einem Pony sitzend, eine leere Landschaft mit Wolken, eine schöne Frau auf einer Hollywoodschaukel, wahrscheinlich seine Ehefrau, sie lacht den Fotografen an, der vielleicht er, Hans, also ihr Mann war, aber durch die Ewigkeit des Bildes hindurch lacht sie nun jeden an, der das Foto sieht, auch sie, die Besucherin ihres Mannes. Hinter ihr klirrt er jetzt mit den Gläsern, er hält beide in einer Hand, in der andern hat er die Flasche, wollen wir ein bisschen Musik hören?, fragt er und geht ins Wohnzimmer hinüber. Ja, sagt sie und folgt.
Während er die erste Platte heraussucht, die Brille aufsetzt, um auf der Rückseite zu lesen, das wievielte Stück er ihr vorspielen will, die schwarze Scheibe dann aus der Hülle zieht, auf den Plattenteller legt, mit der Bürste den Staub von den Rillen abstreift und den Tonkopf genau in die glatte Leerstelle zwischen zwei Stücken aufsetzt, währenddessen hat sie endlich Zeit, ihn in Ruhe anzuschauen. Seine schmalen Schultern. Sein Haarschopf. Der Oberkörper ist kurz im Verhältnis zu den langen Beinen, den langen Armen, dadurch geraten seine Bewegungen immer ins Schlenkern. Eigentlich sieht er, so von hinten, wie ein Halbwüchsiger aus, wie einer ihrer Altersgenossen, nur als er sich umdreht und zu ihr kommt, ist er wieder erwachsen. Seine gerade Nase, der schmale Mund, die grauen Augen. Sie sitzt auf dem Sofa mit den wackligen Beinen, er setzt sich auf den Sessel daneben. Die Lesebrille nimmt er jetzt wieder ab, steckt sie in seine Hemdtasche zurück und zündet sich eine Zigarette an. Er hat Wein eingeschenkt, aber zum Anstoßen kommen sie nicht, denn nun beginnt schon Swjatoslaw Richter mit Chopins Mazurka a-Moll. Indem er ihr seine Musik vorspielt, liefert er sich ihr aus. Ob sie das spürt? Sie spielt selbst Klavier, einige von Chopins Walzern hat sie gelernt, aber erst jetzt, im Zuhören mit ihm, versteht sie, wie sehr an der Kippe zum Untergründigen diese Musik ist. Scherzo in b, Polonaise in As, die ganze Zeit über sagen sie nichts, sehen sich auch nicht an, sind sich nur einig im Schweigen. Erst als die Platte im Leerlauf zu schleifen beginnt und der Hebel mit einem Klicken nach oben schwebt, nickt er ihr zu, hebt sein Glas und stößt mit ihr an. Sie trinken einen Schluck, dann steht er auf, um die Scheibe zu wechseln, draußen vor den offenen Fenstern hört sie in der eingetretenen Stille die Schwalben.
Und nun spielt er ihr noch das Impromptu in As-Dur von Franz Schubert vor, und von Bach die Chromatische Fantasie, die Partita in e-Moll und den 3. Satz von Mozarts B-Dur-Klavierkonzert. Mal nickt er mit dem Kopf im Rhythmus mit, mal sagt er: Das ist was, oder? Mal sagt sie: Das ist wunderschön. Mal fragt sie: Wer spielt? Dann sagt er: Artur Rubinstein, Glenn Gould, Clara Haskil. Zwischen Bach und Mozart ist sie pinkeln gegangen und hat im Bad die Cordhosen des Sohnes auf der Leine hängen sehen. Und vor dem Spiegel stand das Fläschchen mit dem Parfum, nach dem die Wohnung so gut riecht, Chanel No 5. Und drei Zahnbürsten in einem Becher. Und auf einem Hocker das Nachthemd der Frau, mitten im Alltag nachlässig hingeworfen. Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün, wünscht das Klavier sich ganz am Schluss, aber es ist doch schon Juli, draußen ist aus dem Sommerabend eine Sommernacht geworden, die Rotweinflasche ist leer. Sind Sie hungrig? Ja. Dann gehen wir jetzt was essen. Ja.
Es ist schön, neben ihm zu gehen, denkt sie.
Es ist schön, neben ihr zu gehen, denkt er.
Zwanzig Minuten Fußweg durch die Nacht. Er kennt das Lokal gut, war schon zigmal da, der Kellner gibt ihm, wie gewohnt, den Tisch, der für die Stammkunden reserviert ist.
Sie weiß, dass man die Serviette über die Knie legt, bevor man zu essen beginnt, sie weiß, dass man sich den Mund abtupft, bevor man trinkt, sie weiß, dass man den Suppenteller nach hinten ankippt und nicht zu sich, dass man die Ellenbogen nicht aufstützt und Kartoffeln nicht mit dem Messer schneidet. Gegen alle Angst, alle Hoffnung, all das, was man nicht vorhersehen kann und auch nicht vorhersehen will, dagegen hilft es, dass man weiß, Messer und Gabel sollen nebeneinander abgelegt werden, wenn man mit dem Essen fertig ist, mit dem Griff auf der rechten Seite des Tellers. Im Angesicht dieses Mannes, der ihr bei diesem Abendessen als ungeheures Glück, als Unglück und als Frage gegenübersitzt, versteht sie: Jetzt hat das Leben begonnen, für das alles andere nur die Vorbereitung gewesen ist.
Er denkt, sie sieht selbst beim Kauen noch schön aus.
Und nun?
Ohne dass einer von beiden ein Wort darüber verlieren müsste, lenken sie die Schritte wieder heimwärts. Heimwärts heißt nun auch für sie schon: zurück zu seinem Haus.
Von unten sehen sie hinauf zu den noch immer hell erleuchteten Fenstern.
Vielleicht ist er nur ausgegangen mit ihr, um wiederkommen zu können. Um die Illusion zu haben, dass auch für sie Alltag wäre, was ihm so vertraut ist. Ganz selbstverständlich schon geht sie ins Wohnzimmer voraus, während er eine zweite Flasche Wein aus der Küche holt. Als er ins Zimmer kommt, steht sie am Fenster. Das Fensterbrett ist so niedrig, dass es keine Kunst wäre, hinauszukippen, denkt sie. Da drüben, sagt sie, ist auch noch jemand wach. Das ist ein guter Freund von uns, sagt er, der malt. Sie hört wohl, dass er »von uns« gesagt hat. Er denkt, sie soll wissen, woran sie ist. Sie dreht sich zu ihm um. Er hält eine Schallplatte in der Hand, die Zigarette hängt ihm schief zwischen den Lippen. Nimm doch die Pfeife aus dem Maul, du Hund. Hier ist das Requiem. Das passt wohl jetzt nicht, sagt sie. Jetzt, hat sie gesagt. Die Toten, die in der Erde liegen, schlafen nicht, sondern warten. Gute Musik passt immer, sagt er und legt die Zigarette ab. Dann also, sagt sie. Er zieht die Scheibe aus der Hülle und fährt sachte mit der Bürste über die Rillen, bevor er sie auflegt.
Und nun werden alle Grüfte durchsichtig, und er und sie stehen direkt auf dem Gräberfeld, und die Insel der Lebenden ist nur gerade so groß wie das kleine Stück Boden unter ihren Füßen. Während sie ihm die Brille abnimmt und beiseitelegt und er zum ersten Mal seine Arme um sie legt, bittet die Menschheit für die Menschheit um Ruhe und ewiges Licht. Sie nimmt sein Gesicht in beide Hände und küsst ihn, aber nur ganz leicht. Da steigt eine einsame junge Stimme auf, sie lobt Gott, denn wenn sie ihn anerkennt, wird er sie vielleicht verschonen. Wie sich während ihres Gebets die nackte Schulter des Mädchens unter seiner Hand anfühlt, beides rundet sich ineinander, das wird er sein Lebtag nicht vergessen. Zu dir kommt alles Fleisch, ja, so ist das, denkt er noch, und dann hört er auf zu denken. Die Küsse, die Chöre, ihr Haar, der Moment kurz vor dem Ende des Introitus, die mit Nachdruck wiederholte Forderung der Lebenden für ihre Toten: Gib ihnen das immerwährende Licht!, die in der Leere der Kirche verhallt. Antwort müssen die Menschen sich selber geben, dunkel bleibt es da, wo sie wohnen, das Wünschen hat keine Gewalt. Er atmet, und sie hat ihren Kopf an ihn angelehnt und atmet auch.
Aber nun rühren die Gerufenen in den Grüften sich, raffen ihre Totenhemden zusammen, um ihre Knochen zu bedecken, die gleich auffahren werden zum Himmel, kyrie eleison, Herr, erbarme dich, flüstert sie ihm zu und lacht ihn an, bevor sie ihre Zähne in sein Fleisch gräbt, will sie ein Stück aus ihm herausbeißen, die Wahnsinnige? Die Toten schlottern in den Himmel hinauf, während die beiden Menschenkörper sich in eine Landschaft verwandeln, die nicht zu sehen, nur mit Händen zu greifen ist, unzählige Wege gibt es in dieser Landschaft, nur fortlaufen kann man nicht, du weißt schon, sagt er, dass jetzt gleich das Dies irae kommt, der Tag des Zorns, nein, sagt sie und schüttelt den Kopf, als wüsste sie es besser, der kommt nicht, und zieht ihn noch näher zu sich heran. Gott, der den Äther bewohnet, rollt den Himmel zusammen, rollt wie ein Buch ihn zusammen. Und auf die göttliche Erde wird ganz der vielförmige Himmel stürzen, und auf das Meer. Und strömen des Feuers unermüdlicher Guss, der verbrennt die Erde, die Meere und die Achse des Himmels, die Tage und selber die Schöpfung schmilzt er zusammen in eins. Unterstehen sämtliche Hörner, Fagotte, Klarinetten, Pauken, Posaunen, Violinen, Bratschen, Celli und auch die Orgel in Wahrheit ihrem Kommando? Nacht wird überall sein, eine lange, gar ungefügig, gleich für alle zumal, die Reichen und Armen. Nackt kömmt man von der Erde, und kehrt nackt wieder zu ihr zurück. Die Schuld der Welt wird durch Feuer getilgt, aber was, wenn es gar keine Schuld gibt? Schönhüftig, das Wort aus einer Erzählung von Thomas Mann fliegt ihm zu, als er seine Hände von ihrer Taille abwärtsgleiten lässt. Welch ein Graus wird sein und Zagen, wenn der Richter kommt, mit Fragen / streng zu prüfen alle Klagen. Unwillkürlich singt er den lateinischen Text mit, während seine Hände messen, dass in jede von ihnen eine ihrer Pobacken passt. Und nun vermeldet die Posaune den Anbruch des Gerichts, ganz nah sind sie schon, so nah, dass der Chor verstummt und stattdessen einzelne Stimmen zu hören sind: Der Bass sendet den Ruf aus, dem jeder, ob tot, ob lebendig, folgen muss, der Tenor besingt das Staunen aller Materie über die Wiederauferstehung, die Altistin schlägt das große Buch auf, in das alle Sünden eingetragen sind, der Sopran aber erhebt ganz zuletzt seine Stimme im Namen eines jeden Einzelnen, der angeklagt ist: Wie elend wird es mir gehen, wenn es an mir ist zu sprechen? Wer wird mein Anwalt sein? Wenn nicht einmal der Gerechte sicher sein kann, dass er vor dem Richter besteht? Noch immer stehen die beiden da, auf dem blauen Wohnzimmerteppich, auf ihrer Insel, barfuß, mit ineinandergewundenen Armen und Beinen, und machen nur manchmal, auftauchend aus ihrem blinden Glück, die Augen auf und sehen sich an. Woher nur nimmt das Mädchen diese Gewissheit? Und dann machen sie die Augen wieder zu, um mit ihren Händen und Mündern gründlicher zu sehen.
Der Auftritt des Herrn aller Gewalten bringt ihn für einen Moment wieder zur Besinnung, rex tremendae majestatis ruft der Chor ihn an, sein Blick fällt auf die Zigarette, die er in seinem alten Leben abgelegt hat, sie ist ein langer Stängel weißer Asche geworden. Daneben liegt ihre Armbanduhr, wann hat sie die abgenommen? Wir dürfen uns nicht unglücklich machen, sagt er, und greift nach ihrem Schoß. Sie lächelt: Soweit sind wir doch schon. Salva me, salva me. Du sollst mit mir schlafen, sagt sie. Da nimmt er sie bei der Hand und führt sie aus dem Zimmer hinaus, durchs Esszimmer, durch den Vorraum, bis in die dunkle Tiefe des Flurs, an einem Spiegel vorbei, bis in den Raum, den er ihr vorhin nicht gezeigt hat. Erinnere dich daran, milder Jesus, dass du dich um des Menschen willen hast martern und ans Kreuz schlagen lassen. Erinnere dich daran, wie erschöpft du am Ende deines Weges warst. Wenn du mich jetzt verwirfst, war alles umsonst. Erinnere dich.
Im Ehebett legt er sich auf die Seite, auf der sonst seine Frau schläft, und gibt dem Mädchen seine eigene Seite. Mit keiner seiner Geliebten war er jemals im Ehebett. Es kann sein, sagt er, dass er jetzt nicht steht, ich habe zuviel getrunken, und ich bin zu erregt. Das ist ganz egal, sagt sie, und fasst ihn an. Im Wohnzimmer, wo die himmlischen Heerscharen und die zu prüfende Menschheit nun mit sich allein sind, wird unterdes die Aufteilung gemacht: Auf der linken Seite wartet das lodernde Höllenfeuer auf die Sünder, auf der rechten Seite eine Zukunft, in der es nur noch einen einzigen, immerwährenden Tag gibt und nie wieder eine Nacht, auf die Seligen. Voca me cum benedictis, singen geisterhafte Stimmen auf der schwarzen Scheibe, die sich noch immer auf dem Plattenteller dreht. Wer sich jetzt ein letztes Mal umwendet und aus der nie wieder zu behebenden Ferne zurückschaut auf die Erde, sieht, wie weit der Weg vom Grab bis vor die Schranken des himmlischen Gerichts in Wirklichkeit war. Beinahe zwei ganze Oktaven, nur in Halbtonschritten ist es aufwärts gegangen, durch die zähe Masse aus Hoffnung und Angst.
Als an die Stelle des Seufzens und Wehklagens Stille tritt, liegen die beiden Körper ausgestreckt im Dunkel nebeneinander. Nie wieder wird es so sein wie heute, denkt Hans. So wird es nun sein für immer, denkt Katharina. Dann löscht der Schlaf alle Gedanken aus, und was ihnen geschehen ist, wird ihnen, während sie ruhig atmend beieinander liegen, auf die Gehirnrinde geschrieben.
I/2
Im Ganymed am Schiffbauerdamm hat seine Frau ihm erzählt, dass sie schwanger ist. Im Ganymed hat er mit seinem Lektor das erste druckfertige Manuskript gefeiert. Nun steht er vor dem Lokal und wartet auf ein neunzehnjähriges Mädchen.
Das neunzehnjährige Mädchen wusste gestern und heute den ganzen Arbeitstag über noch seine Augen, seine Nase, seine Schultern. Aber wie er im Ganzen aussieht, weiß sie womöglich nicht mehr. Ungeduldig geht sie ihrer Erinnerung entgegen.
Hans weiß noch ihr Lächeln und ihre Brüste, aber wie sie im Ganzen aussieht, weiß er womöglich nicht mehr. Aber da ist sie schon, biegt vorn in den Schiffbauerdamm ein, er erkennt sie gleich. Mit der Handtasche schlenkert sie beim Gehen, schwarz gekleidet ist sie von Kopf bis Fuß, als sie näher kommt, sieht er: Sie hat das Haar zurückgebunden und mit einer schwarzsamtenen Schleife verziert. Schutzlos, denkt er, ist ihr Gesicht. Ehrlich wollte er sein heute, jetzt weiß er: er muss es. Das ist seine ganze Verteidigungsmöglichkeit. Mit einem Nicken passieren sie die zwei Kellner mit den langen weißen Schürzen am Eingang, die spielen Frankreich für die französischen Soldaten aus Westberlin, die im teuren Ostberliner Ganymed gern billig essen gehen.
Mit Bedacht hat er einen größeren Tisch gewählt, wir werden zu dritt sein, hat er dem Ober gesagt. Und nun, sie ist schon eingeweiht, halten sie hin und wieder nach dem ausbleibenden Dritten Ausschau. Zur Vorspeise, hat er ihr erklärt, muss man hier unbedingt Berner Butterbouillon nehmen, denn darin ist ein Wachtelei. Sie löffeln also ihre Berner Butterbouillon, heben jeder das Wachtelei auf den Löffel und bestaunen das Wunderwerk. Eine Wachtelei, sagt er, mit Betonung auf der letzten Silbe, und sieht sie erwartungsvoll an, ob sie den Scherz wohl versteht. Sie erwidert den Blick. So gibt es das erste Wort in ihrem gemeinsamen Vokabular. Und ein Buch von sich hat er ihr mitgebracht, damit sie weiß, was er schreibt. Sein erstes Geschenk für sie. Die Widmung soll sie später lesen. Dann wieder zur Tür hinüberblicken und die Köpfe schütteln – wo der unpünktliche Kerl nur bleibt? Sie sind im Einverständnis miteinander, sie haben ihre ersten Geheimnisse vor der Welt, sie wissen, woran nur sie sich erinnern, wenn sie sich ansehen. Gerade deshalb muss er die Bedingungen klarstellen, bevor es dazu zu spät ist.
Wir werden uns, sagt er, nur ab und zu sehen, aber es soll jedes Mal wie das erste Mal sein – ein Fest. Sie hört aufmerksam zu und nickt. Ich kann nur dein Luxus sein, sagt er, denn ich bin ein verheirateter Mann. Ich weiß, sagt sie. Es kann sein, dass dir das nicht reicht, sagt er, und das ist dein gutes Recht. Geradenwegs schaut sie ihm ins Gesicht, um ihre Pupillen ist ein gelber Ring, sieht er jetzt. Ich habe nicht nur eine Ehe, sondern auch ein Verhältnis mit einer Frau beim Rundfunk. Und wenn du tausend Frauen hättest, sagt sie, wichtig ist doch die Zeit, die wir miteinander haben. Wie soll er ihr je etwas abschlagen, wenn sie nichts verlangt? Die schwarze Samtschleife, mit der sie aussieht wie eine Internatsschülerin, rührt ihn unendlich. Wenn er, was er zu sagen hat, nicht schnell sagt, wird es zu spät sein. Und wir dürfen uns nicht miteinander veröffentlichen – ich weiß und du weißt, das muss uns genug sein. Das ist in Ordnung, sagt sie und lächelt. Wo Bedingungen ausgehandelt werden, da geht es um etwas, das bleibt. Sie hatte Angst gestern und heute den ganzen Tag, dass er sie aus seinem Leben gleich wieder hinausstößt.
Ihre Mutter hatte an dem Morgen nur drei Fragen stellen müssen, hatte ihrer Tochter das Glück angesehen und, ohne dass die seinen Namen verriet, trotzdem nach nur drei Fragen gewusst, wer derjenige war. Ja, der sieht gut aus, hatte die Mutter gesagt, und er ist klug. Aber er hatte auch immer Freundinnen. Pass auf dich auf.
Unser Stern, sagt er, darf nicht in die Erdatmosphäre geraten, dann verglüht er sofort. Der Stern ist also noch am Himmel, festgepinnt am Firmament mit einer Reißzwecke, wie die Fotos an seinem Bücherregal, denkt sie erleichtert. Sie nickt. Sie sagt Ja. Er weiß, er macht es ihr schwer, damit sie Ja sagen muss. Unsterbliche Opfer, heißt das Lied, das ihm dazu einfällt. Wer das Opfer bringen darf, ist auserwählt.
Er schenkt ihr nach, Weißwein zur Forelle, und sieht nebenbei, dass sie weiß, wie man einen Fisch zerlegt. Sie sieht sein Brillenetui auf dem Tisch liegen und die Zigarettenschachtel, Marke Duett, und denkt, dass sie nie wieder an einem Tisch sitzen will, auf dem nicht sein Brillenetui, seine Zigaretten liegen.
Wie schön selbst die Gräten bei so einem Fisch sind, sagt er mit Blick auf den Grätenteller, der an ein Beinhaus erinnert, aber auch an den großen Saal im Naturkundemuseum, wo das riesige Dinosaurierskelett ausgestellt ist.
Als Kind habe ich von meinem Großvater Angeln gelernt, sagt sie.
Einen Moment lang sieht er sie mit baumelnden Beinen auf einem Steg sitzen und eine Angel ins Wasser halten. Was für eine Macht so ein Satz hat, denkt er. Schickt einem ein Bild in den Kopf, ob man will oder nicht.
Jetzt könnte das Gespräch leichter werden, aber ein letzter Gedanke muss noch ausgesprochen sein.
Eines Tages, sagt er, eines Tages wirst du einen jungen Mann heiraten – dann schenke ich dir einen Strauß Rosen zur Hochzeit. Er sieht sie lächeln und den Kopf schütteln, so wie er es erwartet hat. Aber den Satz hat er mehr zu sich gesagt als zu ihr. Er darf nicht vergessen, dass er sie wird hergeben müssen eines Tages. Er darf nicht vergessen, dass er es besser weiß als sie, die über diesen Satz heute nur lächelt. Wenn er den Absturz überleben will, muss der Gedanke vom Absturz die ganze Zeit über, die er mit ihr verbringen wird, sei sie kurz, sei sie lang, in seine Seele passen. Muss dieser sperrige Gedanke mitten durch die Gedanken von Glück, Liebe, Begehren, mitten durch ihre gemeinsamen Erlebnisse und Erinnerungen, die sie vielleicht haben werden, hindurchragen, und er muss das aushalten, wenn ihn der Absturz, wenn er denn eines Tages eintrifft, nicht um die Existenz bringen soll. Wirklich, um die Existenz? Der Kellner räumt die Teller ab. Der Klavierspieler beginnt zu spielen, Schichtbeginn 18 Uhr, ein Mozart-Potpourri. Seine Frau hat, als er neulich mit ihr hier war, gesagt, der Klavierspieler sähe aus wie Heiner Müller. Und sie hat recht, der Klavierspieler sieht wirklich aus wie sein Schriftstellerkollege Heiner Müller. Wahrscheinlich wegen der Brille. Im Mai noch hat Hans seiner Frau einen Liebesbrief geschrieben.
Es geht so lange, wie du willst, sagt er.
Sie nickt. Wenn sie ihn nur sehen kann. So oft und so lange wie möglich. Alles andere ist ihr egal.
Von jetzt an, denkt er, liegt die Verantwortung, dass es weitergeht, allein bei ihr. Er muss sich vor sich selbst schützen. Vielleicht ist sie ein Aas?
Sie denkt, er will mich vorbereiten darauf, dass es schwer wird. Er will mich schützen. Er will mich vor mir selbst beschützen, er gibt mir die Entscheidungsgewalt über uns.
Er denkt, solange sie will, kann es kein Fehler sein.
Sie denkt, wenn er mir alles überlässt, wird er schon sehen, was Liebe ist.
Er denkt, sie wird erst später verstehen, wozu sie jetzt Ja gesagt hat.
Sie denkt, er vertraut sich mir an.
Alle diese Gedanken werden an diesem Abend gedacht, und alle zusammen ergeben die vielgesichtige Wahrheit.
Zum Kellner sagen sie: Unser Freund hat uns leider versetzt. Er zahlt, steckt Brillenetui und die Zigaretten, Marke Duett, wieder ein, ihre Jacke hängt direkt neben seinem Sommermantel an der Garderobe, beide Stoffe berühren sich, falten sich ineinander. Heilige Zweifaltigkeit, sagt er und zeigt auf das Arrangement, bevor die Garderobiere ihnen beide Stücke über den Tresen reicht und er dem Mädchen die Jacke zum Anziehen hinhält. Dies ist der zweite Begriff ihres gemeinsamen Vokabulars.
Und nun gehen sie über die Weidendammer Brücke, am eisernen Adler vorüber, dem der vorvorige Staat schon lange abhanden gekommen ist. Hans beginnt unwillkürlich, zwischen den Zähnen hindurch die Melodie vom »Preußischen Ikarus« zu pfeifen, noch bevor ihm einfällt, welches Lied das überhaupt ist. Biermann hat es gesungen bei seinem Konzert im Westen, danach hat die DDR-Regierung ihn ausgebürgert, zehn Jahre ist das jetzt her. Ausbürgerung, eine Nazimethode, das hat zurückgeschlagen auf die, die sie angeordnet haben. Viele Freunde haben das Land seither verlassen. Selbst er, Hans, hätte die »Resolution der Dreizehn« gegen die Ausbürgerung damals beinahe unterschrieben. Und sie, die neben ihm geht, mit ihrem Gesicht aus Biskuitporzellan? Weiß von alledem natürlich nichts, war damals ja noch ein Kind.
Katharina fällt das Foto ein, das sie vor drei Jahren genau hier auf der Brücke von ihrem ersten Freund, Gernot, gemacht hat. Einen Hut hatte der immer getragen, sogar in der Schule auf dem Pausenhof, und natürlich auch auf dem Foto. Sie hängt sich im Gehen bei Hans ein und merkt, wie der die Hand zwar aus der Manteltasche nimmt, aber den Arm seltsam steif hält. Lass die Hand ruhig in der Tasche, sagt sie. Er nimmt das Angebot an, steckt die Hand wieder in die Manteltasche und tut so, als wäre das Einhaken allein ihre Angelegenheit. Sie nimmt die Schuld gern auf sich. Ist sie nicht erst vor drei Tagen ebendiesen Weg gegangen, vollkommen ahnungslos, nur um ihm im Bus zu begegnen? Bei dem Gedanken, dass alles ganz anders gekommen wäre, wenn sie das Haus auch nur zehn Minuten später verlassen oder im Buchladen das Kleingeld nicht passend gehabt hätte, wird ihr jetzt noch ganz schwindlig.
Er fliegt nicht weg – und stürzt nicht ab. Ihr die Berührung in der Öffentlichkeit ganz zu verweigern, dazu reicht seine Vernünftigkeit auch wieder nicht aus. Wird, wenn das so weitergeht, dahinschmelzen, seine ganze Vernünftigkeit. Dass die Sehnsucht danach, die Kontrolle zu behalten, genauso groß sein muss wie der Wunsch, sie zu verlieren. Eine teuflische Einrichtung. Und der jeweilige Mensch ist nur das Feld, auf dem dieser Kampf mit wechselndem Glück ausgefochten wird. Zu siegen gibt’s da nichts. Macht keinen Wind – , denkt er, und macht nicht schlapp. Die Melodie ist gut, hat ihre Tücken, so wie das sein muss, Biermann ja auch ein hochintelligenter Kerl. In Erinnerung ist Hans vor allem geblieben, wie der bei seinem Konzert damit umging, wenn ihm eine Textzeile nicht einfiel oder ein Akkordgriff nicht der richtige war. Vor einem Millionenpublikum hatte der mit seiner Klampfe gesessen und alle angeredet wie die Freunde im eigenen Wohnzimmer. Hatte noch nicht gelernt, sich zu verkaufen, und verkaufte sich gerade deswegen so gut. Das war Dialektik. Vor drei Jahren hatte ihr erster Freund, Gernot, mehrere Versuche unternommen, sie zu entjungfern. Es hatte ihr jedesmal so wehgetan, dass sie Angst gehabt hatte, für immer Jungfrau zu bleiben. Im Bett trug er keinen Hut. Der Trugschluss auf dem Wort »Spree«, die musikalische Unmöglichkeit, Boden unter die Füße zu kriegen, das ist gekonnt gemacht. In der Fremde hatte Biermann über den Umweg der Television für die eigenen Leute gesungen und sich dabei aus dem eigenen Land hinausgesungen. Auch Dialektik. Kein Wunder, dass ihm während des Konzerts manchmal ebenjene Worte, mit denen er den Rückweg hinter sich abschnitt, einen Moment lang fehlten. Mit traumwandlerischer Unsicherheit war Biermann aus seinem Land hinausgestürzt. Nach einem dieser Versuche war sie mit der Straßenbahn Nr. 46 zu sich nach Hause gefahren. Abends hatte sie dann die Blutstropfen in ihrem Schlüpfer gesehen und gewusst, dass es endlich geschafft war.
Auf Höhe des Hotel Lindencorso stehen einige ratlose Touristen und wenden sich auf Englisch an Hans: Wo sie denn hier, for God’s sake, seien? In Berlin, sagt Hans, yes, yes, Berlin, but East or West? Katharina lacht. Wie kann man mit Blick aufs Brandenburger Tor nicht wissen, ob man in Ost- oder Westberlin ist? East, sagt Hans. Die Amerikaner wirken nervös und beginnen, miteinander zu diskutieren. Sind sie wirklich in den Osten geraten, ohne die Grenzüberschreitung bemerkt zu haben? Und wie kommen sie jetzt wieder hinaus, for God’s sake? Vielleicht nie mehr? Werden sie womöglich in der nächsten Sekunde von der Stasi geschnappt und in einen kommunistischen Kochtopf geworfen? Sie klettern eilig wieder in ihre zwei am Straßenrand geparkten Schlitten und fahren davon. Hans und Katharina kichern sich eins und überqueren die Linden, seinen Arbeitsraum in der Glinkastraße will er ihr zeigen, von wo aus er am Freitag aufgebrochen ist, um in den 57er-Bus zu steigen.
Verstaubt ist es da. Tonbänder stehen im Regal. Schallplatten. Kassetten. Papierstapel auf dem Tisch. Die Fenster ungeputzt. Der Ausblick lohnt nicht, sagt Hans, er zeigt nach draußen auf den Hinterhof, wo gerade der Betonfußboden aufgerissen und alles abgesperrt ist. Dann bietet er Katharina den Schreibtischstuhl an, setzt ihr zwei große Kopfhörer auf und drückt auf einen Knopf. Er rührte an den Schlaf der Welt, mit Worten, die Blitze waren. So etwas hat sie noch nie gehört, ganz aufrecht sitzt sie. Er steht beim Fenster, schaut ihr beim Hören zu, raucht. Es gefällt ihm, wie sie aussieht, wenn sie sich konzentriert. Ernst Busch, sagt Hans, als er ihr die Kopfhörer wieder abnimmt. Der Sänger des Proletariats. Spanienkämpfer. Und die Original-Tonbänder mit seinen Aufnahmen haben diese Idioten gelöscht, diese Radiofritzen. Und was von seinen Schallplatten noch auf Lager war, haben sie eingestampft. Wann war das? 1952. Vor sechs Jahren ist er gestorben, seitdem darf sein Name wieder erwähnt werden. Katharinas Großvater war auch Spanienkämpfer, sie erinnert sich noch an die schwarze Baskenmütze, die er im Winter immer trug. Sonst weiß sie fast nichts mehr von ihm, sieben Jahre alt war sie, als er starb. Hans zieht ein paar kleine Schallplatten aus einem Regal und gibt sie Katharina. Das sind meine privaten, die hab ich für die Sendung genommen. Busch hatte eine eigene Plattenfirma, hat diese 45er-Platten selbst produziert, zu jeder gab es ein Textheft und Bilder. Katharina liest, klappt hier auf und da, blättert um. Die letzten Jahre war er in der Psychiatrie, sagt Hans, im Keller seines Hauses seien Leichen vergraben, soll er immer gesagt haben. Er singt mit Pathos, aber er lügt nicht, sagt Katharina. Genau, sagt Hans.
Bevor sie wieder hinausgehen, entdeckt Katharina auf dem Schreibtisch eine Fotografie von Hans. Darf ich die haben?, fragt sie, und Hans fragt zurück: Eine Mauer gegen die Phantasie? Sie sagt: Damit ich, wenn ich morgen im Zug nach Budapest sitze, noch weiß, dass ich das alles nicht nur geträumt habe. Morgen fährst du schon? Ja. Während sie das Foto in der Hand hält, umarmt er sie von hinten und küsst sie auf den Nacken. Erst als er sie loslässt, macht sie die Augen wieder auf und steckt das Foto sorgsam in ihre Handtasche, zwischen die Seiten des Buchs, das sie gerade liest. Ach, um Gottes willen, dein Buch. Im Ganymed liegt es hoffentlich noch. Alles retour, wie ein Film, der rückwärts abgespult wird: Unter den Linden, Lindencorso, Weidendammer Brücke, Schiffbauerdamm. Da stehen noch immer die zwei Kellner mit den langen weißen Schürzen am Eingang, tut noch immer die Garderobiere am Tresen ihren Dienst, spielt der Klavierspieler, der wie Heiner Müller aussieht, noch immer. Aber voll ist es jetzt, Franzosen, Engländer auch oder Amis, alle lachen und essen, und wenn der Mund offen ist, kann es aus dem einen oder dem anderen Grund sein, auch der Tisch, an dem sie gesessen haben, ist schon wieder besetzt. Der Ober hat die Papiertüte mit dem Buch beiseitegelegt, auf der Tüte ist in blassen Buchstaben aufgedruckt: Gut gekauft, gern gekauft!
Bringst du mich noch nach Haus? Nun legt er also den Weg, den er sie, mit der Handtasche schlenkernd, hat kommen sehen, mit ihr gemeinsam zurück, an der Spree entlang, um die Ecke, und um noch eine Ecke herum, ein Mietshaus, gegenüber ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, in Blickweite das Deutsche Theater. Da oben im dritten Stock ist mein Zimmer, sagt sie, das dritte und das vierte Fenster von links. Er steht neben ihr und blickt hinauf. Ausgerechnet in der Reinhardtstraße wohnt sie, Ecke Albrecht, am Kreuzungspunkt der nächtlichen Wege, die er in seiner Jugend so oft gegangen ist. Und bei jedem Theaterbesuch ist er hier vorübergegangen, ohne zu wissen, dass sie in diesem Haus wohnt. Was steckt da am Fenster? Eine Postkarte von Egon Schiele. Schön, sagt er und versucht sich vorzustellen, wie ihr Zimmer aussieht. Sie sagt: Es ist nur eine Woche. Und er sagt: Denk an mich. Und denkt zugleich, warum sollte sie. Er weiß doch selbst nicht, ob es nicht besser wäre, er vergäße sie wieder, so schnell wie möglich. Auf offener Straße gibt es keinen Kuss, nur einen Blick.
I/3
Et lux perpetua luceat eis!
Ein Zitat aus dem »Requiem«, das ist die Widmung, die er ihr ins Buch geschrieben hat. Und statt seines Namens daruntergesetzt nur ein H mit einem Punkt. »Umkehr« heißt das Buch. Sie kann das Glück, das ihr zugestoßen ist, noch nicht glauben. Sie küsst das H mit dem Punkt. Und vergiss das Geschenk für Agnes nicht, ruft ihre Mutter aus dem Flur. Nein, ruft sie zurück, und ihr fällt ein, wie er seine Nase kraus zieht, wenn ihm ein Musikstück besonders gefällt. Und die Sonnenbrille. Ja, ruft sie und schließt kurz die Augen: wie er sie gerade eben noch, in seinem Arbeitszimmer, in die Arme genommen hat, bevor sie hinausgingen. Und auf den Nacken geküsst. Mädchen, mach hinne, sagt ihre Mutter, als sie jetzt ins Zimmer hineinschaut und sieht, dass ihre Tochter mit einem Buch in der Hand am Fenster steht und ins Dunkle blickt, statt fertig zu packen. War’s denn wenigstens schön? Ja, sehr, sagt Katharina. Die Mutter nickt. Und wann geht euer Zug? 6.28 Uhr. Ab Ostbahnhof? Ja. Na, dann mach mal. Gut, dass sie das meiste schon gestern gepackt hat. Den Urlaub mit ihrer Kindheitsfreundin Christina hat Katharina lange geplant. Lange, bevor sie am Freitag in den 57er-Bus gestiegen ist. Sie hat den Sommer geplant, aber der Sommer ist jetzt ein ganz anderer Sommer. Wisst ihr schon, wo ihr die erste Nacht bleibt, bevor ihr zu Agnes könnt? Nein, aber uns wird schon was einfallen.
Mit ihrer Freundin Christina hat Katharina sieben Schuljahre lang in der hintersten Bankreihe am Fenster gesessen und gekippelt. Hört auf zu kippeln. Hört auf zu quatschen. Wenn an einem dunklen Wintermorgen das Licht im blauweißgewürfelten Neubau gegenüber, Zeile zwölf von unten, ganz links, nicht pünktlich anging, rief sie drüben an, um die Freundin zu wecken. In den Schulpausen hat sie Christina die Fernsehfilme vom Vorabend erzählt, weil es bei deren Familie zu Hause keinen Fernseher gab. Mal hat sie bei Christina übernachtet, mal Christina bei ihr, und immer bis nach Mitternacht im Bett geredet. Und heimlich unter der Bettdecke Radio gehört. Und wenn die eine oder die andere Mutter kontrollieren kam, sich schlafend gestellt. Mal hat Christina einen Lachkrampf gehabt, mal sie. Sie haben zusammen Kuchen gebacken, sich verkleidet, Höhlen gebaut, Altstoffe gesammelt, nachts von Fenster zu Fenster mit der Taschenlampe Morsezeichen gegeben, vierhändig Klavier gespielt, Rote Grütze gegessen. War das schon Liebe, wenn Christina ihr einen Gute-Nacht-Kuss geben wollte? Gute Nacht ohne Kuss war besser. Gute Nacht. Aber sich immer alles, alles erzählt. Meinst du, er mag mich? So wie er dich ansieht. Er hat mir gestern auch einen Zettel zugesteckt. Wirklich? Erzählt und erzählt. Ist vielleicht endlich einmal Ruhe? Oder wollt ihr in verschiedenen Zimmern schlafen? Oder wollt ihr auseinandergesetzt werden? Aber dann wechselte Christina mit vierzehn auf eine andere Schule, ein Jahr später auch Katharina, kurz darauf zog sie mit ihrer Mutter und deren zweitem Mann Ralph in eine größere Wohnung. Seit dem letzten Herbst nun studiert Christina in Dresden Medizin. In den vergangenen Jahren haben sie sich immer seltener gesehen, aber schade ist es doch, irgendwie, und die Freundschaft vielleicht noch zu retten? Christina hatte immer blonde Haare und ein Gesicht voller Sommersprossen, und die hat sie auch jetzt noch, im Waggon 43, Abteil 8, Platz 5.
Für Katharina ist ihre eigene Kindheit an diesem Morgen eine Ewigkeit her.
Zehn Jahre zurück hatte Hans eine Beziehung von ähnlicher Intensität. Das Ende war eine Julisommernacht in Budapest. Ist es womöglich ein schlechtes Omen, dass sie gerade dorthin abgereist ist?
Nach Prag sind sie kurz allein im Abteil, da schiebt Katharina das Fenster nach oben, damit der Fahrtwind nicht stört, und erzählt Christina endlich, dass sie jemanden kennengelernt hat. Christina sagt: Ach, du bist schon wieder verliebt? Das ist etwas anderes diesmal, sagt Katharina. Und denkt, während Christina hell auflacht, an den Eintrag vom Sonnabend in ihrem Tagebuch, über dem sein Name wie eine Überschrift steht, eingerahmt. Er ist Schriftsteller, sagt sie, und das hier ist sein Buch, sagt sie und zieht das Buch aus der blass bedruckten Packpapiertüte. Gut gekauft, gern gekauft! Christina greift nach dem Buch, und schon fällt das Foto, das ihre verliebte Freundin zwischen die Seiten gelegt hat, heraus. Sie bückt sich danach, schaut drauf und sagt: Ist der nicht ein bisschen alt? Naja, gibt sie selbst sich die Antwort, du hattest ja immer schon einen speziellen Geschmack. Sommersprossen hat Christina, genauso wie früher, und wird sie vielleicht ihr Leben lang haben. Ohne wirkliches Interesse blättert sie in dem Buch, in seinem Buch, in dem Buch von Hans, noch bevor Katharina selbst es in Ruhe aufgeschlagen hat. Das Foto hält sie währenddessen in der linken Hand und zerknickt es womöglich. Endlich ist sie mit dem Blättern fertig, legt das Foto wieder zwischen die Seiten, reicht der Freundin beides hinüber und sagt: Wo übernachten wir denn nun heute? Katharina steckt das Buch zurück in die Packpapiertüte und verstaut es sorgfältig in ihrem Rucksack. Erst dann sagt sie, sie habe von jemandem einen Tipp bekommen: In irgendein Hochhaus gehen, mit dem Lift ganz nach oben fahren, von dort zum Treppenhaus und auf die Dachterrasse.
Wieder so eine von deinen Ideen, sagt Christina.
In den Sommerferien vor zwei Jahren hatten Katharinas erster Freund Gernot und Katharina im Bahnhof von Bratislava ihre Luftmatratzen in einer Ecke auf dem Fußboden ausgerollt, um dort zu schlafen. Als eine Kontrolle kam, übersiedelten sie nach draußen, auf die Bänke, die vor dem Bahnhof aufgestellt waren. Gernot legte sich zum Schlafen seinen Hut aufs Gesicht und sah damit aus wie ein Toter. In der Frühe waren junge Herren mit Aktentasche unter dem Arm an ihnen vorüber zur Arbeit gegangen. Katharina hatte das komisch gefunden.
Und wo soll so ein Hochhaus sein?
Wir sehen uns einfach um.