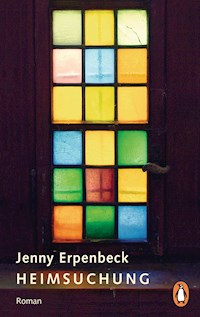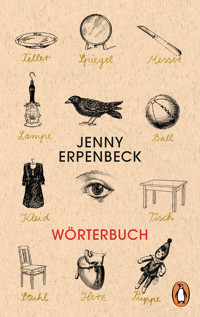17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die brillanteste europäische Autorin meiner Generation« Neel Mukherjee
Jenny Erpenbeck versammelt in diesem Band neben bisher nicht publizierten autobiografischen Texten verschiedenste Beiträge und Reden zu Literatur, Kunst, Musik und Politik. Was ihr am Werk anderer Anregung ist, wo sie anknüpft, wozu sie sich bekennt, erfahren wir in Texten zu Wagners »Götterdämmerung«, zum Werk Thomas Manns, Heimito von Doderers oder der Brüder Grimm. In diesem parallel zu den Romanen entstandenen essayistischen Werk reflektiert sie auch ihr eigenes Schreiben und Leben und gibt so Einblick in ihre Gedankenwelt und die Hintergründe ihres künstlerischen Schaffens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jenny Erpenbeck versammelt in diesem Band neben bisher nicht publizierten autobiografischen Texten Beiträge und Reden zu Literatur, Kunst, Musik und Gesellschaft. Was ihr am Werk anderer Anregung ist, wo sie anknüpft, wozu sie sich bekennt, erfahren wir in Texten zu Wagners »Götterdämmerung«, zum Werk Thomas Manns, Heimito von Doderers oder der Brüder Grimm. In diesem parallel zu den Romanen entstandenen essayistischen Werk reflektiert sie auch ihr eigenes Schreiben und Leben und gibt so Einblick in ihre Gedankenwelt und die Hintergründe ihres künstlerischen Schaffens.
Jenny Erpenbeck, geboren 1967 in Berlin, debütierte 1999 mit der Novelle »Geschichte vom alten Kind«. Es folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter Romane, Erzählungen und Theaterstücke. Ihr Roman »Aller Tage Abend« wurde von Lesern und Kritik gleichermaßen gefeiert und vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Joseph-Breitbach-Preis und dem Independent Foreign Fiction Prize. Für »Gehen, ging, gegangen« erhielt sie u.a. den Thomas-Mann-Preis. 2017 gewann Jenny Erpenbeck den Premio Strega Europeo und wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Die Presse zu »Gehen, ging, gegangen«
»Jenny Erpenbeck hat das Buch der Stunde geschrieben. (…) Es ist ein trauriger Glücksfall für die deutsche Literatur, den Erpenbeck uns hier beschert.« (Elke Schmitter, Der Spiegel)
»(…) dieser Roman ist realistisch: nicht weil er Verhältnisse real darstellt, sondern weil er eine literarische Wirklichkeit aufbaut, die die Weltrealität reflektiert.« (Stefana Sabin, NZZ am Sonntag)
»›Gehen, ging, gegangen‹ ist ein Werk von bezwingender Aktualität – und zugleich eines, das diese Brisanz literarisch weder gesucht noch einkalkuliert hat, weil ihm jeglicher Zynismus fremd ist.« (Felicitas von Lovenberg, FAZ)
»Ein zutiefst menschlicher Roman, genau zur richtigen Zeit.« (DeutschlandRadio Kultur)
Die Presse zu »Aller Tage Abend«
»Es steckt viel Poesie darin, aber kein Pathos; großes dramaturgisches Geschick und die dichterische Gewissheit, dass man nur ein Detail verändern muss, damit alles ganz anders wird.« (KulturSPIEGEL)
»Dieses Buch erzählt von fünf Leben, die ein einziges ergeben. Es wird bleiben.« (Andreas Platthaus, FAZ)
»Eine große Erzählerin!« (Brigitte Woman)
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
Für meinen Vater
JENNY
ERPENBECK
KEIN ROMAN
TEXTE UND REDEN 1992 BIS 2018
INHALT
Vorwort
I LEBEN
Wo die Welt zu Ende ist(2006)
Unter Menschen (2008)Dankesrede für den Solothurner Literaturpreis
Offene Buchführung(2009)
Der Schnellkochtopf (2010)
John(2012)
Heimweh nach dem Traurigsein (2013)
Ich werde Ich (2014), Rede zur Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Hoffnung (2014)
Zeit (2015), Rede zur Aufnahme in die Berliner Akademie der Künste
Vision eines Kreises (2016)Rede zur Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
II WEGE
Im Wald um Graz (2002)
Ich mit mir allein (2002) Eine Pfingstreise
Stadt Land Fluss: der Buchstabe P (2005)
Reise nach Usbekistan (2010)
III SCHREIBEN UND LITERATUR
Literarische Vorbilder (1999)
Sog und Suggestion (2001)
Im Jenseits der Altstoffe (2001)
Mein Lieblingsmärchen: »Der gescheite Hans«(2006)
Wie ich schreibe (2006)
Heimito von Doderer (2008), Dankesrede zum Heimito-von-Doderer-Literaturpreis
Hertha Koenig (2008), Dankesrede zum Hertha-Koenig-Literaturpreis
Zu den apokryphen Evangelien (2010), Überlegungen zu einem Drehbuch
Christian Daniel Schubart (2013), Dankesrede zum Schubart-Literaturpreis
Zur »Geschichte vom alten Kind« (2013), Bamberger Vorlesung I
Zum »Wörterbuch« (2013), Bamberger Vorlesung II
Sprechen und Schweigen (2013), Bamberger Vorlesung III
Variationen über einen Satz (2013), Bamberger Vorlesung IV
Was macht die Zeit mit dem Schreiben? (2013) Dankesrede zum Joseph-Breitbach-Preis
Thomas Valentin (2013), Dankesrede zum Thomas-Valentin-Literaturpreis
Hans Fallada (2014), Dankesrede zum Hans-Fallada-Preis der Stadt Neumünster
Thomas Mann (2016), Dankesrede zum Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste
Walter Hasenclever (2016), Dankesrede zum Walter-Hasenclever-Literaturpreis
Ovids »Metamorphosen« (2017), Rede anlässlich der Verleihung des Premio Strega Europeo
Walter Kempowskis Roman »Alles umsonst« (2017), Eine Einführung
IV MUSIK
Siegfrieds Gedächtnisverlust in der »Götterdämmerung« von Richard Wagner (1992)
In einer andern Welt (2005)
Leonore (2007), Konzept für eine Textfassung zu Beethovens »Fidelio«
V BILDER
Guter Hoffnung (2008), »Gabrielle d’Estrées und eine ihrer Schwestern« des Meisters von Fontainebleau, um 1594
Wie ist das Spiel zwischen Schalke 04 und Inter Mailand ausgegangen? (2011), Zum Fotoprojekt »Erinnerung an morgen« von Katharina Behling
Was man nicht sieht (2013), Über das Projekt »Priming« von Orit Raff
»Besuch des Jesusknaben bei Johannes in der Wüste« (2016), Eine Bildbeschreibung
VI GESELLSCHAFT
Sich ganz weit verirren – sich vom Verirren verirren (2014)Rede an die saarländischen Abiturienten des Jahrgangs 2014
Ein zweites Leben – wäre das zuviel verlangt, Herr Henkel? (2014), Ein offener Brief
Passage (2015), Dankesrede zum Europäischen Literaturpreis der Niederlande
Die Fliehenden (2015)
Einstein war Flüchtling (2016)
Wie geht’s? Gut? (2016), Nachruf auf Bashir Zakaryau
Im toten Winkel (2018), Keynote anlässlich der Puterbaugh Fellowship der Universität Oklahoma
Anhang
VORWORT
Viele verschiedene Zeiten sind in diesem Band versammelt.
Ich erinnere mich an einen Sommer in einem Haus auf dem Land, das schon seit langem nicht mehr unser Haus ist, ich saß dort und schrieb auf der elektrischen Schreibmaschine an einer Studienarbeit über ein eher abgelegenes Thema, das bei mir aber intensives Nachdenken und besessenes Schreiben in Gang setzte. Und dabei hatte ich mir dieses Thema nicht einmal selbst gesucht, mein Professor hatte es mir vorgeschlagen. Damals machte ich zum ersten Mal die Erfahrung, dass auch ein Anderer einem die Tür zum eigenen Nachdenken aufmachen kann. Ich tippte, blickte auf den See, tippte weiter. Wenn ich am Text etwas ändern wollte, schnitt ich mit der Schere die Absätze auseinander, schob die Textteile auf dem Fußboden hin und her, bis die Collage stimmte, und griff dann zum Klebstoff. Eine längst vergessene Arbeitsweise, man schrieb das Jahr 1992, von heute aus gesehen heißt diese Zeit schon »das vorige Jahrhundert«. Freunde und Freundinnen, die zu Besuch waren, ließen mir den Vormittag zum Arbeiten, nachmittags badeten wir zusammen, kochten, redeten, lagen in der Sonne. Ich war Mitte zwanzig.
Meinen ersten Computer kaufte ich 1994, auf ihm schrieb ich mein erstes Buch, die »Geschichte vom alten Kind«. Als es 1999 erschien, wohnte ich gerade in Österreich, arbeitete an der Oper in Graz, hatte kurz zuvor begonnen, selbst zu inszenieren. Nach dem Erscheinen des Buches und ersten guten Kritiken trafen Anfragen für Kurzgeschichten ein. Noch nie hatte ich eine Kurzgeschichte geschrieben. Ich sagte Ja. Zwölf Seiten schienen eine gute Länge. In meinem Arbeitszimmer war die Schreibtischplatte so weit oben montiert, dass ich von einem Barhocker geraden Blicks aus dem Fenster auf einen großen Berg blicken konnte. Da saß ich zwischen Proben und an den Wochenenden und schrieb, über mir eine über 400 Jahre alte Gewölbedecke, das Fenster öffnete nach außen, so wie in der Renaissance üblich. Wir, mein Verlag und ich, sammelten die Erzählungen in einen Band, so erschien 2001 das zweite Buch.
Nun wurde gefragt, ob ich über ein verschwundenes DDR-Wort schreiben wolle, ob ich vielleicht einen Reisebericht schreiben wolle, ob ich darüber schreiben wolle, was mir in Zusammenhang mit Literatur zu dem Wort »Sog« einfällt. Ja, ich wollte. Das Schreiben war wie ein Spiel, bei dem ich mir selbst begegnete. Ich zog wieder nach Berlin. Die Zeit, die ich zum Schreiben hatte, war jetzt von Montag bis Freitag zwischen 10 und 13 Uhr – so lange war die Kinderfrau da und fuhr unseren Sohn spazieren. Mein Mann arbeitete in einer anderen Stadt. Ich schrieb das »Wörterbuch«, das 2004 erschien. Die Anfragen häuften sich, ich wurde von dem oder jenem Journalisten, Lektor, Schriftsteller, Herausgeber gefragt: Ob ich über mein Lieblingsmärchen schreiben wolle? Darüber, welche Vorbilder ich habe? Was mich zum Schreiben bringt? Über meine Kindheit? Oder darüber, was mir Musik bedeutet? Aber ja, ich wollte. Durch die Projekte und Konzepte Anderer wurden in mir Geschichten zum Vorschein gebracht, Erinnerungen aufgeweckt, die meine ureigenen waren. Das Kind wuchs, meine Schreibzeit war nun von 9 bis 15 Uhr – wenn ich nicht gerade inszenierte. Gibt es einen Platz für ein Gastkind in einem Nürnberger Kindergarten während einer sechswöchigen Probenzeit? Ich begann, an meinem ersten längeren Roman, »Heimsuchung«, zu schreiben, der 2008 erschien. Es war das Jahr, in dem meine Mutter starb. Ich bekam einen Preis für das Buch und hielt eine Dankesrede. Die Rede fiel in meine Trauerzeit.
Ich bekam einen weiteren Preis, und dann noch einen. Die Preise tragen oft Namen. Namen von Autoren, die man kennt, aber manchmal auch Namen, die man nicht kennt. Was hat der oder jener Autor, die oder jene Autorin mit mir zu tun? Habe ich ihn oder sie gelesen? Ich lese den Autor, die Autorin wieder oder zum ersten Mal, lese drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Blättere mich durch meine Bibliothek. Entdecke das Ich, das ich einmal war, in meinen alten Anstreichungen wieder. Das Genre der Dankesrede gibt viel Freiheit, nur in einem Aspekt nicht: Wenn der Preis überreicht wird, muss die Rede gehalten werden. Gibt es bald wieder einen neuen Roman? Eine Freundin fragt mich, ob ich Lust hätte, für sie ein Drehbuch zu schreiben. Eine andere Freundin fragt, ob ich einen Text zu ihren Fotos schreiben würde. Und mag ich die Beatles? Ein Schriftsteller fragt, ob ich zu einer Veranstaltungsreihe über »Leben und Schreiben in Zeiten der Konkurrenzgesellschaft« etwas beitragen wolle. Ich räume den Geschirrspüler ein und aus, hänge Wäsche auf, backe Kuchen für den Kindergeburtstag. Ich frage mich, ob die Kartons aus der Wohnung meiner Mutter für immer unausgepackt bei uns im Flur stehen werden.
2012 erscheint mein Roman »Aller Tage Abend«. Die Universität Bamberg lädt mich ein, eine Reihe von Poetikvorlesungen zu halten. Wie lang ist eine Vorlesung? 40 bis 50 Minuten heißt es – das sind jeweils ungefähr 20, 25 Seiten. Vier Vorlesungen sollen es sein. Mindestens ein halbes Jahr Arbeit. Schreiben Sie schon wieder einen neuen Roman? Ich habe Lesereisen in deutsche Städte, auch ins Ausland. Ich packe Koffer. Wer kümmert sich um die Meerschweinchen? In welchem Hotel wohne ich überhaupt? Interessiert mich das Thema »Kindheitslandschaften«? Ja, sehr. Ich bekomme einen Preis, und noch einen, und noch einen. Das Preisgeld hilft beim Überleben. Die namensgebenden Autoren sind interessant. Ich stehe an meinem Bücherregal und ziehe mal dieses, mal jenes Buch heraus, lese hier und lese da. Der Termin für die Preisverleihung steht fest. Möchte ich den Abiturienten des Saarlandes sagen, was ich im Leben am wichtigsten finde? Das ist schwer. Was ist im Leben am wichtigsten? Ich werde zum ersten Mal in eine Akademie aufgenommen und soll mich vorstellen, sagen, wie ich Ich geworden sei, so in fünf Minuten. Wie bin ich Ich geworden? In Berlin wird eine Vereinbarung, die der Innensenator mit afrikanischen Flüchtlingen gemacht hat, im Nachhinein für ungültig erklärt. Ich schreibe den ersten Offenen Brief meines Lebens. Beantwortet ist er bis heute nicht.
2015 erscheint mein Roman »Gehen, ging, gegangen«. Möchten Sie ein Landschaftsbild beschreiben? Du, Jenny, ich gebe einen Band zum Thema »Hoffnung« heraus, magst du dazu etwas schreiben? Ich werde in zwei weitere Akademien aufgenommen, die Termine für die Vorstellungsreden stehen fest. In Mainz bin ich jemand anders als in Berlin oder Darmstadt, das ist ganz klar. Können Sie etwas zur Flüchtlingskrise schreiben? Möchten Sie auf unserer Veranstaltung mit dem Titel »Einstein war Flüchtling« kurz etwas sagen? Einer der Flüchtlinge, über die ich geschrieben habe, stirbt. Ich schreibe einen Nachruf. Ich bekomme einen Preis. Der Termin für die Dankesrede fällt in meine Trauerzeit. Alle Nominierten mögen bitte eine kurze Rede über ihr Lieblingsbuch und die Bedeutung des Lesens halten. Könnten Sie eine Einführung schreiben? Für diesen Autor wirklich von Herzen gern. Wie wird der Titel ihrer Keynote sein?
Zum ersten Mal schaue ich mit dieser Sammlung von Texten, die neben meinen Romanen, Erzählungen und Theaterstücken ihr und mein Eigenleben geführt haben, auf viele Jahre meines Lebens, auf den Alltag meines Denkens zurück. In Berlin habe ich den Schreibtisch eine Zeitlang im rechten Winkel zum Fenster aufgestellt und dann doch wieder so, dass ich hinausschauen kann. Vor meinem Fenster stehen Platanen und Linden. Der Schreibtisch, an dem ich sitze, ist der Schreibtisch meines Großvaters, der nach dem Tod meines Großvaters lange der Schreibtisch meiner Mutter war. Die Büroklammern bewahre ich in derselben Schublade auf, in der auch meine Mutter sie aufbewahrt hat. Draußen hört man die Stimmen und das Geschrei von Kindern auf einem Kinderspielplatz. Ab und zu fährt ein Auto vorüber. Wenn so ein kurzer Text fertig ist, drucke ich ihn aus und hefte ihn mit einer Büroklammer zusammen.
Juni 2018
I LEBEN
WO DIE WELT ZU ENDE IST
Nichts Schöneres für ein Kind, als da aufzuwachsen, wo die Welt zu Ende ist. Da gibt es nicht viel Verkehr, der Asphalt ist für die Rollschuhe da, und die Eltern müssen sich keine Gedanken um herumschweifende Bösewichter machen. Was will ein Bösewicht in einer Sackgasse.
Die Wohnung, von der aus ich zum ersten Mal auf eigenen Füßen auf die Straße hinuntergehe, liegt im zweiten Geschoß eines prächtigen alten Mietshauses mit prächtig abblätterndem Putz, verglasten Erkern, einer riesigen doppelflügligen Eingangstür und einer hölzernen Treppe, das Ende des Handlaufs mündend in ein blankgegriffenes Ungeheuer. Florastraße 2A, Florastraße 2A, Florastraße 2A. Die ersten Worte nach Mama und Papa sind dieser Straßenname und diese Hausnummer. Damit ich, falls ich verlorengehe, immer sagen kann, wo ich hingehöre. Florastraße 2A. Hockend im Treppenhaus dieses Hauses lerne ich, wie man eine Schleife zubindet. Gleich um die Ecke, in der Wollankstraße, befindet sich der Bäckerladen, in dem ich, vier- oder fünfjährig, zum ersten Mal in meinem Leben allein einkaufen darf, von meinen Eltern hinuntergeschickt mit Beutel und abgezählten Talern für die Brötchen zum Frühstück. Der Bäckerladen hat geschnitzte Regale und eine Kasse, bei der die Verkäuferin, bevor sie das Geld hineingibt, an einer Kurbel dreht. Wenn die Schublade aufgeht, klingelt es. Die Wollankstraße endet ein paar hundert Meter weiter sehr plötzlich an einer Mauer. Dort ist die Endhaltestelle der Buslinie 50. Meine Eltern müssen sich keine Gedanken um herumschweifende Bösewichter machen, was will ein Bösewicht in einer Sackgasse. Damals werde ich allein auf den Hof zum Buddeln geschickt, eine große Tanne wirft Schatten auf meinen Buddelkasten, und wenn das Essen fertig ist, ruft meine Mutter aus dem Fenster. Im ersten Stock unseres Hauses ist eine Tanzschule, von dort hört man bis auf den Hof hinunter ein Klavier klimpern und die Anweisung der Lehrerin für die Schritte.
Hinter der Mauer, an der die Wollankstraße damals für mich zu Ende ist, fährt die S-Bahn. Sie fährt nach links und nach rechts, aber beide Richtungen kommen für uns nicht in Frage. Eine S-Bahn-Station weiter links, aber auch auf unserer Seite der Mauer, wohnen meine Großmutter mit ihrem Mann und meine Urgroßmutter zusammen in einer Zweizimmerwohnung im dritten Hinterhof eines Berliner Hauses. Eigentlich ist das Haus ein Eckhaus. Von der anderen Seite betreten, würde die Wohnung im Vorderhaus sein. Aber seit diese andere Seite zum Grenzstreifen erklärt worden ist, endet die begehbare Straße kurz vor der Ecke sehr plötzlich an einer Mauer. In diesem Viertel, in dem das Mietshaus meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter steht, ist immer Winter. Wenn ich die Schneeflocken vor dem grünlichen Licht der Straßenlaterne ansehe, wird mir schwindlig, Kohlen werden aus dem Keller geholt, der Boden des dritten Hinterhofs ist mit Beton ausgegossen, und um die Aschetonnen herum, die dort stehen, sind Schnee oder Pfützen immer schäbig und rötlich. Gebadet wird in diesem Haushalt nur einmal pro Woche, denn dafür muss der Badeofen geheizt werden. Das winzige Fenster zum Lüften des Badezimmers öffnet man mit einer mir unendlich lang scheinenden Metallstange, die oberhalb der Toilette zu greifen ist. Sie führt über die Speisekammer hinweg, die von der Küche her abgeteilt ist, durch einen hochgelegenen Tunnel bis zu diesem mir niemals sichtbaren winzigen Fenster. In der Küche steht auf dem Boden eine große, bauchige Flasche mit gärendem Traubensaft, aus dem Wein werden soll, aber manchmal wird daraus Essig. Auf dem Küchenbuffet sehe ich ein Einweckglas mit Blutegeln, die meine Großmutter sich wegen Thrombosegefahr selbst ansetzen muss. Wenn ich das Birnenkompott auslöffele, das es als Nachspeise gibt, blicke ich mit leichter Beunruhigung auf die Egel und den Verschluss dieser Gläser. Das Geschirr wäscht meine Großmutter nicht unter fließendem Wasser ab, sondern in zwei Schüsseln, die sie wie Schubladen aus dem Küchentisch zieht. Im Schlafzimmer meiner Urgroßmutter, wo auch ich schlafe, wenn ich dort übernachte, tickt meine ganze Kindheit hindurch eine lackierte hölzerne Uhr mit goldenen Ziffern. In diesem Zimmer, das nie geheizt wird, bewahrt meine Urgroßmutter ihren Pepsinwein auf, und im Fenster des Ofens ihr Strickzeug. In dieses Ofenfach, neben das Strickzeug, legt sie vor dem Zubettgehen, nachdem sie ihren Haarknoten gelöst hat, auch die Nadeln aus ihrem Haar, dann fällt ein langer, grauer Zopf bis auf ihren Rücken hinab. Wenn ich vom Schlafzimmer oder auch vom Wohnzimmer hinunter blicke auf die Straße, die keine Straße mehr ist, kann ich die patrouillierenden Soldaten beobachten, oder die in Sichtweite nach links oder rechts fahrenden S-Bahnen zählen. Den Sandweg sehe ich, die Neonleuchten, die Schneeflocken vor dem grünlichen Licht, dann die Spanischen Reiter, die Wachtürme und die Mauer, dahinter die Schienen, hinter den Schienen Kleingärten, und hinter den Kleingärten ein riesiges Gebäude mit vielen Fenstern, das vielleicht eine Schule ist, vielleicht auch eine Kaserne. In dem Haus, in dem meine Großmutter mit ihrem Mann und ihrer Mutter wohnt, riecht es, wenn ich sonntags komme, immer nach Schweinebraten, Dampfkartoffeln und Blumenkohl, es kann sein, dass es der Schweinebraten, die Dampfkartoffeln und der Blumenkohl sind, die meine Großmutter zubereitet hat, aber es können auch die der Nachbarn sein. Das weiß man nie.
Kurz bevor ich eingeschult werde, ziehen wir um, in die Leipziger 47. Ein blauweiß gewürfeltes Hochhaus-Doppel, 23 Etagen das unsere, 26 Etagen das Nebenhaus. Das erste fertige Haus in der großen sozialistischen Magistrale, von der man heute sagen würde, sie führe auf den Potsdamer Platz zu. Damals führt die Leipziger Straße nicht auf den Potsdamer Platz zu, sondern ist kurz vor dem Potsdamer Platz, nämlich dort, wo die Mauer einen Knick macht, sehr plötzlich beendet. Links von unserem Haus ist also der Westen, und weiter vorn, dort, wo die Mauer den Knick macht, ist auch der Westen, kurz vorher hat die Buslinie 32 ihre Endhaltestelle. Das kenne ich schon von der Wollankstraße in Berlin-Pankow. Manches andere kenne ich nicht von Pankow. In der Leipziger Straße gibt es, als wir einziehen, nur unser Haus, eine Kaufhalle, eine Schule, zwei vom Krieg schwer beschädigte Häuser, und sonst gar nichts. Im Pankower Bürgerpark habe ich Fahrradfahren gelernt, im Schlosspark die Enten gefüttert, in der Schönholzer Heide das Herbstlaub mit den Füßen vor mir hergeschoben beim sonntäglichen Spaziergang. Jetzt ist ringsum Schlamm. Mein Weg zur Schule im Schlamm der Großbaustelle, mein Weg zur Kaufhalle im Schlamm der Großbaustelle, mein Weg zum Klavierunterricht im Schlamm der Großbaustelle. Im Schlamm finde ich einen Zwanzigmarkschein, grün. Hätte ich ihn nicht im Schlamm gefunden, ein Wunder!, wüsste ich längst nicht mehr, wie damals ein Zwanzigmarkschein aussah. Der Sonntagsspaziergang führt uns in die kleinen Straßen, die in Richtung Westen von der Friedrichstraße abzweigen, denn nur dort gibt es Asphalt zum Rollschuhlaufen für mich, der Asphalt ist hellgrau und glatt, und wir können mitten auf der Fahrbahn spazieren, denn Verkehr gibt es hier nicht. Was will ein Autofahrer in einer Sackgasse.
Die Häuser wachsen und füllen sich mit Menschen, darunter Kindern, die meine Schulfreunde werden. Wenn meine Freundin verschläft, im Haus gegenüber, sehen wir zwischen unzähligen hellen Würfelchen das dunkelgebliebene Fenster in Zeile sieben und rufen an, um sie zu wecken. Der Aufbau des Sozialismus ist für mich immer mit dieser Baustelle, auf der ich wohne, verknüpft. Links von unserem Haus steht das Hochhaus des Springer-Verlags, allerdings hinter der Mauer, gespiegelt an ihr wie ein verfeindeter Zwilling. Und weiter vorn Richtung Knick, etwa auf Höhe meines Schulhofs, ist jenseits der Mauer die obere Hälfte eines Gebäudes zu sehen, an dem außer zwei leuchtenden Buchstaben in Schreibschrift, auch eine leuchtende Zeitanzeige angebracht ist. Meine ganze Schulzeit über lese ich die Zeit für mein sozialistisches Leben von dieser Uhr in der anderen Welt ab.
Wir wohnen im dreizehnten Stock. Im dreizehnten Stock fragt sich ein Kind so manches, zum Beispiel, ob es wohl möglich wäre, auf der Balustrade des Balkons zu balancieren. Ich entscheide mich aus Gründen, an die ich mich heute nicht mehr erinnere, knapp dagegen. Wenn ich meinen Wohnungsschlüssel vergessen habe und meine Mutter noch nicht zu Haus ist, stehe ich am Fenster des Etagenflurs, das nach Westen zeigt, warte und zähle zum Zeitvertreib die Doppelstockbusse, die beim Springerhochhaus verkehren. Im Osten gibt es keine Doppelstockbusse. Vom dreizehnten Stock aus habe ich einen guten Überblick. Je nach Tageszeit verkehren sie im Abstand von fünf oder zehn Minuten. Mein Rekord im Warten ist 26. Irgendwann ziehen wir in eine größere Wohnung um, das heißt, wir ziehen in die sechste Etage. Ein so riesiges Hochhaus ist selbst wie eine Stadt, und wenn man die Wohnung tauschen möchte, würfelt man sich einfach ein paar Etagen weiter hinauf oder hinunter und stellt seine Möbel in den Fahrstuhl. In der sechsten Etage zu wohnen, ist nicht nur für mein Überleben von Vorteil, weil der Schwindel an Reiz verliert, es ist auch von Vorteil, dass, wenn alle drei Fahrstühle steckengeblieben sind, das Treppensteigen nicht so lange dauert. Immer, wenn ich in diesem rostrot gestrichenen Treppenhaus, das nach Pisse und Staub riecht, die flachen Stufen aufwärts steige oder abwärts springe, denke ich an den Hinweis unseres Erdkundelehrers, dass wir uns im Falle eines Atomschlags in einem Treppenhaus beim Geländer hinkauern sollen, um uns zu schützen. Während ich in der Leipziger Straße wohne, trifft der Atomschlag nicht ein, nur ein kleines Erdbeben gibt es in einer Nacht – da flüchten wir und viele Nachbarn, Pullover übers Nachthemd gezogen, durch das rostrote, nach Pisse und Staub riechende Treppenhaus nach unten, stehen vor dem riesigen Klotz, der uns ausgespuckt hat, blicken mit Sorge aufwärts und halten für möglich, dass uns jetzt alle 23 Etagen auf den Kopf fallen, aber auch das trifft nicht ein.
Mit dreizehn Jahren fragt sich ein Kind so manches. Zum Beispiel, ob bei einem Zungenkuss beide Beteiligte die Zunge herausstrecken müssen, oder immer nur einer, also abwechselnd. Das Alphabet des Küssens gibt es schriftlich, auf einem vom vielen Studieren zerknitterten Zettel. Meine Schulfreunde und ich haben es immer dabei, wenn wir in die Ruine des Deutschen Doms am Gendarmenmarkt einsteigen, um dort die angemessene Hierarchie der Küsse zu überdenken und durch Versuchsreihen herauszuexperimentieren: Kuss auf die Hand – Respekt, Kuss auf die Stirn – Hochachtung, Kuss auf die Wange – Zuneigung, Kuss auf den Mund – Liebe. In dieser Ruine haben wir den Himmel immer über uns. Mit bestäubten Kleidern kehren wir nach Hause zurück in unsere Neubauwohnungen. Als die Kindheit allmählich übergeht in etwas anderes, und die Leipziger Straße endlich eine Straße ist und keine Baustelle mehr, ziehen wir um. Meine Mutter hat genug vom blauweißgewürfelten Ausblick, wir ziehen in einen Altbau: Reinhardt/Ecke Albrecht, schräg gegenüber das Deutsche Theater. Vom Fenster meines Kinderzimmers aus habe ich jetzt einen herrlichen, freigebombten Blick auf Silhouetten alter Berliner Häuser vor untergehender Sonne. Die Sonne geht noch immer im Westen unter. Die Reinhardtstraße endet irgendwann sehr plötzlich an einer Mauer. Hundert Meter von unserem Haus entfernt befindet sich die Endhaltestelle der Buslinie 78. Jetzt, da ich das Alphabet des Küssens schon auswendig weiß, führt mich ein Freund in die Ruinen der Museumsinsel. Im Erdgeschoß wächst eine Birke. Um in die zweite Etage zu gelangen, muss man klettern und oben übersetzen von der Birke zum brüchigen Marmorfußboden. Oben steht eine weiße Venus vor den ausgebrannten Fenstern der Galerie. Nichts Schöneres für ein Kind, als da aufzuwachsen, wo die Welt zu Ende ist.
Mai 2006
UNTER MENSCHEN
Dankesrede für den Solothurner Literaturpreis
Noch nie habe ich eine Dankesrede gehalten, noch nie eine halten müssen – das liegt daran, dass dieser Solothurner Preis der erste Preis ist, wo ich, sozusagen, den Hauptgewinn bekomme. An einigen Preisen bin ich haarscharf vorbeigesegelt oder habe den zweiten Platz belegt, wenn es einen zweiten gab – immer war ich überrascht, wenn ich überhaupt in die engere Auswahl kam, manchmal war ich mit den Entscheidungen der jeweiligen Jury einverstanden, dann fiel das Zurücktreten leicht, manchmal bekam nicht ich den Preis, und auch nicht der, dem ich ihn gegeben hätte – dann blieb ich mit dem Gefühl zurück: Die Jury war sich nicht einig und ist deswegen auf einen Kandidaten ausgewichen, der weniger Widerstand bot. Natürlich hoffe ich jetzt, in diesem Falle, sehr, dass ich nicht der Kandidat war, der am wenigsten Widerstand bot, sondern dass die Jury sich einig war!
Was heißt es denn, dass ich ausgezeichnet werde? Es heißt, dass das, was ich geschrieben habe, das, was ich an Denken und Fühlen in Buchstaben übersetzt habe, von Lesern wieder zurückübersetzt werden konnte in Denken und Fühlen, es heißt, dass ich nicht allein bin mit meinem Lebensgepäck, heißt auch, dass die unauflösbaren Gleichungen, die Fragen, die ich an meine Leser weitergebe, nicht nur von mir allein weiter bearbeitet werden müssen, dass wir, meine Leser und ich, uns die Arbeit teilen werden. Es heißt auch, dass ich mit manchen Dingen, die ich zu beschreiben versucht habe, auf Grund gestoßen bin, auf das gestoßen bin, was in meinem letzten Buch »Heimsuchung« der blaue Ton ist, diese Schicht, die unter allem liegt, was wächst, und die kein Wasser durchlässt. Auf das, was man mit dem Gefühl zwar erreichen, aber nicht durchdringen kann, auf das Eigentliche.
Ändert ein Preis etwas an der Arbeit? Macht er das Schreiben leichter? In einer Hinsicht auf jeden Fall: Eine Zeitlang muss man sich ums Überleben keine Sorgen machen, muss nicht auf die Einhaltung der Bewerbungsfristen bei Stipendien achten, kann die Gedanken schweifen lassen und muss nicht, kaum dass das eine Buch gedruckt ist, gleich die ersten zwanzig Seiten des nächsten einreichen, das sich einem selbst noch kaum zeigen will. Man muss nicht Geldarbeiten annehmen, die den Kopf besetzen, man darf zu Hause bleiben und in Ruhe nachdenken.
In anderer Hinsicht ändert ein Preis leider überhaupt nichts am Schreiben: Wenn man etwas hinschreibt, was erst gedacht werden will, bleibt das Denken schwer, jedes Mal beginnt man vollkommen von vorn und ist vollkommen allein. Das kurze Signal aus parallelen Welten hat einen gefreut für die Gegenwart, aber für die Zukunft des Schreibens nützt es einem leider nichts. Sicher, man wird bestärkt darin, dass man, wie es heißt, »schreiben kann«, aber die Unmöglichkeiten, die einen schreiben machen, bleiben Unmöglichkeiten, jenseits des äußeren Erfolgs. Und das Schreiben-Können bleibt, sobald man wieder allein am Schreibtisch sitzt, auch eine Frage des Glücks. Die Zweifel, die ich habe, können von außen leider nicht behoben werden. Bei jedem Neubeginn habe ich mich gefragt, ob ich es jemals gewusst habe: Wie man einen Satz hinschreibt, nur einen erst einmal, welchen Blick man auf eine Geschichte werfen kann, wie überhaupt das gehen soll: Das Innerste nach außen kehren, und dann durch die abgezogene eigene Haut hindurchschauen. Immer wieder habe ich es nicht mehr gewusst.
Kürzlich rief mich der Jury-Vorsitzende Hans Ulrich Probst an und fragte, ob ich Wünsche hätte für die Eingangs- und die Ausgangsmusik bei der Preisverleihung, und es schrieb mir der Redakteur von der Mittelland-Zeitung, bis wann er meine Dankesrede haben müßte, damit sie abgedruckt werden kann. Es ist heute auf den Tag genau drei Wochen her, dass ich im Bestattungsinstitut saß, um die Beerdigung meiner Mutter zu besprechen, und die Dame von der Bestattungsfirma fragte mich, ob ich Wünsche hätte für die Eingangs- und die Ausgangsmusik bei der Trauerfeier, und wie ich es mit der Rede halten wolle – wenn es mir zu schwer sei, selbst zu sprechen, wüsste sie einen guten Redner.
Die eine Rede ist für das Leben und inmitten des Lebens, sie ist der Dank dafür, dass meine Arbeit für manche Menschen von Wert ist, sie ist Ausdruck der Hoffnung, dass dieses Fragen und Antworten zwischen mir und meinen Lesern noch eine Zeitlang so gehen wird, solange ich auf der Welt bin. Die andere Rede ist für meine Mutter, inmitten des Todes, sie ist Erinnerung an meine Mutter und meine eigene Vergewisserung, dass ich mit dem, was war, jetzt auskommen muss für immer. Eingemeindet wird der Abschied genauso wie die andere Feier: mit Eingangs- und Ausgangsmusik, eingemeindet wird der Tod durch das Ritual, das die Lebenden kennen. Wenn aber beides so eng aneinanderstößt, wie jetzt, in dieser Zeit meines Lebens, so eng, wie das Leben und das Nichts im Moment des Todes, spiegelt sich beides aneinander, gibt sich die Hand und tauscht in einem Moment die Seiten.
Haben Sie vielen Dank.
Juni 2008
OFFENE BUCHFÜHRUNG
Was wirst du mit meinen Möbeln machen, wenn ich einmal weg bin, fragt mich meine Mutter. Ach, sage ich, das werden wir sehen. Die sind viel wert, du kannst sie verkaufen. Schauen wir mal, sage ich. Du hängst an denen, oder? Ich sage nichts. Du bist ja auf dem Tisch hier schon gewickelt worden. Ich sage nichts. Aber in deine Wohnung werden sie nicht hineinpassen. Nein, sage ich.
Meine Wohnung zu verkaufen, wird gar nicht leicht sein, sagt meine Mutter. Ach was, sage ich. Die Nachbarn wollten ihre verkaufen und haben es ein halbes Jahr lang nicht geschafft. Jetzt wollen sie sie vermieten. So, sage ich. Dabei versteht man das nicht, denn hier ist es doch wirklich schön. Nein, sage ich, das versteht man wirklich nicht. Da wirst du einmal ein schönes Problem haben, sagt meine Mutter. Ich sage nichts.
Meine Mutter sagt: Wir müssen zur Bank, du musst eine Vollmacht für mein Konto haben. Jaja, sage ich. Sie sagt, das ist wichtig. Ich sage, ja, ich weiß. Wann hast du Zeit – am Donnerstag? Nein, sage ich, am Donnerstag bin ich nicht da. Dann nächste Woche. Ja, sage ich. Wann, fragt meine Mutter. Ich sage, ich muss erst nochmal in den Kalender schauen. Meine Mutter sagt: gut. Einige Wochen später sagt sie, deine Unterschrift war gar nicht nötig, ich konnte dich einfach eintragen lassen.
Als meine Mutter stirbt, habe ich also eine Vollmacht. Von dem Konto meiner Mutter kann ich ihre Beerdigung bezahlen und das Essen nach der Beerdigung, den Grabstein und die Friedhofsgebühr, ich kann den Kredit und die Betriebskosten für ihre Wohnung eine Zeitlang weiter abbezahlen, während ich versuche, die Wohnung zu verkaufen, von einer kleinen Rente, die sie mir hinterlässt, kann ich später die monatliche Rate für das Möbellager bezahlen, in das ich ihre Möbel bringen lasse.
Ich wähle eine Urne aus. Ich wähle ein Blumengebinde aus. Ich wähle Rosenblätter aus, die ins Grab geworfen werden. Ich beauftrage einen Redner, der die Rede, die ich für meine Mutter schreibe, halten soll. Ich gebe einen Nachsendeauftrag bei der Post auf. Der Nachsendeauftrag kann zuerst nicht ausgeführt werden, weil ich im Formular vergessen habe, nach dem Wort »bei« meinen Namen einzutragen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich den Nachsendeauftrag ja gerade deshalb ausfüllen muss, eben weil meine Mutter nicht mehr bei mir ist. Ich muss den Antrag ein zweites Mal ausfüllen und schreibe also jetzt: Name meiner Mutter bei mein Name. Ich melde das Abonnement der Tageszeitung, die meine Mutter immer beim Nachmittagstee gelesen hat, ab und erhalte eine Bestätigung für den zurückgebuchten Beitrag in Höhe von 202,07 €. Die Bezeichnung für die Rückbuchung ist: Abgang. Ich schicke die Bahncard meiner Mutter zurück, die Bahn erstattet mir von den 110,– €, die meine Mutter zweieinhalb Monate zuvor bezahlt hat, 91,66 € zurück. Ich bitte um die Stillegung ihres Telefonanschlusses und die Entfernung ihres Eintrags aus dem Telefonbuch. Ihre letzte Rechnung, die Rechnung für die Telefonate, die sie noch mit mir geführt hat, beträgt 16,99 €. Ich melde den Anschluss meiner Mutter bei der Gebühreneinzugszentrale für Rundfunk und Fernsehen ab. »Das Teilnehmerkonto haben wir mit Ablauf des Monats abgemeldet. Das Teilnehmerkonto ist ausgeglichen.«
An dem Vormittag, an dem meine Mutter verbrannt wird, sitze ich zwei Stunden zu Hause auf dem Stuhl am Fenster, auf dem sie immer gesessen hat, und warte, dass die Zeit vergeht.
Ich melde meine Mutter beim ADAC ab. Ich schreibe einen Nachruf, der in der Zeitung erscheint, die meine Mutter immer beim Nachmittagstee gelesen hat. Für den Nachruf bekomme ich 170,03 €.
Als das Finanzamt wissen will, ob ich bewegliche und unbewegliche Güter: Immobilien, Guthaben, Wertpapiere, Schmuckstücke, Teppiche, Gold- oder Silbersachen geerbt habe, sind 6 Wochen seit dem Tod meiner Mutter vergangen. »Alle Angaben zum Wert des Nachlasses werden nach dem Stand am Todestag erbeten.« Das Finanzamt will aber nicht wissen, ob ich eine erst zur Hälfte geleerte Schachtel Zigaretten, einen Bademantel, in dessen Tasche ein gebrauchtes Papiertaschentuch steckte, oder einen Strauß Blumen, der noch nicht einmal welk war, geerbt habe. Es will auch nicht wissen, ob ich die Schuhgröße von meiner Mutter geerbt habe, meine Stimme oder die Art, wie ich mich bücke, um einen Strumpf anzuziehen. Es will durchaus nicht wissen, ob ich das Rezept für die Königsberger Klopse geerbt habe, den Weihnachtsbaumschmuck aus Stroh oder das Romméspiel mit den Zetteln, auf denen die Spielstände der letzten fünf Jahre mit Datum verzeichnet sind. Es gibt in dem Formular NS 17 zur Berechnung der Erbschaftssteuer auch keine Spalte, in die ich die 10 Flaschen mit Haarwaschmittel und 10 Tuben mit Haarspülung eintragen könnte, die ich von meiner Mutter geerbt habe. Meine Mutter hat so viele auf einmal davon gekauft, damit sie in der Apotheke möglichst viele goldene Kundentaler bekommt, für meinen Sohn, ihren Enkel, zum Spielen. Mit diesem Haarwaschmittel und dieser Spülung wasche und spüle ich mir die nächsten anderthalb Jahre die Haare.
8 Wochen nach dem Tod meiner Mutter schickt mir die Künstlersozialkasse eine Beitragsrechnung über 1,42 € für den letzten Tag, an dem meine Mutter am Leben war, denn es war der erste, und für meine Mutter auch der letzte, Tag eines Monats, aber kein Mitarbeiter der Künstlersozialkasse würde gern wissen, dass ich an diesem Tag die nassen Hosen und das von den Chirurgen zerschnittene, nasse Hemd meiner Mutter zum Trocknen auf meine Wäscheleine gehängt habe, und dass ich auch das Wäscheaufhängen von meiner Mutter geerbt habe. »Aufgrund des geringen Betrages wird dieser nicht vom Konto Ihrer Mutter abgebucht werden. Wir möchten Sie daher bitten, diesen geringen Betrag unter Angabe der Versicherungsnummer Ihrer Mutter auf eines der unten genannten Konten zu überweisen.«
Ich finde einen Steinmetz, der sehr schöne Grabsteine macht, und gebe ihm die Geburts- und Sterbedaten meiner Mutter, damit er einen Entwurf machen kann.
Ich erbe also eine eingerichtete Dreizimmerwohnung mit einem 12 m2 großen Keller. Ich erbe Regale, die mit Büchern gefüllt sind, Schränke mit Schubladen voller Akten, Fotos, Notizen, erbe eine Abstellkammer mit Bettwäsche, Putzmitteln, Werkzeug, Schuhen, großen Töpfen, Bügelbrett, Wäscheständer, Besen und Schrubber, ich erbe Kämme, Bürsten, Schminkzeug, Duschbad und Cremes, erbe Geschirr, Messer und Gabeln, Flaschenöffner, Inhaliergeräte, Kopfschmerztabletten, Blumenvasen, Büroklammern, Disketten, Briefumschläge, ich erbe 1 Fernseher, 10 Stühle, 3 Tische, 1 Bett, 2 Sofas, 2 Schränke, 1 Vertiko, 1 Garderobe, 11 Lampen, 1 Kronleuchter, 5 Teppiche, 1 Korbtruhe, ich erbe Wintermäntel, Tagebücher, Schallplatten, ich erbe 8 Flaschen Wein und 3 mit Mineralwasser, erbe 1 Spieldose, erbe Ketten, Ringe und Broschen, erbe tiefgefrorenen Braten und tiefgefrorenes Zucchinigemüse, 2 Büchsen mit Linsen, 1 halbes Stück Butter, 1 Zitrone, 3 Becher probiotisches Joghurt, erbe 1 Fahrrad, 1 Rasenmäher, 1 Waschmaschine, 1 Biedermeiersekretär, 1 Ohrensessel, 2 Gemälde, 12 gerahmte Bilder, 10 Äpfel und 1 Banane, etwas Brot, ich erbe Kugelschreiber und weißes Papier, erbe Bindfaden, Untersetzer und Topflappen, erbe Münzen und Geldscheine aus allen möglichen Ländern, Pappkartons mit Knöpfen und Garn, 1 großes und 1 kleines Nähkästchen, ich erbe hunderte von Dias und 3 Projektoren, erbe 8 Aschenbecher, 3 Stangen Zigaretten, 1 alten Kassettenrekorder, 2 Spiegel, ich erbe 1 Computer, 1 Drucker, 2 alte Laptops, 1 alten Bildschirm, Verlängerungsschnüre und 1 Toaster, ich erbe 2 Zimmerpflanzen, mehrere Bettdecken, Wolldecken, Kissen, erbe leere Koffer, erbe Handtaschen und Hausschuhe, Nussknacker, Lichterketten, Osterhasen, Nikolausstiefel, 2 Kartons mit Zwiebelmustergeschirr, Tischdecken, Handtücher, Brillen, erbe Pullover, Strümpfe, Blusen, Unterwäsche, erbe die Strickjacken und die Halstücher meiner Mutter. Meine eigenen Koffer mit Wintersachen, die ich über den Sommer immer bei meiner Mutter in den Keller gestellt habe, erbe ich nun, und meine eigene Säuglingsgarnitur, außerdem ein Brettchen, das ich bemalt habe, als ich im Kindergarten war, 2 Kartons mit Steinen, die ich als Kind gesammelt habe, und meinen kleinen chinesischen Sonnenschirm.
Schreiben Sie wieder etwas Neues, beginnen die Leute zu fragen, als ein halbes Jahr um ist. Nein, sage ich, im Moment noch nicht.
6 Monate nach dem Tod meiner Mutter bezahle ich bei der Krankenkasse den Transport, mit dem sie zum Sterben gefahren wurde, 30,00 €. Ich melde das fünfzehn Jahre alte Auto meiner Mutter bei der Versicherung ab und schenke es einer Freundin. Mit dem Verkauf der Wohnung meiner Mutter beauftrage ich eine Maklerin. Betriebskosten und Kreditrückzahlung für diese Wohnung betragen 750,– € pro Monat. Sollte die Wohnung meiner Mutter verkauft werden, muss sie leer sein. Ich beginne, Kartons zu packen. Ich sortiere bei mir zu Hause meine eigenen Bücher aus, damit Platz frei wird für die Bücher, Papiere und Fotoalben meiner Mutter. Im Winter organisiere ich den ersten Transport, bei dem zwei Möbelpacker den Schreibtisch meiner Mutter, einen Schrank und eine Truhe zu mir in die Wohnung bringen. An dem Tag ist Glatteis, und ich bin froh, dass die Männer mit den schweren Möbeln nicht ausrutschen.
Im Januar 2009 erfahre ich, dass der Verwalter der Wohnung meiner Mutter mit so viel Geld durchgebrannt ist, dass die Strom- und Wasserlieferung für die gesamte Wohnanlage gefährdet ist. Um dies zu verhindern, beschließt die Eigentümerversammlung über die normalen monatlichen Betriebskosten hinaus zwei Sonderzahlungen zur »Liquiditätssicherung«.
Die Wohnung meiner Mutter ist sehr schön, aber niemand kauft sie, wahrscheinlich liegt sie zu tief im Osten, im Bezirk Berlin-Weißensee, kurz vor Moskau eben. Ich sende eine E-Mail an etwa hundert Adressen von Freunden und Bekannten. Niemand braucht eine Wohnung. Ich wache nachts auf und habe Angst.
Ich fahre zum Steinmetz, um seinen Entwurf zu begutachten.
Von der Steuerberaterin meiner Mutter bekomme ich die Aufforderung, die Steuererklärung für meine Mutter zu machen, das heißt für die Monate, die meine Mutter im Jahr 2008 noch am Leben war. Ich bringe eine Wäschetruhe und verschiedene Kartons aufs Land. Kartons mit Büchern aus der Wohnung meiner Mutter kommen, wenn ich sie fertig gepackt habe, teils zu mir, teils ins Antiquariat, teils aufs Land. Um Interessenten für die Wohnung meiner Mutter zu finden, mache ich Aushänge in einer Hochschule in Berlin-Weißensee. Kein Professor braucht eine Wohnung.
Die Leute fragen mich: Schreiben Sie schon wieder etwas Neues?
Erst als ich das Konto meiner Mutter auflöse, fällt mir auf, dass meine Mutter auch haftpflichtversichert war. Die Beiträge, die während der ganzen Zeit, in der sie schon tot war, von ihrem Konto abgebucht wurden, können, wie mir gesagt wird, leider nicht rückgebucht werden. In diesem Frühling, ein knappes Jahr nach dem Tod meiner Mutter, miete ich einen kleinen Lkw und engagiere zwei Studenten. Wir bringen 10 Kartons, das Fahrrad, den Rasenmäher, verschiedene Küchenutensilien aufs Land. Während der Fahrten hin und zurück reden wir über Film. Im Frühling erstattet mir die Stromgesellschaft, von der die nun schon seit einem Dreivierteljahr leerstehende Wohnung meiner Mutter mit Strom versorgt wird, 119,81 € zurück. Die Wohnung kostet nach wie vor 750,– € im Monat. Ich beschließe, sie jetzt, wenn es nicht anders geht, zu vermieten und setze eine Annonce in die Zeitung. Etwa zu dieser Zeit entsteht ein Missverständnis mit der Telekom, mein Telefon funktioniert über Wochen hinweg nicht, schließlich bricht auch die Internetverbindung zusammen. Meine Wohnungsannonce erscheint, aber die darin angegebene Telefonnummer geht ins Leere. Um einige Lampen, das Bett meiner Mutter und die Fernsehbank bei eBay einzustellen, muss ich mich in ein Internetcafé setzen. Von dort auch schreibe ich E-Mails an die Ärzte aller 8 Abteilungen eines Weißenseer Krankenhauses, um ihnen die Wohnung meiner Mutter anzubieten. Kein Arzt braucht eine Wohnung.
Als die Bankangestellte der Bank, bei der meine Mutter den Kredit für ihre Wohnung zu laufen hatte, erfährt, dass ich die Wohnung jetzt auch vermieten würde, weist sie mich darauf hin, dass es sich bei ihnen um eine Förderbank handelt, dass ich also gar nicht auf dem freien Markt vermieten darf, das heißt, nicht die übliche Miete verlangen darf, und für den jeweiligen Mieter eine Erlaubnis einholen muss. Sie rät mir, den Kredit umzuschulden.
Ich begutachte den Grabstein. Die Schrift soll mit brauner Farbe ausgemalt werden.
Der nächste Transport, Anfang Sommer, diesmal mit einer Umzugsfirma, geht erst zum Möbellager, wo ich 1 Sofa, 1 Schrank, 3 Regale, 1 Sessel, 2 Stühle, und einige Kartons einlagere. Vom Möbellager fährt der Transport weiter zu meiner Wohnung, dorthin bringe ich ebenfalls einige Kartons, außerdem 1 Kommode und einige Bilder.
Ich beauftrage einen zweiten Makler mit dem Verkauf, beziehungsweise der Vermietung der Wohnung. Er rät mir, auch die allerletzten, vom Räumen übriggebliebenen Utensilien, die hier und da noch herumstehen und -liegen, vorerst wenigstens in den Keller zu bringen. Auch die Gardinen soll ich abnehmen und die Wohnung dann malern lassen.
Sie haben sicher schon ein neues Buch in Arbeit, oder?
Weil ich in Deutschland als freischaffende Schriftstellerin keinen Kredit mehr bekommen würde, verhandle ich noch vor den Schulferien mit der österreichischen Bank meines Mannes über die notwendige Umschuldung. Der Kredit wird mir gewährt, mein Mann bürgt für mich.
Ich räume den Eisschrank meiner Mutter ganz und gar leer und ziehe den Stecker aus der Steckdose. Jetzt ist es in der Wohnung zum ersten Mal vollkommen still. Die tiefgefrorenen Essen, die noch meine Mutter gekocht hat, transportiere ich in einer gut isolierten Tüte und räume sie zu Hause in meinen eigenen Tiefkühlschrank ein.
Der Grabstein ist jetzt fertig und wird aufgestellt. Nach Abschluss ihrer Berechnungen sagt mir die Steuerberaterin meiner Mutter, das steuerliche Guthaben meiner Mutter betrage 5,– €. Mein Telefon funktioniert wieder. Das Internet funktioniert wieder. An dem Tag im Herbst, an dem ich die Wohnung meiner Mutter endgültig leerräume, das heißt so leer, dass nicht einmal mehr Bindfaden herumliegt oder zerknülltes Zeitungspapier, an diesem Tag, an dem ich die Hausschuhe meiner Mutter, den Schrubber, den Handfeger, die Schaufel und die Werkzeugkiste in den Keller bringe, an dem ich den Aschenbecher, in dem noch die letzte Zigarette steckt, die meine Mutter geraucht hat, in mein Auto trage (später, während der Rückfahrt in meine Wohnung, wird die Asche zerbröseln, die noch meine Mutter abgestreift hat), an diesem Tag treffe ich die Nachbarn meiner Mutter auf dem Flur. Als sie hören, dass ich die Wohnung nicht mehr nur verkaufen, sondern auch vermieten würde, interessieren sie sich für das Angebot. Einige Wochen später werden wir handelseinig.
Nun würde ich gern meine Mutter anrufen.
Dezember 2009
DER SCHNELLKOCHTOPF
In der Ferne, wo ich mit nur einem Koffer, einem Paar Schuhe zum Wechseln und zwei, drei Büchern unterwegs bin, fehlt mir beinahe nichts, aus der beinahe leeren Ferne denke ich beinahe gar nicht an meine übervolle Wohnung in Berlin. Meine Wohnung, die auch zuvor schon keine leere Wohnung war, enthält nun, seit dem Tod meiner Mutter, alles doppelt. Sie enthält nun 2 Pakete mit Weißwaschpulver, 4 Paar Stiefel statt 2, sie enthält 2 Wintermäntel, 40 Reiseführer statt 20, 2 Nähkästchen, 2 Waschschüsseln, 2 Truhen, 2 Schreibtische und so weiter. Meine Arbeit ist nun, aus zwei Leben, die plötzlich in meine Wohnung hineingezwängt sind, wieder nur eines zu machen, aber das ist keine leichte Arbeit. Meine Arbeit ist es, die Dinge, die meine Mutter an irgendetwas erinnert haben, von denen zu unterscheiden, die mich an irgendetwas erinnern. Die Dinge, die ich verbrauchen kann, zu verbrauchen, andere zu verschenken oder auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Weil aber kein Mensch sämtliche Dinge, die zum Leben eines Menschen gehört haben, an irgendein anderes Leben anhängen kann, weil niemand alles selbst verbrauchen und benutzen, an andere verschenken oder auf dem Flohmarkt verkaufen kann, deswegen muss auch ich einiges wegwerfen.
Den Schnellkochtopf, in dem meine Mutter mir meine Kindheit lang Weißkohleintopf gekocht hat, fand ich in ihrem Keller. Sein Deckel schließt nicht mehr, und selbst wenn der Deckel noch schließen würde, hätte ich immer Angst, dass der Topf explodiert, weil ich mich mit Schnellkochtöpfen nicht auskenne. Deshalb kommt er in den Karton für die Dinge, die weggeworfen werden.
Der Karton mit Dingen, die weggeworfen werden, steht einige Tage im Kofferraum meines Autos, bis ich Zeit habe, die Dinge, die weggeworfen werden, wegzuwerfen, nur der Schnellkochtopf bleibt noch in dem Karton, denn ich will darüber nachdenken, ob ich ihn nicht besser zum Recyclinghof bringe, weil er aus so viel Metall besteht, denn er ist groß. Viele Male, wenn ich den Kofferraum öffne, sehe ich den silbernen Topf mit dem Deckel aus rotlackiertem Metall da im Dunkel stehen, sehe die Pfeife am Deckel, die immer gepfiffen hat, wenn der Weißkohleintopf fertig war (oder der Druck zu hoch?), ich hebe den roten Deckel an und schaue in den Topf meiner Kindheit hinein. Der Boden des Topfes ist leicht bräunlich gefärbt, meine Mutter hat ihn immer mit der Hand abgewaschen.
Irgendwann, als ich schon einige Wochen mit dem Schnellkochtopf im Kofferraum durch Berlin gefahren bin, kommt mir die Idee, den Topf zu begraben. Ganz in aller Stille, bei uns auf dem Grundstück, dort, wo mein Sohn schon Maulwürfe und Mäuse beerdigt hat. Wirklich in aller Stille, denn niemand soll wissen, dass ich eine bin, die einen Schnellkochtopf beisetzt. So leicht also hat sich im Kofferraum meines Autos der Karton mit Dingen, die weggeworfen werden, in einen Karton mit Dingen verwandelt, die aufs Land gebracht werden. Auf dem Land wird der Topf für immer als mein stiller Teilhaber unter der Erde bleiben, denke ich, während ich hinausfahre; ich überlege, ob ich ihn für die Ewigkeit mit Erde füllen soll, und wie tief ich wohl das Grab ausheben muss. Verwest Aluminium?
Als ich auf dem Land ankomme, liegt der erste Schnee, und die Erde ist hart. Das Begräbnis muss aufs Frühjahr verschoben werden. Das Rohr für das Gartenwasser ist eingefroren, da kommt mir der große Schnellkochtopf meiner Mutter gerade zupass, bis oben fülle ich ihn mit Schnee und setze ihn auf den Herd, um mit dem warmen Wasser das vereiste Rohr aufzutauen. Der Schnee schmilzt, aus ihm lösen sich auch ein paar braune Blätter vom Herbstlaub, das auf der Wiese lag, als es zu schneien begann. Je heißer der Schneesud wird, desto intensiver beginnen die Blätter zu kreisen und nach Moder zu riechen.
In einer kalten, winterfest gemachten, wasserlosen Küche eines kleinen Hauses, das nur im Sommer bewohnt werden kann, ist der Schnellkochtopf meiner Mutter noch einmal ein Topf: Ich koche – eine schwarze Suppe aus Laub.
Januar 2010
JOHN
Das Telefon klingelt. Wer ist da? Sag ich nicht. Ich spiel dir was vor. Michelle ma belle. Das Telefon klingelt. Wer ist da? Sag ich nicht, ich spiel dir was vor. Yesterday. Das Telefon klingelt. Wer ist da? Sag ich nicht. Aber ich spiel dir was vor. So geht das über Wochen. Woher kennen wir uns? Sag ich nicht. A hard days night. Ich leg auf, wenn du mir nicht deinen Namen sagst. Du kannst mich John nennen. Yellow submarine. Wie John Lennon. Aber wie heißt du wirklich? Sag ich nicht. Du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein. Der Brief in unserem Postkasten ist ohne Briefmarken. Woher kennen wir uns? Rate einmal. P. S. I love You. Wir sprechen über Musik. Wir sprechen über die kalte Welt der Erwachsenen. Wir sprechen über die Atomgefahr. Es kommt ein Brief, in dem sind die Buchstaben meines Namens aus unzähligen kleinen Worten »peace« gebildet. You really got a hold on me. Es kommt ein Brief mit einem Text von Wolfgang Borchert: Du Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins: Sag nein! Love, lo-o-ove, love. Ich gewöhne mich an die Anrufe von John Lennon, lege den Hörer mitsamt der eingespielten Musik auf dem Tisch ab, während ich Hausaufgaben mache. I want to hold your hand. Es kommt ein Brief, in dem sind alle Menschen aufgeführt, die an einem Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr den Neubau, in dem ich wohne, betreten oder verlassen haben. 1 Mann in einem hellen Mantel (nach draußen). 1 Frau mit Einkaufsnetz (herein). 2 Kinder (nach draußen). 1 alte Frau mit Hund (nach draußen), usw. Die Liste ist lang. Ich selbst bin nicht aufgeführt, und auch nicht meine Mutter. Ich war an diesem Nachmittag bei einer Freundin, meine Mutter ist weder hinaus- noch hineingegangen. Warum sitzt du da stundenlang? Warum hast du das gemacht? Love, l-o-o-ove, love. Weißt du überhaupt, wie ich aussehe? Do you want to know a secret. Kennen wir uns?
Zehn Jahre später bin ich längst erwachsen, ich habe einen Beruf gelernt und studiere, die Mauer ist inzwischen gefallen. Ich fordere meine Stasi-Akte an, die nicht sehr dick ist. Eines der wenigen Blätter enthält meine persönlichen Daten mit dem Vermerk: Pazifist. Ich wundere mich. Ich blättere um. Du Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins: Sag nein! Ich blättere um:
usw.
Ich blättere um. Und finde: 1 Mann in einem hellen Mantel (nach draußen). 1 Frau mit Einkaufsnetz (herein). 2 Kinder (nach draußen). 1 alte Frau mit Hund (nach draußen). Hier ist der in der Geschichte der Stasi wahrscheinlich einmalige Fall eingetreten, dass die Überwachungsbehörde einen Brief abgefangen hat, in dem ein Schüler aus Liebe zu einer Schülerin deren Haus überwacht hat. Ich muss an den Satz von Mielke denken: Aber ich liebe euch doch alle. Love, lo-o-ove, love. Aus der Stasiakte blickt mich meine Jugend an, die ich beinahe schon vergessen hatte. Eines Tages, als ich schon gar nicht mehr damit rechnete, hatte John sich schließlich doch zu erkennen gegeben. In Wahrheit hieß er Sebastian und war ein schmächtiger, blasser Junge, der sich in mich verliebt hatte, als ich beim Sommerfest im Ferienlager als Nixe auftrat.
Januar 2012
HEIMWEH NACH DEM TRAURIGSEIN
Was habe ich denn gemacht in der Nacht, als die Mauer fiel?
Ich habe den Abend mit Freundinnen verbracht, nur ein paar Straßenecken vom Weltgeschehen entfernt, und dann: habe ich geschlafen. Ich habe das Weltgeschehen tatsächlich verschlafen, und während ich schlief, war der Topf nicht umgerührt worden, sondern umgestoßen und in Scherben gegangen. Am Morgen erfuhr ich: Man braucht nun gar keine Töpfe mehr.
In der Gesellschaft, in die ich hineingeboren worden war, hatten die gründlichsten Kritiker der Regierung diese Regierung nur überholt im Hoffen. Das Hoffen hatte ich also gelernt, und die Vorläufigkeit und das Besserwissen und das Warten. Und nun aber? Nun wurden die, die es falsch gewusst hatten, nicht ersetzt, sondern ganz und gar abgeschafft. Und die es besser gewusst hätten, saßen plötzlich in einem leeren Theater. Von Freiheit war plötzlich viel die Rede, aber mit diesem Begriff Freiheit, frei schwebend in allen möglichen Sätzen, konnte ich wenig anfangen. Reisefreiheit? (Aber wird man die Reisen denn auch bezahlen können?) Oder Meinungsfreiheit? (Und wenn meine Meinung dann niemanden mehr interessiert?) Einkaufsfreiheit? (Und was kommt nach dem Einkauf?) Die Freiheit war ja nicht geschenkt, sie hatte einen Preis, und der Preis war mein gesamtes bisheriges Leben. Der Preis war, dass, was sich eben noch Gegenwart genannt hatte, nun Vergangenheit hieß. Unser Alltag war kein Alltag mehr, sondern ein überstandenes Abenteuer, unsere Sitten plötzlich eine Attraktion. Das Selbstverständliche hörte innerhalb weniger Wochen auf, das Selbstverständliche zu sein. Eine Tür, die sich nur alle hundert Jahre auftut, hatte sich aufgetan, aber nun waren auch die hundert Jahre für immer um. Meine Kindheit gehörte von nun an ins Museum.
Als ich kürzlich die Zeitung aufschlug, las ich einen Nachruf auf meine Grundschule.
Ja, tatsächlich, ehemalige Schüler hatten eine Traueranzeige für das Gebäude, in dem ich als Kind acht Jahre lang zur Schule gegangen war, in die Zeitung gesetzt. In stillem Gedenken trauern wir heute um den Abriss unserer Schule. Diese inzwischen erwachsenen Schüler aber hatten in der außergewöhnlich langen Anzeige nicht nur von ihrer Trauer gesprochen, sondern vor allem vom Alltag in und mit dieser Schule, die 1973/74 in dem Tal zwischen den Ostberliner Hochhäusern der Leipziger Straße und dem Westberliner Springer-Hochhaus gebaut worden war – ein Standard-Neubauklotz, der nach der Wende noch etwa zehn Jahre als Gymnasium diente, dann verlassen wurde, dann weitere zehn Jahre leerstand und allmählich von Bäumen, Büschen, Unkraut überwuchert wurde. Ein schweigender Ort, mit dem Sportplatz zusammengenommen vielleicht einen Quadratkilometer groß, gleich um die Ecke vom Trubel des Checkpoint Charlie, der Weltattraktion für alle, die wissen wollen, wie sich die Mauer angefühlt hat. Und nur eine Viertelstunde Fußweg vom Potsdamer Platz entfernt, mit seinen gläsernen Palästen.
Wo gäbe es das sonst noch in einer der Hauptstädte der westlichen Welt, dass mitten im Zentrum eine Brache einfach so daliegt, ein totes Stück Land, ein gestorbenes Stück Alltag einer anderen Zeit? Den Ground Zero in New York verwandelte man, sobald der Schutt fortgeräumt war, sofort wieder in eine Baustelle, und am Rand dieser Baustelle entstand sofort ein Museum zum Gedenken an die bei dem Anschlag aufs World Trade Center ums Leben Gekommenen. Aber in unserer Schule war ja niemand gestorben. Es hatte, gottseidank, keinen Krieg gegeben und kein Attentat. An unserer Schule ließ sich, nachdem sie von den Behörden aufgegeben worden war, nichts weiter ablesen als das Warten der neuen Gesellschaft auf ein Grundstück in bester Lage.
Als ich jetzt hingehe, um den Trümmerhaufen zu besichtigen, steht vom hinteren Treppenhaus gerade noch ein kleiner Rest. Das war das Treppenhaus, das zu meiner Zeit zu den naturwissenschaftlichen Fachräumen geführt hat. In den Hofpausen standen in der Nische zwischen dessen Außenseite und dem eigentlichen Schulgebäude die Jungen aus meiner Klasse in engem Kreis beieinander und wandten allen anderen den Rücken zu, um heimlich zu rauchen. Als dann einer von ihnen mein Freund wurde, war ich das erste Mädchen, das in den Hofpausen auch dort stehen und allen anderen den Rücken zuwenden durfte.
Was passiert eigentlich, wenn eine Wand zusammenstürzt, wenn die Zimmerdecke auf den Fußboden stürzt, mit der Krümmung der Raumzeit?
Das Verschwinden von Orten hat immer zwei Phasen, das wird mir erst jetzt klar, als ich neben dem großen Trümmerhaufen den schlaffen Berg roter Gummimatten sehe, mit denen der Sportplatz belegt war. Die erste Phase: die Entleerung, das Überwuchertwerden, Zusammenstürzen, aber Noch-da-Sein – und dann zweitens: das Weggewischtwerden und die Neubesetzung. Erst nach dem Wegwischen, dem Abräumen, dem Entsorgen kann etwas anderes an die Stelle treten, wo schon einmal etwas war.
Die verwahrloste Fermatenpause im Bezirk Mitte war immerhin noch eine Art Platzhalter für meine Erinnerung an diese Schule gewesen, die, wie es Schulen so an sich haben, durchaus nicht immer ein glücklicher Ort war. Eine Wildnis mitten im aufstrebenden Bezirk Berlin-Mitte, war dieser eine Quadratkilometer auch so etwas wie eine alte Zeit, die der neuen noch im Hals steckt, bevor sie endlich ausgespuckt werden kann.
Erst mit dem Glätten und Säubern der Oberfläche treten der verschwundene Ort und die mit ihm verschwundene Zeit nun ihren letzten Weg an, den Weg ins rein Geistige, wenn man so will, existieren von da an nirgendwo mehr sonst als in zum Beispiel meinen Gehirnwindungen und den Gehirnwindungen einiger anderer, finden in irgendeinem Gedächtnis ihre je andere letzte Zuflucht.
Der Platz vor dem Haupteingang der Schule war genau so groß, dass alle Schüler sich beim Fahnenappell dort im Karree aufstellen konnten. Dort stellten wir uns aber auch auf, wenn von der Schulleitung übungshalber der Feueralarm ausgelöst worden war. Und ab April oder Mai vollführten wir ebendort nach einer strengen, selbstauferlegten Ordnung Sprünge über zusammengeknotete und zwischen zwei Mädchenbeinpaaren aufgespannte Gummibänder, Schlüppergummmi nahm man dafür, und Gummihopse hieß das Spiel bei uns, heutzutage sagt man wohl Gummitwist dazu. Erste Höhe die Knöchel, zweite Höhe die Kniekehlen, dritte Höhe die Hüften, und einfacher waren die Sprünge, bei denen man mit den Füßen verschiedene Bewegungen ausführte, als die, bei denen man mit beiden geschlossenen Füßen über eines der Bänder springen musste. Auf der Treppe, die von diesem Spiel-, Fahnenappell- und Feueralarmplatz zum Haupteingang hinaufführte, wurden auch die jährlichen Klassenfotos gemacht, stufenweise die Größeren hinter den Kleineren aufgestellt wie in einem Chor.
Ein Platz, der genau so groß ist, dass alle Schüler Platz haben, um sich beim Fahnenappell dort im Karree aufzustellen (Wo ist der blaue Faltenrock? Wo mein Käppi? Wieso hält das nicht? Komm her, ich steck es dir mit der Haarklemma fest! Nicht, das tut weh!), so ein Platz ist mit Platten belegt, und wenn so ein Platz mit Platten belegt ist, kann man auf ihm auch sehr gut über ein Gummiband springen, das zwischen zwei Mädchenbeinpaaren aufgespannt ist. Ein Fahnenappell kann Alltag sein, genauso wie ein Spiel, das Mädchen spielen, wenn das Wetter endlich so warm ist, dass man Kniestrümpfe anziehen kann.
Dort, wo dieser Platz war, stehen jetzt keine Schüler mehr, und das Wort Fahnenappell ist eine Vokabel, die ausgedient hat, ein Trümmerwort. Dort, wo nichts war, damit man sich ordnungsgemäß versammeln konnte, sind nun die Betonstücke des Gebäudes übereinander hergefallen. Der Berg aus Betonstücken betrifft mich, denn an einem von ihnen, sehe ich, kleben noch die kleinen blauen Fliesen aus der Mädchentoilette. Habe ich diese Toilette gemocht? Kann man eine Schülertoilette überhaupt mögen? Freue ich mich denn nicht auf die Zukunft? Auf die lichtdurchfluteten Wohnungen oder Büroräume, die sich bald anstelle dieser ehemaligen sozialistischen Schülertoilette erheben werden? Auf Granit, Edelstahl, Eichenholz – anstelle der Klassenzimmerwände mit Wandzeitungen, die Überschriften trugen wie: Aus dem Funken schlug die Flamme!, und auf leise schließende Fahrstühle anstelle der vielen Luft, in der die Schüler auf die Aufforderung: Für Frieden und Sozialismus – seid bereit! mit einem zackigen oder müden: Immer bereit! geantwortet haben?
Nein, es geht merkwürdigerweise gar nicht darum, ob das, was jetzt ersetzt wird, erfreulich oder unerfreulich war, gut oder böse, ehrlich oder unehrlich. Es war einfach Zeit, die tatsächlich auf diese, mir bekannte Weise vergangen ist und in diesen Räumen aufgehoben war. Es geht um Zeit, die einmal eine Gegenwart war, und zwar eine allgemeine Gegenwart, die meine persönliche Gegenwart mit einschloss. Zeit, zu der ein bestimmter Begriff von Zukunft gehörte, der mir vertraut war, wenn diese Zukunft selbst auch noch in weiter Ferne liegen mochte. Die Zukunft war früher auch besser, ist ein schöner Satz von Karl Valentin. Was aus der lichten Zukunft geworden ist, auf die wir in dieser Schule vorbereitet werden sollten, weiß ich inzwischen. Die Mühen der Ebene. Die Ebene war zu weit gewesen. Aber jetzt? Jetzt gibt es wieder eine Zukunft. Oder fallen Gegenwart und Zukunft jetzt für immer in eins? Und wird vielleicht mit den Ruinen, die nun ein für allemal abgeräumt werden, auch die Vergangenheit ein für allemal abgeschafft? Kommen wir nun für immer in einer Zeit an, die für alle Zeit Gültigkeit haben soll?
Jetzt, wo der Keller, in dem an manchen Tagen eine Impfstelle eingerichtet war, und der Essensaal, in dem es noch solche Gerichte wie Blutwurst mit Sauerkraut gab, und die Aula, in der unsere Bilder aus dem Kunstunterricht aufgehängt waren, in Trümmern liegen, sehe ich, dass in Entsprechung zu den zwei Phasen des Verschwindens, von denen vorhin die Rede war, auch meine Trauer zwei Phasen hat: Mit dem allmählichen Verfall dieses Ortes habe ich zuerst nur konkret um Impfstelle, Essensaal oder Aula getrauert, natürlich nicht um die Räume als solche, aber um diese Räume als nach und nach verrottendes Bühnenbild meines Kinderalltags – als könnte auch so ein Alltag, der längst vorbei ist, noch im nachhinein alt und schwach werden.
Mit dem Wegwischen der Trümmer aber beginnt bei mir eine grundsätzlichere Art von Trauer, die über meine eigene Biographie hinausreicht: Die Trauer über das Verschwinden einer solchen sichtbaren Verwundung eines Ortes, über das Verschwinden kranker oder gestörter Dinge und Räume, die Zeugnis davon ablegen, dass eine Gegenwart nicht mit allem fertig wird, wie es so passend heißt. In dieser zweiten Phase, der Phase der Säuberung, trauere ich um das Verschwinden des Unfertigen oder Kaputten an sich, dessen, was sich bis dahin sichtbar einer Eingemeindung verweigert hat, um das Verschwinden des Drecks, wenn man so will. Wo Gras einfach so wächst, wo sich Unrat ansammelt, tritt eine Relativierung menschlicher Ordnung ein. Und das ist angesichts der Tatsache, dass wir selbst allesamt sterblich sind, nie schlecht fürs Nachdenken.
Wo die sozialistischen Architekten die bösen Geister aussperren wollten, fehlte gottlob der Beton oder er riss wenigstens. Es war auch nicht alles auf einmal zu schaffen. Ersatzteile waren ein Problem. Und außerdem: Wem gehört überhaupt Volkseigentum?