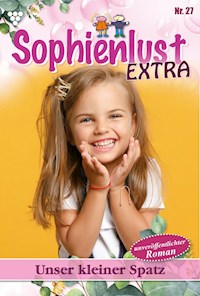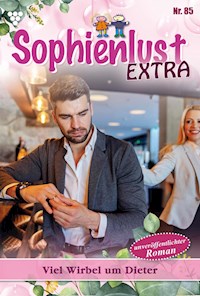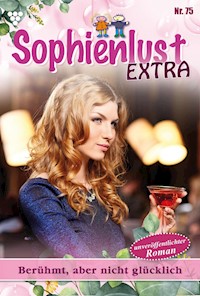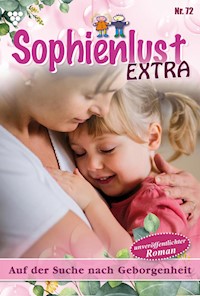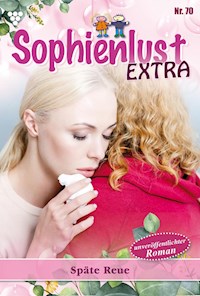Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust Extra
- Sprache: Deutsch
In diesen warmherzigen Romanen der beliebten, erfolgreichen Sophienlust-Serie ist Denise überall im Einsatz. Denise hat inzwischen aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle geformt, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Doch auf Denise ist Verlass. In der Reihe Sophienlust Extra werden die schönsten Romane dieser wundervollen Erfolgsserie veröffentlicht. Warmherzig, zu Tränen rührend erzählt von der großen Schriftstellerin Patricia Vandenberg. Im Kinderhort des Kaufhauses Loser in Sigmaringen war an diesem Tag wieder einmal Hochbetrieb. Um die Nachmittagszeit kauften viele Mütter ein und vertrauten ihre Kinder dann stets Schwester Marina an. Die fünfundzwanzigjährige Kinderschwester wusste längst, dass so manches Kind nur deshalb mitkam, weil es im Hort »abgegeben« wurde. Hier fand sich immer eine fröhliche Schar zusammen. Es wurde gemalt, gebastelt und manchmal auch so übermütig gespielt, als sei man im Freien. Auch jetzt ging es so laut zu, dass Schwester Marina eingreifen musste. Das tat sie sehr entschieden, obwohl sie diesen Übermut nur ungern bremste. Ihrer Meinung nach gehörte er zu gesunden Kindern, aber sie wollte sich von dem jungen Geschäftsführer des Kaufhauses nicht wieder vorwerfen lassen, dass sie die Zügel zu locker lasse. Jetzt kam ein kleines Mädchen herein und sagte: »Schwester Marina, draußen steht ein Mann.« Aha, dachte die Kinderschwester, Rolf Bittner hat sich schon auf die Lauer gelegt, um mir wieder eins auswischen zu können. Rolf Bittner war der Geschäftsführer, mit dem Marina in letzter Zeit immer wieder Zusammenstöße hatte. Sie wusste auch, warum er sie schikanierte. Sie hatte es nämlich abgelehnt, auf die von ihm geplanten Schäferstündchen einzugehen. Wahrscheinlich bekam er nicht oft eine Absage. Er war ein gut aussehender Mann, der es verstand, den Mädchen den Kopf zu verdrehen. Schwester Marina zog ihre weiße Schürze über dem blauweiß gestreiften Schwesternkleid zurecht, steckte ein paar vorwitzige Locken unter das Häubchen und ging zur Tür. Ihr hübsches Gesicht sah sehr entschlossen aus. Diesmal wollte sie dem Geschäftsführer sagen, dass sie es leid war, dass er sich immer wieder vor der Tür des Kinderhorts postierte. Schließlich hatte man ihr versprochen, dass sie hier selbstständig arbeiten dürfe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust Extra – 109 –Jerry hat keine Familie
Unveröffentlichter Roman
Gert Rothberg
Im Kinderhort des Kaufhauses Loser in Sigmaringen war an diesem Tag wieder einmal Hochbetrieb. Um die Nachmittagszeit kauften viele Mütter ein und vertrauten ihre Kinder dann stets Schwester Marina an.
Die fünfundzwanzigjährige Kinderschwester wusste längst, dass so manches Kind nur deshalb mitkam, weil es im Hort »abgegeben« wurde. Hier fand sich immer eine fröhliche Schar zusammen.
Es wurde gemalt, gebastelt und manchmal auch so übermütig gespielt, als sei man im Freien.
Auch jetzt ging es so laut zu, dass Schwester Marina eingreifen musste.
Das tat sie sehr entschieden, obwohl sie diesen Übermut nur ungern bremste. Ihrer Meinung nach gehörte er zu gesunden Kindern, aber sie wollte sich von dem jungen Geschäftsführer des Kaufhauses nicht wieder vorwerfen lassen, dass sie die Zügel zu locker lasse.
Jetzt kam ein kleines Mädchen herein und sagte: »Schwester Marina, draußen steht ein Mann.«
Aha, dachte die Kinderschwester, Rolf Bittner hat sich schon auf die Lauer gelegt, um mir wieder eins auswischen zu können.
Rolf Bittner war der Geschäftsführer, mit dem Marina in letzter Zeit immer wieder Zusammenstöße hatte. Sie wusste auch, warum er sie schikanierte. Sie hatte es nämlich abgelehnt, auf die von ihm geplanten Schäferstündchen einzugehen.
Wahrscheinlich bekam er nicht oft eine Absage. Er war ein gut aussehender Mann, der es verstand, den Mädchen den Kopf zu verdrehen.
Schwester Marina zog ihre weiße Schürze über dem blauweiß gestreiften Schwesternkleid zurecht, steckte ein paar vorwitzige Locken unter das Häubchen und ging zur Tür. Ihr hübsches Gesicht sah sehr entschlossen aus. Diesmal wollte sie dem Geschäftsführer sagen, dass sie es leid war, dass er sich immer wieder vor der Tür des Kinderhorts postierte. Schließlich hatte man ihr versprochen, dass sie hier selbstständig arbeiten dürfe.
Schwester Marina hatte sich umsonst auf den Zusammenstoß mit Rolf Bittner vorbereitet.
Vor der Tür stand ein Mann, den sie nicht kannte. Er hatte einen kleinen Jungen an der Hand. Es war ein allerliebstes Kerlchen mit dunkelblondem Haar und großen braunen Augen in einem runden Gesicht.
»Wollen Sie den Jungen in den Hort bringen?«, fragte Schwester Marina den mittelgroßen schlanken Mann, der aussah wie ein Dreißigjähriger.
»Nein«, antwortete er. Doch das klang unsicher.
Schon verbesserte er sich. »Ich wollte schon, aber es ist so laut da drin, und Jerry ist nicht gewöhnt, bei Kindern zu sein.« Auf einmal sprach er schneller. »Aber ich müsste dringend ein paar Einkäufe machen.«
Die Blicke des Mannes ließen Schwester Marina nicht los, doch sie spürte das Fragen und Forschen in seinen Augen nicht, weil sie sich jetzt zu dem kleinen Jungen hinabbeugte. »Jerry heißt du?«, fragte sie. »Das hört sich ja an, als wärst du ein kleiner Engländer.«
»Nein, das ist er nicht«, sagte der Mann rasch. »Ich werde ihn doch bei Ihnen lassen. Sind Sie Schwester Marina Becker?«
Schwester Marina richtete sich auf. Sie war sehr erstaunt. »Wieso kennen Sie meinen Namen so genau?«
Das schmale Gesicht des Mannes wurde unruhig. Er versuchte zu lächeln, aber das gelang ihm nicht recht. »Die Leute, bei denen ich in Sigmaringen wohne, haben mir Ihren Namen genannt. Sie haben gesagt, dieser Schwester können Sie den Jungen getrost anvertrauen, sie kommt mit allen Kindern zurecht.«
Jerry hatte Schwester Marinas Hand ergriffen. Er sah jetzt gar nicht ängstlich aus.
Die Kinderschwester öffnete die Tür. »Bitte, kommen Sie mit. Ich muss Ihren Namen und Ihre Adresse notieren.«
»Wozu?«, fragte der Mann. Er war schon auf dem Sprung wegzugehen.
»Das ist Vorschrift. Ich darf den Jungen sonst nicht hier behalten.« Wieder sah die Schwester den Mann erstaunt an. Seine Art beunruhigte sie.
Aber jetzt folgte er ihr zu dem Schreibtisch in dem Kinderhort und sagte plötzlich sehr willig: »Ich heiße Bernd Zimmermann und wohne in der Bodenseestraße siebenundzwanzig in Sigmaringen.«
Ein größeres Kind zupfte Schwester Marina am Ärmel. »Die Kleinen machen immerzu Streit«, beschwerte es sich.
Die Kinderschwester wandte sich dem kleinen Mädchen zu.
»Onkel!«, rief da der kleine Jerry plötzlich. Sein Gesicht verzog sich dabei zum Weinen.
Der Platz, auf dem eben noch Bernd Zimmermann gestanden hatte, war leer. Die Tür schloss sich gerade hinter ihm.
Ein komischer Kauz, dachte Schwester Marina. Sie stand vom Schreibtisch auf und führte Jerry zu den Kindern, die auf einer Tafel mit bunter Kreide malten. »Ob du das auch kannst, Jerry?«, fragte sie und drückte dem Jungen ein Stück Kreide in die Hand.
Zaghaft fasste der Kleine danach.
Er könnte drei Jahre alt sein, dachte Schwester Marina. Ich habe den Vater nicht einmal danach gefragt. Nein, nicht den Vater. Der Junge hat eben Onkel zu dem Mann gesagt.
Schwester Marina blieb unruhig, obwohl Jerry so eifrig zu malen begann, dass sie daran ihre Freude hätte haben können. Jedenfalls sah der Junge keineswegs ängstlich aus, wie dieser Bernd Zimmermann behauptet hatte. Im Gegenteil, Jerry schien sich bei den Kindern sehr wohlzufühlen.
Das zeigte sich immer deutlicher, je mehr Zeit verging. Die meisten Kinder wurden schon abgeholt. Bernd Zimmermann kam jedoch nicht. Schließlich war Schwester Marina mit Jerry allein. Sie nahm ihn an die Hand, um mit ihm ins Büro zu gehen und Bernd Zimmermann ausrufen zu lassen.
Als Schwester Marina auf einen Flur kam, von dem aus sie in die Verkaufsräume sehen konnte, erschrak sie. Die Waren an den Ständen waren schon abgedeckt. Nur an den Kassen standen noch Verkäuferinnen.
Schwester Marina sah auf die Uhr. Erst jetzt merkte sie, dass es bereits eine Viertelstunde nach Ladenschluss war. Und Bernd Zimmermann hatte den kleinen Jerry nicht abgeholt.
Als sie mit dem Jungen ins Büro kam und erzählte, was passiert war, sagte der Geschäftsführer: »Und so etwas kann Ihnen passieren, Schwester Marina? Sie tun doch immer, als ob Sie vollkommen selbstständig arbeiten könnten. So scheint es aber nicht zu sein, was soll jetzt mit dem Jungen geschehen? Wir werden die Polizei verständigen müssen.«
»Dagegen habe ich nichts. Was sollte ich zu fürchten haben?«, fragte Schwester Marina. Sie wappnete sich wieder einmal gegen die ironische und angriffslustige Art Rolf Bittners, aber sie konnte ihre Unruhe kaum verbergen. Jetzt wusste sie noch besser, wie merkwürdig ihr das Benehmen dieses Bernd Zimmermann vorgekommen war. Aber hätte sie ahnen können, dass er den kleinen Jerry nicht mehr abholen würde?
Rolf Bittner ging ans Telefon. Er sah ganz danach aus, als freue er sich über diesen Hereinfall von Schwester Marina.
Wenig später kamen zwei Polizisten.
Jerry drückte sich an Schwester Marina. So klein er auch war, er hatte inzwischen doch gemerkt, dass er im Mittelpunkt großer Aufregung stand. Auf alle Fragen schwieg er. Dabei sah er weniger trotzig als hilflos aus.
Schwester Marinas ganzes Mitgefühl galt dem Jungen.
Sie spürte, dass etwas passiert war, was ihr noch lange zu schaffen machen würde.
Die Polizisten nahmen sie mit dem Jungen mit auf das Revier. Dort musste sie warten, bis ein Polizeiwagen aus der Bodenseestraße siebenundzwanzig zurückkam.
Als es so weit war, hörte Schwester Marina etwas, was sie eigentlich schon erwartet hatte. In dem Haus Nummer siebenundzwanzig kannte man keinen Bernd Zimmermann, und niemand konnte sich an den kleinen Jerry erinnern.
»Der Junge ist also ausgesetzt worden«, sagte ein Wachtmeister. »Wieder einmal etwas Neues, ein Kind im Hort eines Kaufhauses zurückzulassen. Wenn aus dem Jungen wenigstens etwas herauszukriegen wäre! Schaffen Sie das wirklich nicht, Schwester Marina? Sie verstehen es doch besser, mit Kindern umzugehen als wir Männer.«
Schwester Marina strich dem Jungen über das Haar und drückte ihn an sich. »Es hat keinen Sinn, länger auf ihn einzureden«, sagte sie leise. »Darf ich ihn mit in meine Wohnung nehmen? Vielleicht kann ich ihn dort dazu bewegen, mir etwas zu verraten. Aber ich fürchte, viel wird es nicht sein, womit er uns weiterhelfen kann. Meiner Meinung nach ist er höchstens drei Jahre alt.«
Die Polizisten waren erleichtert über den Vorschlag der Kinderschwester. Sie brachten sie mit dem Jungen zu ihrer kleinen Wohnung. Die Fahndung nach Bernd Zimmermann sollte sofort einsetzen.
Das Erste, was der kleine Jerry in der Wohnung sprach, war die Frage: »Bleibe ich jetzt bei dir, Tante?«
»Ja, vorläufig bleibst du bei mir, Jerry.« Marina zog den Jungen auf ihren Schoß. »Hast du Hunger?«, fragte sie.
Der Junge nickte. Bereitwillig ging er mit ihr in die Kochnische. Dort sah er sich neugierig um. Seitdem er mit Marina allein war, benahm er sich wieder zutraulicher. Als sie ihm ein Brot mit Schinken belegte, griff er gleich danach und biss herzhaft hinein. Dabei sah er auf den Kühlschrank und sagte: »Tante Meta hat auch so einen Schrank mit Wurst und Käse.«
»Tante Meta?«, fragte Marina vorsichtig. »Die kenne ich nicht. Du musst mir schon sagen, wer das ist. Wo wohnt sie denn?« Sie nahm den Jungen mit ins Wohnzimmer. Dort setzte sie ihn auf einen Stuhl.
»In einer großen Stadt«, sagte Jerry.
»Und wie heißt die Stadt, Jerry?«
»Das weiß ich nicht.«
Marina zählte viele Städte auf, aber jedes Mal schüttelte der Junge den Kopf, bis sie es schließlich aufgab.
»Hast du in dieser Stadt auch mit deinem Onkel Bernd gewohnt, Jerry?«
»Er heißt nur Onkel.«
Jerry griff nach dem Glas Milch, das Marina für ihn auf den Tisch gestellt hatte.
Der Junge kennt also den Namen Bernd nicht einmal, folgerte Marina. Wieder fragte sie, ob Jerry auch bei diesem Onkel gewohnt habe.
»Nein, nur bei Tante Meta. Aber dann bin ich mit dem Onkel ganz weit mit dem Auto gefahren, weil Tante Meta ins Krankenhaus musste.«
»Wohin wollte dein Onkel denn mit dir, Jerry?«
Der Junge zuckte die Schultern.
Auf einmal standen Tränen in seinen Augen und kullerten über seine Wangen. »Vielleicht zu einer neuen Tante«, sagte er stockend. Dann sah er Marina fragend an. »Zu dir, Tante?«
Marina hatte das Gefühl, den Jungen mit den vielen Fragen zu quälen. Seine hilflosen Blicke erschütterten sie. Zärtlich streichelte sie ihn. »Weine doch nicht, Jerry«, bat sie.
»Kann ich bei dir schlafen, Tante?«, fragte Jerry und sah sich im Wohnzimmer um.
»Ja. Schau, hier auf der Couch mache ich dir ein ganz schönes Bett.«
»Schläfst du bei mir, Tante?«
»Nein, ich habe dort drin ein Bett.« Marina zeigte auf die Tür zu ihrem kleinen Schlafzimmer.
»Ich will aber bei dir schlafen, Tante.« Jerry rutschte von seinem Stuhl und drückte sich an Marina. »Ich habe doch Angst, wenn ich allein bin.«
»Gut, dann schläfst du bei mir, Jerry«, versprach sie ihm. »Du siehst sehr müde aus. Am besten, ich bringe dich gleich zu Bett.«
»Ich habe aber keinen Schlafanzug, Tante. Der ist im Auto. In einem Koffer. Dort hat Tante Meta alles für mich eingepackt. Auch meinen Teddy.« Auf einmal wurde Jerry lebhaft. »Tante, ich habe einen so lieben Teddy. Er heißt Wummi.«
»Wie heißt er?«, fragte Marina sehr verwundert und beinah etwas erschrocken.
»Wummi. Gefällt dir der Name nicht, Tante?« Jerry sah Marina enttäuscht an.
»Doch, das ist ein schöner Name für einen Teddy.« Jetzt lächelte Marina und dachte: Man kann eben auf dieser Welt nichts Einmaliges haben.
Selbst auf den Namen Wummi kommen auch andere Kinder, nicht nur meine Schwester und ich. Ja, Wilma und sie hatten einen Teddybären mit dem Namen Wummi gehabt.
»Tante, wird mir der Onkel meinen Wummi bringen?«, fragte Jerry jetzt. »Ich will ihn doch wiederhaben.«
»Sicher bekommst du deinen Wummi wieder«, tröstete Marina den Jungen. Dabei hatte sie ein schlechtes Gewissen. Sie konnte nicht mehr daran glauben, dass sich dieser Bernd Zimmermann noch einmal um den kleinen Jungen kümmern würde. Jetzt war es Abend. Er hätte also genug Zeit gehabt, sich bei der Polizei nach Jerry zu erkundigen.
»Aber ich brauche meinen Wummi doch zum Einschlafen, Tante«, klagte Jerry.
»Noch nötiger als deinen Schlafanzug? Heute wirst du auf beides einmal verzichten müssen, Jerry, aber das ist doch nicht so schlimm. Komm, ich bringe dich zu Bett und bleibe bei dir sitzen, bis du eingeschlafen bist.«
»Wirst du dann wirklich bei mir schlafen, Tante?« Jerry griff nach Marinas Hand, als sie ihn in das Schlafzimmer führte.
»Ja, ganz gewiss«, versprach sie und stellte den Jungen auf einen Stuhl. Dort zog sie ihm die kurze schwarze Samthose und das Rüschenhemd aus. Diese Kleidung sah aus, als habe man den Jungen eigens für die Reise herausgeputzt.
Damit war den marternden Gedanken, wo diese Reise hatte enden sollen, wieder freie Fahrt gegeben.
Als Marina dann bei Jerry sitzen blieb, erlebte sie noch einmal das kurze Gespräch mit Bernd Zimmermann. Dabei beschäftigte sie am meisten die Tatsache, dass er ihren vollen Namen gekannt hatte. Doch das Rätsel um diesen Mann und den kleinen Jerry kam ihr unlösbar vor.
*
Am nächsten Morgen wurde das Rätsel etwas durchsichtiger. Als Marina die Tür öffnete, um mit Jerry in das Kaufhaus zu gehen, fiel ein Päckchen auf den Boden. Es musste an der Türklinke befestigt gewesen sein.
Marina ging noch einmal zurück in die Wohnung und öffnete die Verschnürung des Päckchens. Als sie das Papier auseinanderfaltete, schrie Jerry: »Mein Wummi!« Schon griff er nach dem Teddybären und drückte ihn fest an sich. Es war ein hellbrauner zotteliger Bär mit dunkler Schnauze und schwarzen Augen.
Marina konnte dem Jungen jetzt keine Beachtung schenken, sie griff mit vor Aufregung zitternder Hand nach einem weißen Zettel und las, was darauf stand.
Liebe Schwester Marina, bitte, verzeihen Sie mir, dass Sie den Eindruck haben müssen, ich hätte Sie übertölpelt. Ich wusste mir mit Jerry keinen anderen Rat, als ihn zu Ihnen zu bringen. Sie werden ihn lieb gewinnen, weil Sie ein guter und selbstloser Mensch sind. Vielleicht findet er durch Sie noch einmal eine Heimat. Ich kann sie ihm nicht geben, so gern ich das täte. Jerrys Mutter kann sich nicht um ihren Jungen kümmern. Bitte, nehmen Sie ihn an Ihr Herz. Er wird es Ihnen danken. Auch ich danke Ihnen.
Bernd Zimmermann.
Marina war jetzt nicht imstande, die Wohnung zu verlassen. Sie sank auf einen Stuhl.
»Gehen wir nicht zu den anderen Kindern, Tante?«, fragte Jerry. Er hielt seinen Teddy noch immer fest im Arm.
»Wir gehen gleich, Jerry.« Marinas Gesicht war blass. Ihre Blicke hingen noch immer auf dem Zettel in ihrer Hand.
Nun gab es keinen Zweifel mehr daran, dass Jerry ausgesetzt worden war. Auch nicht daran, dass dieser Bernd Zimmermann sie dazu ausersehen hatte, sich Jerrys anzunehmen.
»Wieso gerade mich?«, fragte Marina laut. Welches Geheimnis war um diesen Jungen, und woher kannte Bernd Zimmermann sie? Sie hatte ihn bestimmt noch nie gesehen.
Etwas schwerfällig stand Marina auf. Sie strich sich über die Stirn. In ihren blauen Augen stand auf einmal Abwehr. Musste sie sich immer in alles fügen?
Ganz plötzlich meldete sich bei Marina der Schmerz um den Mann, den sie verloren hatte, um Jürgen Bergius. Mit ihm war sie verlobt gewesen, aber nun war er der Mann ihrer Schwester Wilma. Sie hatte es verstanden, Jürgen für sich zu gewinnen. Immer war es so gewesen, dass ihre um vier Jahre jüngere Schwester Opfer von ihr verlangt hatte. Wilma konnte sich stets durchsetzen, wie egoistisch ihre Ziele auch sein mochten.
Ich bin aus Köln geflohen, um das junge Glück in meinem Elternhaus nicht miterleben zu müssen, dachte Marina. Nun wollte ich hier in Sigmaringen zur Ruhe kommen, aber jetzt verlangt man schon wieder etwas von mir, was ich mir nicht selbst ausgesucht habe. Ich soll ein fremdes Kind aufnehmen, von dem ich nicht mehr als den Vornamen kenne.
»Tante, was hast du?« Jerry zupfte Marina am Kleid und sah mit ängstlichen Augen zu ihr empor.
Als Marina in diese Kinderaugen sah, bereute sie ihr Aufbegehren. War Jerry nicht viel härter getroffen worden als sie? Ihn wollte niemand, sonst wäre er nicht ausgesetzt worden. Seine Mutter könne sich nicht um ihn kümmern, stand auf dem Zettel. Warum? War sie schwer krank, oder hieß das nur, dass sie ihn nicht wollte? So wie ihre eigene Mutter sie und die Schwester nicht gewollt hatte?
Auf einmal stand jene Zeit vor Marina wieder auf, da ihre Mutter die Familie wegen eines anderen Mannes verlassen hatte. Marina konnte sich noch gut daran erinnern. Damals war sie selbst gerade in die Schule eingetreten, und Wilma war erst zwei Jahre alt gewesen. Der Vater hatte sich von jenem Tag an sehr verändert. Aus dem gutmütigen Familienvater war ein vom Ehrgeiz besessener Mann geworden, der allen hatte beweisen wollen, dass zwar seine Ehe gescheitert war, aber dass er im Beruf Erfolg hatte. Aus dem bescheidenen Ingenieur war ein Fabrikant geworden, der heute in Köln eines der bedeutendsten Werke für landwirtschaftliche Maschinen besaß. Seine Gutmütigkeit versteckte er hinter einem polternden Wesen. Nur eines hatte er niemals fertig gebracht, seiner Tochter Wilma einen Wunsch abzuschlagen. Sie hatte es immer verstanden, den Vater um den Finger zu wickeln. Vielleicht hatte sie die Art der Mutter geerbt.
»Ja, wir gehen«, sagte Marina aus ihren Gedanken heraus. Welchen Sinn sollte es haben, jetzt an die Vergangenheit und das zu denken, worauf sie hatte verzichten müssen? Hier stand ein verlassenes Kind vor ihr, das sie ängstlich ansah, als wollte es fragen: Willst du mich auch nicht?