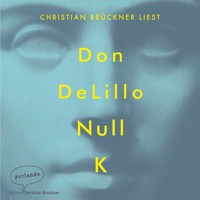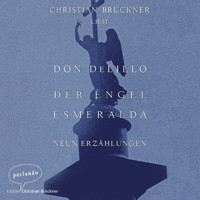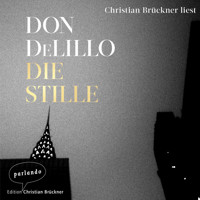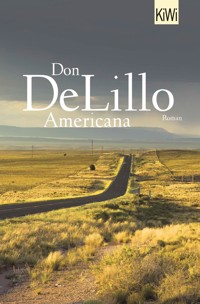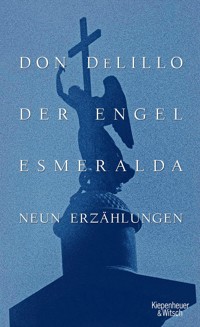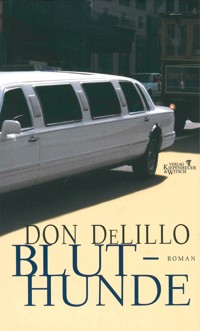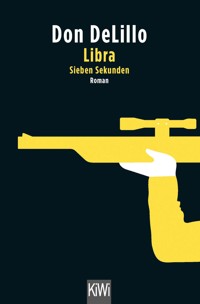12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach Unterwelt, dem großen politischen Roman, hat Don DeLillo in Körperzeit die intimsten und elementarsten zwischenmenschlichen Regungen genau beobachtet und unter die Haut gehend dargestellt. Ein neues Meisterwerk des großen amerikanischen Autors. Ein Mann und eine Frau, der Filmregisseur Rey und die Konzeptkünstlerin Lauren, sitzen sich beim Frühstück in einem Haus gegenüber. Jede alltägliche Bemerkung, jede kleine Bewegung wird registriert. Es ist der Terror eines normalen Tages, der Wahnsinn der Routine. An diese Routine, aber auch an die Nähe und die Entfremdung erinnert sich Lauren, nachdem ihr Mann sich umgebracht hat. Immer wieder hört sie ihre gemeinsamen, auf Band aufgenommenen Gespräche ab, die Protokolle dieser verstörenden Liebe. Ihre Einsamkeit teilt sie nun mit dem geheimnisvollen Mr. Tuttle, einem irren kleinen Mann, den sie schon vor Reys Tod durch das Haus hat geistern hören. Er wird zum Spiegel und zum Echo ihrer Gespräche und ihres Lebens mit Rey. it erbarmungsloser Selbstdisziplin entwickelt Lauren die Choreografie eines Stücks, in das ihre Erinnerungen und die Gespräche mit den beiden Männern, ihre tiefe Einsamkeit eingehen. Allein stellt sie auf der Bühne in Körperzeit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in verschiedenen stummen Rollen dar und wächst bei der Aufführung über ihre Erfahrungen hinaus. Körperzeit ist ein stilistisch prägnanter und intensiver Roman, der Don DeLillo von einer völlig neuen Seite zeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
TitelKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7BuchAutorÜbersetzerImpressumKAPITEL 1
Die Zeit scheint zu vergehen. Die Welt geschieht, entrollt sich zu Augenblicken, und du hältst inne, betrachtest eine Spinne in ihrem Netz. Das Licht ist hellwach, die Konturen der Dinge sind wie gestochen, und auf der Bucht liegen funkelnde Bänder. Du weißt besser, wer du bist, am kraftvoll strahlenden Tag nach dem Sturm, wenn noch das kleinste fallende Blatt von Selbstgewissheit durchbohrt ist. In den Kiefern tönt der Wind, die Welt beginnt zu sein, unwiderruflich, und die Spinne reitet auf ihrem windgewiegten Netz.
Es ergab sich an diesem letzten Morgen, dass sie gleichzeitig dort in der Küche waren, umeinander stolperten, wenn sie etwas aus Schränken und Schubladen holten, und dem anderen dann am Spülstein oder Kühlschrank den Vortritt ließen, immer noch ein bisschen traumzerschmolzen, und sie ließ Leitungswasser über eine Hand voll Blaubeeren laufen und sog mit geschlossenen Augen den aufsteigenden Duft ein.
Er saß hinter der Zeitung, im Kaffee rührend. In seinem Kaffee, in seiner Tasse. Die Zeitung teilten sie sich, aber eigentlich war es, unausgesprochen, ihre.
»Ich wollte dir was sagen, aber was.«
Sie ließ Leitungswasser laufen und schien es zu bemerken. Zum ersten Mal bemerkte sie es.
»Mit dem Haus. Das ist es«, sagte er. »Was ich dir sagen wollte.«
Sie bemerkte, wie das Wasser aus der Leitung nach ein paar Sekunden undurchsichtig wurde. Erst lief es silbrig und klar, und dann wurde es nach ein paar Sekunden undurchsichtig, wie seltsam, dass sie all diese Monate, all diese Male, wenn sie in der Küche Leitungswasser laufen ließ, nicht bemerkt hatte, dass das Wasser erst klar lief und dann, nun, nicht gerade trüb, aber doch undurchsichtig wurde, aber vielleicht war es vorher gar nicht so gewesen, oder sie hatte es bemerkt und wieder vergessen.
Sie ging hinüber an den Schrank, die nassen Blaubeeren in der Hand, griff hoch nach dem Müsli und nahm die Schachtel mit an den Küchentresen, die weitgehend braun-weiße Schachtel, und dann ploppte das Toasterding hoch, und sie drückte es wieder runter, weil man zweimal drücken musste, damit das Brot braun wurde, und er nickte geistesabwesend, weil es sein Toast war und seine Butter, und dann schaltete er das Radio ein, den Wetterbericht.
Die Spatzen waren am Futtertrichter, flügelschlagend, auf den kreisförmigen Sitzstangen rangelnd.
Sie holte eine Schale aus dem näher gelegenen Schrank, schüttete Müsli aus der Schachtel hinein und streute die Blaubeeren obendrauf. Sie rieb sich die Hand an den Jeans trocken und spürte irgendwo die Farbe Blau, zerlaufen und blass.
Wie heißt das, der Hebel. Sie hatte den Hebel runtergedrückt, damit sein Brot braun wurde.
Es war sein Toast, es war ihr Wetter. Sie hörte oft den Wetterbericht und rief den Wetterdienst an, und manchmal stand sie draußen vorm Haus und schaute in den Küstenhimmel, schmeckte die Brise nach verborgenen Andeutungen ab.
»Ja genau. Ich weiß, was es war«, sagte er.
Sie trat zum Kühlschrank und öffnete die Tür. Stand da, als ihr etwas einfiel.
Sie sagte: »Was?« Meinte: Was hast du gesagt?, nicht: Was wolltest du mir sagen?
Ihr waren die Sojakörner eingefallen. Sie ging zum Schrank und holte die Schachtel und erwischte die Kühlschranktür noch, bevor sie wieder zufiel. Sie griff hinein, nach der Milch, und dann erst kam an, was er vor ungefähr acht Sekunden gesagt hatte, was sie zuerst nicht gehört hatte.
Immer wenn sie sich bücken und in die tieferen, hinteren Teile des Kühlschranks greifen musste, stieß sie ein Ächzen aus, nein, nicht immer, das wie die Klage eines ganzen Lebens klang. Sie war zu fit und geschmeidig, um die Anstrengung zu spüren, war nur Reys Echo, fühlte sich ein, ächzte sein Ächzen, aber so nahtlos und tief, dass auch ihr Unbehagen darin lag.
Nun, da ihm eingefallen war, was er ihr hatte sagen wollen, schien er das Interesse daran zu verlieren. Sie brauchte sein Gesicht nicht zu sehen, sie wusste es auch so. Es lag in der Luft. Es lag in der Pause im Kielwasser seiner Bemerkung vor acht, zehn, zwölf Sekunden. Etwas Belangloses. Er würde es wie eine Selbstdegradierung auffassen, etwas derart Banales anzusprechen.
Sie ging an den Tresen und streute Soja über Müsli und Früchte. Der Hebel prallte oder prellte hoch. Er stand auf und holte sich seinen Toast, dann die Butter, und sie musste sich, ihre Milchtüte in der Hand, vom Tresen wegdrehen, damit er die Schublade aufziehen und ein Buttermesser nehmen konnte.
Im Radio ertönten Stimmen in … hörte sich wie Hindi an.
Sie goss Milch in die Schale. Er setzte sich hin und stand wieder auf. Er ging an den Kühlschrank, holte den Orangensaft und stand mitten im Raum, die Tüte schüttelnd, damit das Fruchtfleisch sich verteilte und der Saft dicker wurde. Er dachte immer erst an den Saft, wenn der Toast fertig war. Dann schüttelte er die Tüte. Dann goss er den Saft ein und betrachtete das Häubchen aus knisterndem Schaum oben im Glas.
Sie klaubte sich ein Haar aus dem Mundwinkel. Sie stand am Tresen und starrte es an, ein kurzes blasses Haar, das nicht von ihr stammte und nicht von ihm.
Er stand da und schüttelte den Saft. Er schüttelte länger als nötig, weil er nicht darauf achtete, dachte sie, und weil es irgendwie dumpf und harmlos befriedigend war, ein kindischer Selbstzweck, das Rumpeln und Plätschern und Papporangenaroma.
Er sagte: »Willst du welchen?«
Sie starrte das Haar an.
»Sag’s mir, ich bin nicht sicher. Trinkst du Saft?«, er schüttelte das verdammte Ding immer noch, zwei Finger um die Öffnung geklemmt.
Sie schabte mit den oberen Schneidezähnen über ihre Zunge, um die komplexe Sinneserinnerung vom Haar eines anderen Menschen loszuwerden.
Sie sagte: »Was? Nie getrunken, das Zeug. Weißt du doch. Wie lange leben wir jetzt zusammen?«
»Nicht lange«, sagte er.
Er nahm ein Glas, goss den Saft ein und betrachtete den aufsteigenden Schaum. Dann setzte er sich ächzend wieder hin.
»Nicht lange genug, um mir alle Einzelheiten zu merken«, sagte er.
»Ich denke immer, das darf doch hier nicht passieren. Irgendwo sonst, denke ich, aber nicht hier.«
»Was?«
»Ein Haar im Mund. Vom Kopf eines anderen.«
Er butterte seinen Toast.
»Denkst du, das passiert nur in großen Städten mit gemischter Bevölkerung?«
»Irgendwo sonst, aber nicht hier.« Sie hielt das Haar zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete es mit gespieltem Abscheu, oder mit echtem, den sie bis an die Grenze zum Theater getrieben hatte, den Mund lähmungsschief verzogen. »Das denke ich.«
»Vielleicht trägst du es schon seit deiner Kindheit mit dir herum.« Er kehrte zur Zeitung zurück. »Hattest du als Kind einen Hund?«
»Hey. Was hat dich denn aufgeweckt?« sagte sie.
Es war ihre Zeitung. Das Telefon war seins, außer wenn sie den Wetterdienst anrief. Den Computer benutzten sie beide, aber geistig war es ihrer.
Sie stand am Tresen und betrachtete das Haar. Dann schnippte sie es weg, auf den Boden. Sie wandte sich zur Spüle, ließ heißes Wasser über ihre Hand laufen und stellte die Müslischale auf den Tisch. Vögel flogen auf, als sie in die Nähe des Fensters kam.
»Ich habe dich schon literweise Saft trinken sehen, Wahnsinnsmengen, ich kann’s gar nicht sagen«, sagte er.
Ihr Mund war immer noch verzerrt von der Erfahrung, am unbekannten Leben irgendeines Essensverarbeiters teilzuhaben, oder von einer viel seltsameren, komplizierteren Tatsache, dem intimen Weg des Haares von Mensch zu Mensch und gewissermaßen von Mund zu Mund über Jahre und Städte und Krankheiten und unhygienisches Essen und viele Verderben bringende Körperflüssigkeiten.
»Was? Wohl kaum«, sagte sie.
Gut, sie stellte die Schale auf den Tisch. Sie ging zum Herd, nahm den Kessel und füllte ihn an der Spüle. Er suchte einen anderen Radiosender und sagte etwas, das sie nicht mitbekam. Sie stellte den Kessel wieder auf den Herd, denn so lebst du ein Leben, auch wenn du es nicht merkst, und dann schabte sie wieder mit den Zähnen über ihre Zunge, bewusst nachdrücklich, und betrachtete die blau aus dem Brenner schießende Flamme.
Sie hatte sich klappmesserartig vom Tresen abwenden müssen, als er das Buttermesser holen kam.
Sie ging zum Tisch, und die Vögel rauschten wieder vom Futtertrichter auf. Sie kamen aus dem Schatten unter der Dachrinne und flogen in Sonnengleißen und Stille hinein, ein flüchtiger Vorgang von stummer Schönheit, den sie nur teilweise sah, die Vögel waren von der Sonne erschlagen, vom Licht verschlungen, entkörperlicht, verwandelt: rein und jäh und splitterhell.
Sie setzte sich hin, blätterte die Teile der Zeitung durch und merkte, sie hatte keinen Löffel. Sie hatte keinen Löffel. Sie schaute Rey an und sah, dass seitlich auf seinem Kinn ein Pflaster prangte.
Sie benutzte den alten, verbeulten Kessel anstelle des neuen, den sie gerade gekauft hatte, weil – sie wusste nicht, warum. Es war ein altes Holzhaus mit vielen Zimmern und funktionierenden Kaminen und Tieren in den Wänden und Schimmel überall, ein Haus, das sie ungesehen gemietet hatten, ein Relikt aus der Blütezeit von Holzhandel und Schiffsbau, viel zu groß, und es gab knarrende Dielenbretter und diverse verbogene Küchenutensilien von anno dazumal.
Sie tat, sich selbst veräppelnd, als fiele sie fast vom Stuhl, und ging zum Tresen, um sich einen Löffel zu holen. Die Sojakörner nahm sie auch mit zum Tisch. Sie hatten einen Geruch, der nicht zu dem sandigen Zeug in der Schachtel zu gehören schien. Ein schwacher Weizenmief mit einem Hauch Füße dabei. Jedes Mal, wenn sie davon aß, roch sie es. Sie schnüffelte zwei oder drei Mal daran.
»Hast dich wieder geschnitten.«
»Was?« Er fuhr sich mit der Hand ans Kinn, sein Kopf hinter der Zeitung verschwunden. »Nur eine Schramme.«
Sie begann, eine Geschichte aus ihrem Teil der Zeitung zu lesen. Die Zeitung war alt, von letztem Sonntag, aus der Stadt, weil sie hierher nicht zugestellt wurde.
»Das ist in letzter Zeit, ich weiß nicht, vielleicht solltest du dich nicht als Erstes rasieren. Wach doch erst mal auf. Warum überhaupt? Lass dir deinen Schnurrbart wieder wachsen. Oder einen Vollbart.«
»Warum überhaupt? Es muss einen Grund geben«, sagte er. »Ich will, dass Gott mein Gesicht sieht.«
Er schaute von der Zeitung auf und lachte, leer, wie sie es nicht mochte. Sie aß etwas Müsli und schaute sich eine andere Geschichte an. In letzter Zeit neigte sie dazu, sich in bestimmte Zeitungsgeschichten hineinzuversetzen. Eine Art Tagtraum-Variation. Sie tat es und merkte dann, dass sie es tat, und tat es manchmal ein paar Minuten später von Neuem, mit derselben oder einer anderen Geschichte, und merkte es dann wieder.
Sie griff nach der Sojaschachtel, ohne von der Zeitung aufzuschauen, und streute ein paar Körner in die Schale, und im Radio lief Verkehr und Gerede.
Anscheinend ging es darum, dass sie erst mal den alten Kessel verschleißen musste, ihn noch und noch benutzen, bis sich Rostblasen darin bildeten, und dann, nur dann würde sie es in Ordnung finden, den neuen Kessel zu nehmen, den sie gerade gekauft hatte.
»Musst du Radio hören?«
»Nein«, sagte sie und las Zeitung. »Was?«
»Das ist eine so unglaubliche Scheiße.«
Wie er das scharfe S in Scheiße betonte und das Wort damit veredelte.
»Ich hab das Radio nicht eingeschaltet. Du hast das Radio eingeschaltet«, sagte sie.
Er ging zum Kühlschrank und kehrte mit einer großen, dunklen Feige zurück und schaltete das Radio ab.
»Gib mir was davon«, sagte sie Zeitung lesend.
»Das sollte kein Vorwurf sein. Wer hat eingeschaltet, wer hat abgeschaltet. Da ist aber jemand heikel heute Morgen. Dabei müsste eigentlich ich, wie soll ich sagen, auf Abwehr eingestellt sein. Nicht die junge Frau, die bis in alle Ewigkeit essen und schlafen und leben wird.«
»Was? Hey, Rey. Halt den Mund.«
Er biss den Stiel ab und warf ihn Richtung Spüle. Dann schlitzte er die Feige mit beiden Daumennägeln auf, nahm ihr den Löffel aus der Hand, leckte ihn ab und holte damit eine Portion weinrotes Fruchtfleisch aus der klaffenden Feigenschale. Er klatschte das Zeug auf seinen Toast – Frucht, Fleisch, Mansch – und verschmierte es mit der Unterseite des Löffels, blutbuttrige Schlieren, platzendvoll mit Samenleben.
»Eigentlich müsste ich morgens der Empfindliche sein. Der herumstöhnt. Das Grauen eines neuen Durchschnittstages«, sagte er durchtrieben, »das kennst du noch nicht.«
»Halt mal die Luft an, ja?«
Sie beugte sich vor, er streckte ihr das Brot hin. In den Bäumen am Haus saßen Krähen, rau kreischend. Sie biss ab und schloss die Augen, um über den Geschmack nachdenken zu können.
Er gab ihr den Löffel zurück. Dann schaltete er das Radio ein, erinnerte sich, dass er es gerade abgeschaltet hatte, und schaltete es wieder ab.
Sie streute Soja in die Schale. Der Geruch lag irgendwo zwischen Körpergeruch, jawohl, von den unteren Gliedmaßen, und einem authentischen Hülsenfruchtleben in der Erde, tief und saatig. Aber das traf es nicht. Sie las in der Zeitung einen Artikel über ein Kind, ausgesetzt in irgendeinem gottverlassenen. Nichts traf es. Purer Geruch. Das, was Geruch ausmacht, abgesehen von seinen Ursprüngen. Es war, als ob, und beinahe hätte sie etwas in dieser Richtung gesagt, weil es Rey hätte gefallen können, aber dann ließ sie es bleiben – es war, als ob ein Gelehrter, sagen wir: im Mittelalter, versucht hätte, alle bekannten Gerüche zu klassifizieren, und auf etwas gestoßen wäre, das nicht in sein System passte, und das hätte er Soja genannt, was durchaus ein Teil eines hochtrabenden lateinischen Begriffs sein konnte, oder nein, eigentlich nicht, und sie saß da und dachte an etwas, was genau, wusste sie nicht recht, Löffel knapp vorm Mund.
Er sagte: »Was?«
»Ich habe nichts gesagt.«
Sie stand auf, um etwas zu holen. Sie schaute den Kessel an und merkte, das war es nicht. Sie wusste, es würde ihr einfallen, denn das tat es immer, und dann fiel es ihr ein. Sie wollte Honig für ihren Tee, obwohl das Wasser noch gar nicht kochte. Sie hatte etwas Über-Vorbereitetes oder Überdrehtes oder Überreiztes, und Rey sagte immer, vielmehr, hatte einmal gesagt, und sie hatte eine Stimme im Kopf, die ihre eigene war, im Dialog oder Monolog, und sie trat an den Schrank, aus dem sie den Honig und die Teebeutel holte – eine Stimme, die aus einer Geschichte in der Zeitung drang.
»Wolltest du mir nicht etwas sagen?«
Er sagte: »Was?«
Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter und schlüpfte vorbei, auf ihre Seite des Tisches. Die Vögel rauschten vom Futtertrichter auf, mit einem Flügelwirbel aus lauter B’s und R’s, dem Buchstaben B folgte eine Reihe Vibrato-R’s. Aber das war es überhaupt nicht. Nicht im Entferntesten.
»Du hast etwas gesagt. Ich weiß nicht. Das Haus.«
»Belanglos. Vergiss es.«
»Ich will es aber nicht vergessen.«
»Es ist belanglos. Lass es mich mal anders ausdrücken. Es ist langweilig.«
»Sag ’s mir trotzdem.«
»Es ist zu früh. Es strengt an. Es ist langweilig.«
»Du sitzt da und redest. Sag ’s mir«, sagte sie.
Sie aß etwas Müsli und las die Zeitung.
»Es strengt an. Es ist wie was. Es ist, als müsste man einen Felsblock bewegen.«
»Du sitzt da und redest.«
»Hier«, sagte er.
»Du hast gesagt, das Haus. Nichts über das Haus ist langweilig. Ich mag das Haus.«
»Du magst alles. Du liebst alles. Du bist mein trautes Heim. Hier«, sagte er.
Er gab ihr, was von seinem Toast übrig war, und sie kaute es, vermengt mit Müsli und Beeren. Plötzlich wusste sie, was er ihr hatte sagen wollen. Sie hörte die Krähen, ganz viele jetzt, sie lärmten in den Bäumen, schikanierten vermutlich einen Falken.
»Sag ’s mir einfach. Dauert bloß eine Sekunde«, sagte sie und wusste ganz genau, was es war.
Sie sah, wie er an die Brusttasche fuhr, dann zögerte und die Hand zur Tasse sinken ließ. Es war sein Kaffee, seine Tasse und seine Zigarette. Ein Vorfall, in der Zeitung beschrieben, wie er aus den tintigen Druckzeilen aufzusteigen und sie hineinzuziehen schien. Du teilst die Sonntagszeitung auf.