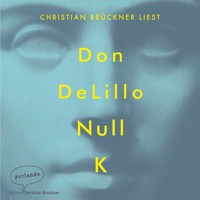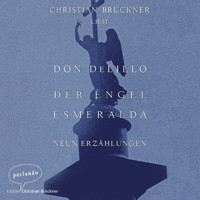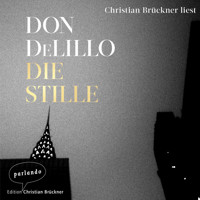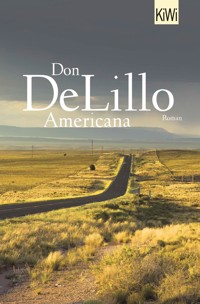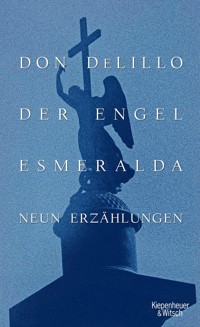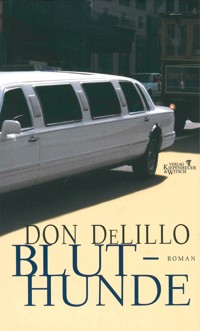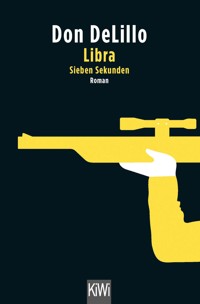9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
DeLillos zeitloses Porträt einer sinnentleerten Gesellschaft – jetzt wiederentdecken! Lyle und Pammy – ein typisches New Yorker Yuppiepaar der späten 1970er-Jahre: Er arbeitet an der Börse, sie im World Trade Center. Abends sitzt er in der perfekt eingerichteten Wohnung und zappt sich durch das Fernsehprogramm, sie geht zum Stepptanz. Beide stürzen sich in Affären. Lyle beobachtet sogar einen Mord und lässt sich auf ein Detektivspiel ein. Doch keines dieser Abenteuer berührt die beiden im Inneren – dort herrscht nur Leere. Selbst als Akteure in unterschiedliche kleine Spiele verwickelt, nehmen sie sich doch nur als ohnmächtige Figuren in einem großen Stück wahr, das von undurchschaubaren Mächten dirigiert wird.Don DeLillo entwirft in diesem frühen Werk von 1977 ein düsteres Bild einer sinnentleerten Welt, deren Zusammenhänge sich ihren Bewohnern nicht mehr erschließen. Jede Gewissheit ist verschwunden, nichts ist mehr so, wie es scheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Don DeLillo
Spieler
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Don DeLillo
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Don DeLillo
Don DeLillo, geboren 1936 in New York, ist der Autor von 15 Romanen und drei Theaterstücken. Sein umfangreiches Werk wurde mit dem National Book Award, dem PEN/Faulkner Award for Fiction, dem Jerusalem Prize und der William Dean Howells Medal from the American Academy of Arts and Letters ausgezeichnet. 2015 erhielt Don DeLillo den National Book Award Ehrenpreis für sein Lebenswerk.
Matthias Müller, geboren 1950 in Bremen, studierte Japanologie in Wien und Berlin und lebt heute in den Niederlanden. Er übersetzt wissenschaftliche Texte, Literatur und Sachbücher sowie spezialisierte Texte im Bereich Musik. Zu den von ihm übersetzten Autoren gehören Breyten Breytenbach, John Barth, John Cheever und Garth Risk Hallberg.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Lyle und Pammy – ein typisches New Yorker Yuppiepaar der späten 1970er-Jahre: Er arbeitet an der Börse, sie im World Trade Center. Abends sitzt er in der perfekt eingerichteten Wohnung und zappt sich durch das Fernsehprogramm, sie geht zum Stepptanz. Beide stürzen sich in Affären. Lyle beobachtet sogar einen Mord und lässt sich auf ein Detektivspiel ein. Doch keines dieser Abenteuer berührt die beiden im Inneren – dort herrscht nur Leere. Selbst als Akteure in unterschiedliche kleine Spiele verwickelt, nehmen sie sich doch nur als ohnmächtige Figuren in einem großen Stück wahr, das von undurchschaubaren Mächten dirigiert wird.
Don DeLillo entwirft in diesem frühen Werk von 1977 ein düsteres Bild einer sinnentleerten Welt, deren Zusammenhänge sich ihren Bewohnern nicht mehr erschließen. Jede Gewissheit ist verschwunden, nichts ist mehr so, wie es scheint.
»Was sich (…) hier zeigt, ist die eminente analytische Intelligenz, mit der DeLillo sein Projekt verfolgt: nämlich den Umschlag von gesellschaftlicher Komplexität in Chaos und atavistische Verhaltensweisen zu durchleuchten. Und das ist es schließlich, was ihn zu einem der wichtigsten und interessantesten nordamerikanischen Autoren gemacht hat.«
Eberhard Falcke, Deutschlandfunk
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Players
© 1977 by Don DeLillo
© 1995, Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH, Reinbek
Die Originalausgabe erschien 1977 unter dem Titel »Players« bei Alfred Knopf, Inc., New York
Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlags, Reinbek
All rights reserved
Aus dem amerikanischen Englisch von Matthias Müller
© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln, nach dem Originalumschlag von Noma Bar/Dutch Uncle
ISBN978-3-462-31658-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Der Film
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Das Motel
Der Film
Jemand sagt: »Motels. Ich mag Motels. Ich würde gern eine ganze Kette davon besitzen. Weltweit. Ich würde gern von einem zum anderen reisen. Das hat etwas von Selbsterkenntnis.«
Im Flugzeug wird die Beleuchtung abgedämpft. In der Piano-Bar verstummen alle einen Moment lang. Als würde ihnen zum ersten Mal klar, wie viele mechanische und elektrische Komponentensysteme, welche präzise Aussteuerung von Belastungskräften, Triebwerken, Schub und Energie erforderlich waren, um ihr Gefühl des Fliegens auf dieses Restbeben zu reduzieren. Hinter den Scheiben keine Andeutung mehr von Sonnenuntergang. Vier Männer und drei Frauen bewohnen dieses konkrete Bild erstarrter Bewegung. Das einzige Geräusch ist Dröhnen. Eine Sekunde Dunkelheit, mehr hatten wir bis jetzt nicht, genügte, um das stillschweigende Band zu verstärken, das, mehr noch als Entfernung, Geschwindigkeit oder Ziel, aus jeder Reise ein gewisses Geheimnis macht, an dessen Lösung die Reisenden mit vereinten Kräften zu arbeiten haben, wobei sie sich allmählich des Erkennungscodes der anderen bewusst werden. In der Kabine vor ihnen ist man gerade mit dem Abendessen fertig, gleich beginnt der Film.
Als das Licht wieder angeht, beginnt der Mann am Piano eine Melodie zu spielen. In der Nähe steht eine Frau, keine dreißig, mit hellen Haaren und Flugangst. Zu ihrer Linken steht ein Mann, er hält den Rand seines Glases an seine Unterlippe. Sie gehören eindeutig zusammen, ein Paar, das sich gegenseitig trägt wie Kleider.
Die Stewardess kommt mit Kissen und Zeitschriften vorbei, wirft einen Blick in die Kabine und auf die Leinwand, Vorspann über dem Bild eines einsam daliegenden Golfplatzes, Morgendämmerung. Am Eingang zur Piano-Bar, etwa drei Meter vom Klavier entfernt, stehen zwei Stühle, durch einen Aschenbecherständer voneinander getrennt. Hier sitzt ein weiteres eindeutiges Paar, in diesem Fall zwei Männer. Beide blicken zum Klavierspieler, voller Vorfreude auf ihr eigenes Vergnügen an dem zielsicheren Kommentar, den er mit seiner Melodienauswahl andeuten wird.
Die dritte Frau sitzt im hinteren Teil der Kabine. Sie futtert Cashewnüsse, die sie mit Ginger Ale herunterspült. Sie ist Anfang vierzig, unauffällig gekleidet. Sonst wissen wir nichts über sie.
Ohne Kopfhörer können die Leute in der Piano-Bar den Ton des laufenden Films natürlich nicht hören. Morgendämmerung, etwas neblig, feucht glänzende Oberflächen. Die letzte Vorspannzeile verschwindet, ein Fähnchen, das ein fernes Grün markiert, hebt sich leicht und flattert, und dann erscheint am linken Bildrand eine Gruppe Golfspieler mit ihrer Ausrüstung.
Noch tastend, in diesen ersten Momenten, liefert der Pianist die typische Begleitung für einen Stummfilm. Das amüsiert die anderen, aber ihr Lächeln und ihre Mienen sind nicht auf jemand Bestimmtes gerichtet, sondern dürfen noch umherschweifen, wie es unter Reisenden in der Anfangsphase üblich ist. Nur die Stewardess wirkt enttäuscht von der Beschränktheit dieser logischen Verbindung zwischen Musik und Film. Natürlich, der Film, den sie da ansehen wird, ist praktisch ein Stummfilm. Aber sie vermittelt den Eindruck, als sei ihr das alles schon bestens bekannt.
Die Sitzreihen zwischen Piano-Bar und Leinwand wirken leer, kein einziger Kopf ragt über den hohen Rückenlehnen der verstellbaren Sessel hervor. Wir nehmen an, dort sitzen Leute, reglos, damit zufrieden, zwischen den Bildern herumzustochern.
Die Frau, die in der Nähe des Pianos steht, fängt an zu gähnen, beinahe zwanghaft, ein leichter Anfall von irgendetwas. Sie gähnt in Flugzeugen so, wie sie früher unmittelbar vor dem Einsteigen in die Achterbahn gegähnt hat (während der Pubertät), oder wenn sie die Nummer ihres Vaters gewählt hat (als junge Frau). Mit einer stilisierten, ruckartigen Bewegung, die etwas Chaplineskes hat, zieht ihr Gefährte den linken Fuß weit nach hinten und tritt sie leicht in den Hintern, ein so sorgfältig ersonnener Akt, dass sie mitten beim Gähnen lachen muss.
Die Golfspieler stapfen ins Bild, insgesamt sieben oder acht, weiße Hautfarbe, männlich, korpulent, einige sitzen in Golfwägelchen, die langsam im Gänsemarsch über kleine Anhöhen hoppeln. Die Männer sind alle mittleren Alters und tragen schreiend bunte Sportkleidung, wie der Herr aus der Vorstadt sie am Wochenende schätzt; die Farben sind derart grell, als sollte damit veranschaulicht werden, wie verrückt die zweite Kindheit ist.
Der Klavierspieler baut in seine Sequenz ein Element der Spannung ein. Trotz der Falten um die Augen herum hat sein Gesicht die ansprechende Offenheit nur langsam verloren, das objektive Sinnbild einer moralischen Kompetenz, wie wir sie mit jungen Menschen verbinden, die töpfern oder Meeresforschung betreiben.
Feuchte Oberflächen, eine leichte Brise, der Morgennebel lichtet sich. Die Golfer gruppieren sich um einen Abschlagplatz, und dann beginnen die Mitglieder eines spontan gebildeten Dreiers der Reihe nach mit Treibschlägen, wobei sie mit dem Körper in die Flugbahn des Balls hineinschwingen. Sie ziehen weiter den Fairway entlang, während ihre Kollegen Schwungschläge üben. Einer von ihnen (gelbe Strickjacke) klemmt sich, in einer scherzhaften Jäger-Pantomime, den Kopf seines Schlägers unter die Achselhöhle und zielt kurz mit dem Stiel. Dieser völlig beiläufige Augenblick verflüchtigt sich in die Ausläufer des umgebenden Geschehens.
Der Ältere der beiden Homosexuellen lehnt sich über den Aschenbecher und stößt seinen Gefährten mit einer theatralischen Geste an. Dem Klavierspieler ist die fast verborgene Geste des Golfspielers ebenfalls nicht entgangen, und er reagiert darauf mit einer Reihe von Bassakkorden. Dräuend, unheilschwanger.
Es sollte erwähnt werden, dass Gestalten und Landschaft aus dem besonderen Blickwinkel eines Teleobjektivs gesehen werden. Ein anschauliches Beispiel für die Intimität von Entfernung. In diesem Zusammenhang wirkt der Raum nicht so sehr wie etwas intuitiv Erlebtes, sondern eher wie eine abgestufte Reihe von Dichtewerten. Er schiebt sich in kompakten Blöcken dazwischen. Was die Kamera mit den Zuschauern gemein hat, ist eine bewusst empfundene optische Verstohlenheit. Das Gefühl, selbst unsichtbar zu sein. Das Publikum als privilegierte Betrachter.
Von der Klaviermusik, ebenso sehr Ersatz-Tonspur wie Medium eines eigenständigen Kommentars, geht eine sich allmählich verstärkende (unterschwellige) Beklommenheit aus, die sich gut mit der präzise bemessenen Sequenz der Einstellungen verbindet, jede ein klein wenig kürzer als die vorhergehende, eine Andeutung, dass alltägliche Ereignisse gleich einem unvorhergesehenen Druck weichen werden.
Der jungen Frau ist es gelungen, mit dem Gähnen aufzuhören. Der Mann neben ihr betrachtet die Fingernägel seiner rechten Hand. Er tut dies, indem er die Finger über der Handfläche krümmt und den Daumen ausstreckt. Ohne den Blick von der Leinwand zu nehmen, greift die Frau hinüber, packt seinen Daumen und fängt an, ihn zurückzubiegen. Er blickt auf und dann weg, wobei er die Augen verdreht. Nach einer Weile gibt er den Laut von sich, den einer oder beide von sich geben, wenn Angst sie plagt, oder eine folgenschwere Entscheidung, namenloses Grauen, die Aussicht, langweilige Gäste unterhalten zu müssen, sein Job, ihr Job. Die Frau hinten sieht mit ausdrucksloser Miene zu. Es ist ein langgedehntes Summen, der Sprachlaut m.
Die Golfspieler widmen sich ganz ihrem Spiel an diesem lauen grünen Morgen. Zwischendurch auf einem anderen Fairway wieder versammelt, hat es fast den Anschein, als würden sie in geballter, betrieblicher Herrlichkeit vor einem fernen Fähnchen posieren. Jetzt ist es so weit, dass sich das beobachtende Verborgene zeigt, das besondere Bewusstsein, das ein Teleobjektiv impliziert.
Aus dem Unterholz im unmittelbaren Vordergrund, etwa zweihundert Meter von den Golfspielern entfernt, erhebt sich ein Mann, den Rücken zur Kamera. Als er sich umdreht, um jemandem ein Zeichen zu geben, sieht man, dass er in der Rechten eine Waffe hält, ein halbautomatisches Gewehr. Nachdem er das Zeichen gegeben hat, geht er nicht wieder in die Hocke. Einer der Golfer wählt ein Eisen aus.
Ein weiterer Mann taucht aus dem Gebüsch auf und richtet sich ganz auf. Seinen genauen Standort im Verhältnis zu den anderen Personen kennen wir nicht. Er hat das Gesicht zur Kamera gewandt. Hinter ihm liegt dichter Wald. Seine Kleidung ist nicht einheitlich – Baseball-Mütze (Schirm hochgeklappt), abgewetzte Weste mit Paisley-Muster, Arbeitshemd, Militärgürtel, weiße Hose in hohen Stiefeln. Patronengurte kreuzen seine Brust. Er hält eine abgesägte Enfield in der Hand.
Das Teleobjektiv richtet sich auf einen Mann und eine Frau, die auf einem kleinen Hügel stehen. Weitere Bassakkorde. Unheil braut sich zusammen. Aus dieser Entfernung wirken sie wie in den Himmel hineingebaut, bewegungslos, beide tragen Gewehre. Eine andere Frau, in einer viel näheren Einstellung, steht allein in einer Sandgrube, barfuß, in einem ärmellosen T-Shirt und einer Fransenlederhose. Das eine Bein ist gebeugt, das ganze Gewicht ruht auf dem andern, dem linken. In der Hand hält sie eine Machete, die sie nach hinten über die rechte Schulter gelegt hat.
Der Pianist rückt ans Ende der Bank und richtet sich halb auf, um einen besseren Blick auf die Leinwand zu bekommen, ohne die Finger von der Tastatur zu nehmen. Der erste Terrorist setzt zu seinem langen Lauf über den Fairway an.
Was jetzt passiert, findet größtenteils in Zeitlupe statt. Man sieht die Terroristen, einer nach dem anderen, aus dem Gebüsch herausrennen, über die offene Rasenfläche, auf die Golfspieler zu. Da sie jung sind, in Jeans, Leder und Dachboden-Trouvaillen gekleidet sind und laufen, geraten sie zwangsläufig zu einem lyrischen Zwischenspiel. Durch die unnormale Langsamkeit, mit der sich ihre Körper bewegen, wirken sie wie Geschöpfe der Schwerkraft, wie tierähnliche Wesen, die sich mühsam auf irgendeine grundlegende Verwandlung zubewegen, ihre unvergleichliche rohe Schönheit das Ergebnis sorgfältig eingesetzten körperlichen Kraftaufwands. Auf dem Hügel jetzt nur noch eine einsame Gestalt, ein Mann, die Hände in den Taschen, unter einem Arm das Gewehr.
Der erste Läufer eröffnet das Feuer, als er sich der Gruppe nähert. Ein Mann in einem Pullover geht zu Boden, Golfbälle kullern ihm aus den Taschen. Die Terroristen versuchen, ihre Opfer einzeln oder in Zweiergruppen zu isolieren, und können schon in den ersten Sekunden drei Tote verbuchen. Körper fallen in Zeitlupe zu Boden. Blut auf Golftaschen, auf weißen Schuhen, auf Karo-Hosen. Einige Männer versuchen zu fliehen. Einer holt mit seinem Schläger aus und kriegt von dem Mann mit der Enfield einen Bauchschuss verpasst. Er taumelt in einen Teich, der sich mit seinem Blut bewölkt. Die Stewardess serviert dem Männerpaar Mixgetränke und der Frau hinten ein Ginger Ale.
Erst jetzt enthüllt die Stummfilmmusik die eigentliche Beziehung, die zwischen ihr und den Ereignissen auf der Leinwand besteht. Der Großartigkeit revolutionärer Gewalt, dem heimlichen Sehnen, das dadurch selbst in der sanftmütigsten Seele ausgelöst wird, mischt das brillante Geklimper des Klaviers eine Ironie bei, die zu treffend ist, als dass man sie ignorieren könnte. Die schlichte Harmlosigkeit dieser Musik untergräbt den fotogenen Terror und reduziert ihn zu einer inhaltslosen Turbulenz.
Wir sollen uns hier an etwas erinnern, obwohl dieser Akt der Erinnerung vielleicht eher mythisch als subjektiv ist, eine Traumspule aus Biograf-Zeiten. Er fließt durch uns hindurch. Schepprige Klaviere in tausend Fünf-Cent-Lichtspieltheatern. Herzzerreißende Melodramen, Slapstick-Komödien und nervenzerrende Spannung. Ist Geschichte derart schwerelos, hat sie, so lernen wir, leichtes Spiel mit den Bürden unserer heutigen Zeit.
Das kleine Publikum in der Piano-Bar lacht, außer der Frau mit dem Ginger Ale. Trotz der Faszination, die die Kamera für das opulente Abschlachten dieser eindeutig überflüssigen Männer zeigt, wird die Szene unklar, wegen der melodramatischen Klavierbegleitung. Wir werden in eine gruselig-komische Mehrdeutigkeit getaucht, in ein Schauspiel, bei dem lächerliche Menschen vollkommenen Trotteln schreckliche Dinge antun.
Noch komischer (für einige) wird das Ganze möglicherweise durch das Spiel, um das es hier geht. Golf. Diese anale Runde skrupulöser Achtsamkeit und spießiger Sorgen. Zuzusehen, wie Golfer zur Begleitung von Trillern und Schnörkeln massakriert werden, scheint zumindest den in der Piano-Bar Anwesenden ein Anlass hämischer Freude zu sein.
Körper werden in den Sand und ins hohe Gras zurückgeschleudert. Wenn das alles ein bisschen wie Cowboys und Indianer wirkt, umso besser. Einer der Golfspieler versucht, in seinem Wägelchen zu entkommen, und steuert auf den Wald zu. Die junge Frau mit der Machete nimmt die Verfolgung auf, die Arme pumpen in Zeitlupe, die Haare fächern im Wind.
Der Pianist spielt ein Verfolgungsthema. Jedes Lächeln auf seinem pseudojungenhaften Gesicht wird sorgfältig konterkariert – durch eine Grimasse hier, ein Schaudern dort. Schließlich ist das hier professionelle und hochgradige Gewalt. Das übrige Publikum lacht, als das Golf-Wägelchen auf einem Hang umkippt, die Frau hinterherrutscht und langsam die Machete hebt, um dem Mann einen Rückhandhieb zu versetzen. Der Mann versucht davonzukriechen. Sie geht in aller Ruhe neben ihm her und hackt auf Rücken und Nacken ein. Hier wird das Verfolgungsthema von einem unbeschwerten Lamento abgelöst. Die Frau lässt die Machete in seinem Körper stecken und macht sich auf den Weg zurück zu ihren Gefährten.
Der Mann, der auf dem Hügel geblieben war, kommt jetzt herunter und betritt diese Szene frischen Todes. Er ist der strahlende, der Sonne entstiegene Engel der Befreiung, mit Seemannsmütze und schwarzem Regenmantel. Unter den Augen hat er Farbruß aufgetragen, und auf Stirn und Wangen dicke weiße Schminke. Die anderen stehen schwer atmend da, ausschließlich auf ihre eigene überschwengliche Erschöpfung konzentriert. Er hält das Schrotgewehr von sich weg, in möglichst genauer Parallele zu seinem Körper, die Mündung nach oben gerichtet. Die Golfspieler liegen überall verstreut. Wir sehen sie der Reihe nach, aufgeplatzt, kleine Lackbündel. Der Terroristenchef, jefe, honcho, Befehlshaber, feuert mehrere Salven in die Luft – ein Blutritus oder eine leidenschaftliche Verkündung. Buster Keaton, sagt das Klavier.
Jetzt serviert die Stewardess denen Drinks, die welche brauchen, und dann wechseln alle allmählich ihre Plätze in der Piano-Bar, mit einer fast systematischen Rastlosigkeit, in der sich ihr plötzliches Desinteresse an dem Film manifestiert. Jetzt, da die Konfiguration derart durcheinandergewürfelt, das Klavier verstummt ist und der Film nicht mehr beachtet wird, erfolgt bei den Anwesenden eine Rückbesinnung auf sich selbst. Ihnen fällt wieder ein, dass sie sich in einem Flugzeug befinden, dass sie Reisende sind. Ihr eigentliches Leben liegt unter ihnen, es beginnt sich jetzt schon wieder zusammenzusetzen, ruft diese Körper aus der Luft zurück, in Form von Post, die darauf wartet, geöffnet zu werden, in Form von Akten und läutenden Telefonen auf Büroschreibtischen, in Form eines zufällig ausgesprochenen Namens.
Erster Teil
1. Kapitel
Der Mann war oft da. Er stand vor der Federal Hall, an der Ecke Wall und Nassau, hager, grauer Stoppelbart, vielleicht siebzig, glänzte vor Schweiß in seinem abgewetzten Hemd und abgetragenen Anzug und hielt ein selbstgemachtes Schild über dem Kopf, manchmal ganze Nachmittage lang. Die Arme nahm er nur herunter, um die Durchblutung wieder in Gang zu bringen. Das Schild, einen halben Meter mal ein Meter groß, war auf beiden Seiten mit handgeschriebenen Botschaften politischen Inhalts beschriftet. Die Müßiggänger, die zu dieser Stunde meistens auf den Stufen vor der Federal Hall saßen, waren zu sehr von den Passanten abgelenkt, um mehr als einen flüchtigen Blick für den Mann mit seinem Schild übrigzuhaben, der schließlich ein vertrautes Bild bot. Hier unten, im Bezirk, versammelten sich Männer noch feierlich, um Frauen nachzuglotzen. Sie fanden, wer in einem tosenden Strom von Geld arbeitete, dem stehe dieses rudimentäre Privileg zu.
Lyle stand neben der Tür eines Restaurants und säuberte sich die Fingernägel mit dem Zahnstocher, den er beim Zahlen aus der kleinen Schale herausgenommen hatte. Er aß nicht mehr im Luncheon-Klub der Börse, trotz der angenehmen Atmosphäre dort; und obwohl der Klub ausschließlich Mitgliedern und ihren Gästen vorbehalten, gut geführt und gemütlich ausgestattet war, trotz der fähigen Kellner, die einen namentlich kannten, trotz der unangestrengten Aufmerksamkeit des Toilettenpersonals, das einem das Handtuch bereithielt, wenn man es brauchte, und einem mit hinreißender Diskretion den Anzug abbürstete – richtige Schwarze, trotz der bequemen Nähe, nur eine Fahrstuhlfahrt vom Börsensaal entfernt. Er beobachtete den alten Mann, der mit erhobenen Armen und zitternder Hand in der prallen Sonne stand. Dann mischte er sich unter die mittägliche Menschenmenge, wobei er sich fragte, ob er irgendwie zu kompliziert geworden war, um in attraktiver Umgebung, eine Minute von seinem Arbeitsplatz entfernt, eine anständige Mahlzeit zu genießen, die einem von einigermaßen fröhlichen Männern serviert wurde.
Auf der anderen Seite vom Broadway, ein paar Blocks weiter nördlich, stand Pammy in der Sky-Lobby vom Südturm des World Trade Center und kämpfte gegen die Menschenmenge an, die sie von einem nach unten fahrenden Express-Lift abdrängte. Sie wollte nach unten, obwohl sie im dreiundachtzigsten Stock arbeitete, weil sie im falschen Gebäude war. Es war schon das zweite Mal, dass sie von der Mittagspause zurückgekehrt und in den Südturm gegangen war anstatt in den Nordturm. Jetzt musste sie erst gegen die Mittagspausenmassen hier in der Sky-Lobby ankämpfen, dann zum Hauptgeschoss hinunterfahren, zum Nordturm hinübergehen, dort den Express zur Sky-Lobby in den achtundsiebzigsten Stock nehmen, gegen weitere Massen ankämpfen und dann einen Local, mit vibrierenden Scheiben, bis zum dreiundachtzigsten nehmen. Als sie versuchte, sich seitlich durchzudrängen, merkte sie, dass jemand neben ihr sie anstarrte.
»Pam, nicht wahr?«
»Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir.«
»Jeanette.«
»Ich glaube nicht, dass.«
»Highschool.«
»Jeanette.«
»Wie lange ist das jetzt her?«
»Highschool, Jeanette.«
»Ich nehm’s dir nicht übel, dass du dich nicht mehr erinnerst. Mann, ist das lange her.«
»Ich glaube, ich erinnere mich allmählich.«
»Du arbeitest hier, oder? Alle arbeiten hier.«
»Ich sollte eigentlich in dem nach unten sein.«
»Kannst du dich immer noch nicht erinnern? Jeanette, die immer mit Theresa und Geri zusammen war.«
»Jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen.«
»Wie viel Jahre ist das jetzt her?«
»Die lassen mich einfach nicht rein.«
»Aber findest du es nicht toll hier? Du solltest mal sehen, wie ich zur Cafeteria fahren muss. Mit dem Local und dem Express nach unten. Dann wieder mit einem Express nach oben. Dann die Rolltreppe, falls man es geschafft hat, sich vorher nicht zerfetzen zu lassen.«
»In Stücke reißen, ich weiß.«
»Du arbeitest wahrscheinlich auch für den Staat, wenn du hier bist?«
»Ich bin im falschen Turm.«
Pammy und Lyle gingen nicht mehr sehr oft weg. Früher hatten sie viel Zeit damit verbracht, Restaurants zu entdecken. Sie unternahmen Fahrten bis zu den blässesten Grenzen der Stadt, aßen in kleinen Kaschemmen am Flussufer, in der Nähe offener Brückenzufahrten, oder in Familienrestaurants draußen in den Außenbezirken, deren neutrale Einrichtung und unzugängliche Lage als Beweis ihrer Unverfälschtheit dienten. Sie besuchten Klubs, wo sich junge Talente dem Publikum vorstellten und Komikertruppen auf der Bühne improvisierten. Im Frühling fuhren sie an den Wochenenden zu den Gewächshäusern in den Vororten, um Pflanzen zu kaufen, und zu den Liegeplätzen auf City Island oder am North Shore, wo sie Freunden halfen, ihre bescheidenen Jachten seetüchtig zu machen. Allmählich verringerte sich ihr Radius. Nicht einmal Filme, Doppel-Vorstellungen in den kronleuchterbehängten Pissoirs am Upper Broadway, reizten sie mehr. Mittlerweile schien ihnen das Bedürfnis zu fehlen, Dinge zusammenzutragen und zu sammeln.
Zum Abendessen gab es Sandwiches oder Instant-Suppe, oder sie gingen um die Ecke zu einem Coffee-Shop, wo sie hastig aßen, während in der Nähe ihres Tisches ein Mann den Boden aufwischte und dabei wie ein Jazz-Bassspieler knurrte. Drei Straßen weiter gab es einen Chinesen. Das war, an den meisten Abenden und Wochenenden, die größte Entfernung, die sie zu nicht-utilitären Zwecken zurücklegten. Pammy hatte das Geschick entwickelt, die Kellner dort zu unterscheiden. Eine Quelle stillen Stolzes.
Lyle verbrachte die Zeit mit Fernsehen. Er saß in nahezu vollständiger Dunkelheit fünfzig Zentimeter vor der Mattscheibe und drehte alle dreißig Sekunden am Programmwähler, manchmal noch viel öfter. Er war nicht auf der Suche nach etwas, das seine Aufmerksamkeit fesseln konnte. Kaum. Es machte ihm einfach Spaß, mit dem Knopf neue Bildzündungen auszulösen. Inhalt interessierte ihn schon bis zu einem bestimmten Punkt. Doch die visuell-taktile Freude am Programmwechseln hatte Vorrang, wodurch selbst verstreute Inhaltsfragmente in angenehme territoriale Abstraktionen umgewandelt wurden. Fernsehen war für Lyle eine Disziplin wie Mathematik oder Zen. Werbung, Testbilder, Familiensagas in spanischer Sprache hatten in der Regel mehr zu bieten als die Standardprogramme. Ihn interessierte der Wiederholungsaspekt der Werbung. Das gleiche Filmmaterial mehrmals zu sehen war ein Test für den Einfallsreichtum des Auges, seine Fähigkeit, eine variable Auswahl zu treffen, einen Zeitausschnitt zu gliedern. Er stellte selten den Ton an. Dem Ton wurden die UHF-Sender mit fehlerhafter Ausrüstung oder Fremdsprachen am besten gerecht.
Hin und wieder sah er sich eins der Programme in den Offenen Kanälen an. Jede Woche war eine Stunde oder so für lokal gefertigte Pornografie reserviert, das Werk einheimischer Kunsthandwerker. Auf der Mattscheibe fand er sicher eine ungeschminktere Wahrheit als in all diesem schimmernden Fleisch der Hochglanz-Zeitschriften. Er saß in seiner Schale gekrümmten Raums, in seinem staubigen Licht. Diese ganze genitale Aggression hatte etwas von der ausgeprägten Schamlosigkeit eines Kindes. Leute von der Straße, auf der Suche nach etwas, an dem sie saugen können. Handkameras, die forschend zwischen irgendwelche Beine halten. Lyle blieb völlig bewegungslos während dieser Aneinanderreihung kleiner grauer Körper. Was er sah, fesselte ihn vollständig, obwohl es gleichzeitig seine Sinne zunehmend abstumpfte. Die eine Stunde kam ihm wie vier vor. Müde wie er war, entleert, gelangweilt von all diesen posierenden Desperados, hätte er leicht die ganze Nacht hindurch gucken können, gefangen vom Netz-Effekt des Fernsehens, dem elektrostatischen Glühen, das wie ein privilegierter Zustand zwischen Welle und visuellem Bild erschien, ein Geheimnis kosmischer Energie. Er fragte sich, ob er zu kompliziert geworden war, um nackte Körper als solche zu betrachten und sich davon erregen zu lassen.
»Hier, seht’s euch an. Wir sind hier, Leute. Die Zukunft ist über uns eingestürzt. Und wie sieht sie aus?«
»Gott, hast du mich erschreckt.«
»So sieht sie aus. Sie sieht wie Wellen aus, wie Wellen atmosphärischer Störung. Sie wird verfrüht hereingebeamt, was das Brummen erklärt. Sie sieht aus wie abgewrackte Leute aus der Mercer Street.«
»Komm, lass mich schlafen.«
»Pass auf, ich will damit sagen: Während ich hier spreche. Ich meine, es geht um Folgendes. Wir sitzen hier und gucken in der Intimität und Gemütlichkeit unseres Schlafzimmers zu, und die haben ihr Loft und ihre Kamera, und das wird dann gezeigt, weil das Gesetz es vorschreibt. Sowie sie eine Kamera sehen, ziehen sie sich aus. Früher hat man gewunken.«
»Gut.«
»Sehen Sie nur. Sehnse nur, meine Damunherrn. Sehnse, wie die Pandas mit ihrer Scheiße spielen. Saa-genhaft. Saa-genhaft.«
Pammy hatte ein Lächeln, bei dem eine Spur Zahnfleisch sichtbar wurde. Man hatte ihr gesagt, das sehe rührend aus. In ihren komplizierteren Bewegungen, beim Päckchentragen oder beim Ausweichen von Pennern, zeigte sie eine gewisse Unbeholfenheit, wie ein Händeklatschen, das ihre Kindheit zurückholte. Sie hatte ein schmales Gesicht, strähnige, mittelblonde Haare. Die Leute mochten ihre Augen. Irgendetwas schien in ihnen zu wohnen und manchmal zur Begrüßung herauszuspringen. Bei Unterhaltungen war sie lebhaft, eine Händefuchtlerin, eine Unterbrecherin, eine Kopfwacklerin, den Blick fest auf den Mund des Sprechers gerichtet, während ihre eigenen Lippen manchmal den Rhythmus wiederholten. Ihr Körper war fest und gerade und hätte einer Schwimmerin gehören können. Manchmal spürte sie keine Beziehung zu ihm.
Sie arbeitete in einem Unternehmen, das Grief Management Council hieß. Grief war nicht der Name des Gründers, sondern bezeichnete heftiges seelisches Leiden, tiefe Zerknirschung, extreme Angstzustände, akute Trauer und Ähnliches. Die Zahl der Angestellten schwankte, manchmal radikal, von Monat zu Monat. In den Broschüren, die Pammy verfasste, wurde Grief Management als ein großes, expandierendes Service-Leistungs-Unternehmen beschrieben, das mit seinen Kliniken, Broschüren und ausgebildeten Beratern der Gemeinschaft half, Kummer zu verstehen und zu verarbeiten. Es gab Einzelperson-Tarife, Gruppentarife, Sonderkonditionen für Beratung, Schutzgebühren für Broschüren und Handbücher, Honorare für Familiensitzungen und Ehekummer-Seminare. Die meisten Zweigstellen waren klein und in Flachbauten untergebracht, in denen sich auch medizintechnische Betriebe und Röntgenlabors befanden. Diese Gebäude waren gewöhnlich die ersten eines geplanten Komplexes, der nie fertiggestellt wurde. Pammy hatte einige Zweigstellen zwecks Beschaffung von Hintergrundmaterial besucht, und es waren starke Eingriffe erforderlich gewesen, um aus den Bildern, die sie gemacht hatte, die unkrautüberwucherten und von Bulldozern durchpflügten Baustellen zu entfernen. Ursprünglich hatte sie gefunden, das World Trade Center sei eine unpassende Zentrale für so einen Laden. Aber mit der Zeit änderte sie ihre Auffassung. Wo sonst sollte man all diesen Kummer stapeln? Irgendjemand hatte vorausgesehen, dass die Menschen sich irgendwann nach einer Möglichkeit sehnen würden, ihre Gefühle zu kodifizieren. Man würde eine Verwaltungsstruktur benötigen. Teams von Verhaltensforschern würden sich in der Kanalisation versammeln und ein Futurismusmodell entwickeln, das auf Archivierungsverfahren basierte. Für Pammy hatten die Türme nichts Dauerhaftes. Sie blieben bloße Konzepte, trotz ihrer Masse nicht weniger flüchtig als irgendeine herkömmliche Lichtverzerrung. Der Eindruck des Flüchtigen wurde zudem noch dadurch verstärkt, dass der Büroraum bei Grief Management ständig umorganisiert wurde. Arbeiter trennten einige Teile mit Trennwänden ab und öffneten andere, trugen Aktenschränke heraus und schoben Sessel und Schreibtische hinein. Als hätten sie den Auftrag, die Möbelmenge dem jeweiligen Niveau nationaler Trauer anzupassen.
Pammy teilte sich einen abgetrennten Bereich mit Ethan Segal, der für die Koordinierung der Zweigstellen-Aktivitäten verantwortlich war. Mit seinen langen Haaren, seinem Repertoire dekadent-verschnörkelter Gesten, seiner extravaganten, schäbigen Kleidung, seinem leicht ironischen, überkultivierten Stil kam er Pammy fast wie eine Figur des englischen Fin de Siècle vor. Selbst die Symptome des Älterwerdens, die er zeigte, schillerten in einer Art fröhlicher Ornamentik. Gewichtszunahme verlieh ihm eine gewisse Leichtigkeit, wie das bei manchen Leuten der Fall ist, und Ethan bediente sich dieser Illusion von Schwung, um beim Gehen nonchalant zu wirken, bei Diskussionen erhaben und beim Spielen feige. Und während sich verschiedene Unregelmäßigkeiten in seine Pose einschlichen, wurden diese ausholenden Bewegungen seiner Arme, die dekadent-verschnörkelten Gesten, in gleichem Maße dramatischer und (absichtlich) leerer. Er lebte mit Jack Laws zusammen, einem Möchtegern-Gammler. In seinem ansonsten dunklen Haar hatte Jack einen schlohweißen Fleck am Hinterkopf. Der Erfolg, den er bei bestimmten Leuten hatte, gründete sich im wesentlichen auf diesen genetischen Irrtum. Es war das Zeichen, das Etikett, der Stempel, das Emblem von etwas Geheimnisvollem.
»Bezaubernder, nutzloser Jack.«
»He, ich arbeite.«
»Es ist erstaunlich, eigentlich fast übernatürlich, wie Leute erst eine Idee haben, eine winzige menschliche Sehnsucht nach irgendetwas, und dann wird es zu einem Lebensstil, zur größten Obsession aller Zeiten. Ich finde so was erstaunlich. So jemand wie ich. Der mit Realität gepäppelt wurde, mit der grundsätzlichen Begrenztheit aller Dinge.«
»Ich bin in den falschen Turm gegangen.«
»Jack will nach Maine ziehen.«
»Also, das ist, warum nicht?«
»Das ist plötzlich zur treibenden Kraft in seinem Leben geworden, wie aus heiterem Himmel, diese Sache, Maine, dieses Wort. Mehr ist es ja nicht, weil er noch nie da war.«
»Aber es ist ein gutes Wort«, sagte sie.
»Maine.«
»Maine«, sagte sie. »Es ist vielleicht schlicht, Ethan, aber es hat eine ganz eigene Kraft. Man hat das Gefühl, das ist der Kern, der moralische Kern.«
»Dies aus dem Munde eines Menschen, der mit Worten arbeitet, dann muss es ja was heißen.«
»Stimmt genau, ich arbeite mit Worten.«
»Vielleicht hat Jack da also doch was.«
»Ethan, Jack hat immer was. Was es auch ist, Jack hat davon die innere Bedeutung, die reinen Teile. Das wissen wir beide über Jack.«
»Und was soll ich machen, pendeln?«
»Ich wäre jetzt gern dort«, sagte sie. »Diese Stadt. In dieser Jahreszeit.«
»Juli, August.«
»Scream City.«
»Du glaubst also, er hat irgendwas?«
»Ich arbeite mit Worten.«
»Du meinst, er hat was Gutes getroffen.«
»Das hat er. Das hat Jack immer schon getan.«
So wie sie Ethan als einen Fin-de-Siècle-Engländer betrachtete, betrachtete sie seinen Mund, getrennt von seinem übrigen Körper, als deutsch. Er hatte energische Lippen, die fast wie ein angeborenes höhnisches Lächeln geformt waren, und es gab Zeiten, da sabberte er beinahe beim Lachen, hatte er kleine Bläschen in den Mundwinkeln. In solchen Momenten musste Pammy an bestimmte Szenen aus Filmen über den Zweiten Weltkrieg denken, Lagebesprechungen im Generalstab der Wehrmacht.
»Vielleicht fahren wir hoch und sehen’s uns mal an.«
»Was ansehen?«, fragte sie.
»Das Gelände. Um ein Gefühl dafür zu kriegen. Nur um mal zu sehen, wie es so wirkt. Er erzählt’s schon überall herum. Maine, sonst passiert was. Pendeln kommt für mich natürlich nicht infrage. Einfach nur, um sich’s mal anzusehen. Für drei oder vier Wochen. Er tobt sich aus und dann kommen wir wieder. Dann geht das Leben weiter, derselbe alte Trott.«
»Maine.«
»Du hast recht, weißt du, Pammy, altes Mädchen. Es hat wirklich so eine gemeißelte Kraft. Irgendwie unzerbrechlich, anders als Connecticut. Ich hör’s gern.«
»Maine.«
»Sag’s, sag’s.«
»Maine«, sagte sie. »Maine.«
Lyle sah seine Nummer auf der Anzeigetafel. Er ging zu einer der Kabinen an der Südwand und griff nach dem Telefon, das ihm ein Angestellter hinhielt.
»Kaufen Sie fünftausend Motors zu fünfundsechzig.«
»GM.«
»Da steckt mehr dahinter.«
Er legte auf und ging hinüber zu Stand 3. Ein alter Freund, McKechnie, kam in einem schrägen Winkel auf ihn zu. Sie gingen ohne ein Zeichen des Wiedererkennens aneinander vorbei. Im Verlauf der nächsten Stunden, während Lyle zu verschiedenen Ecken des Parketts ging, im garage annex handelte, sich mit Leuten seiner Kabine unterhielt, dachte er sporadisch an etwas, woran er seit vielen Jahren nicht mehr gedacht hatte. Das Gefühl, dass alle anderen wussten, was er dachte. Er konnte sich nicht erinnern, wann ihm dieser Verdacht das erste Mal gekommen war. Sehr frühzeitig, offenbar. Alle wussten, was er dachte, aber er wusste nicht, was sie dachten. Die Leute auf dem Parkett bewegten sich jetzt schneller. Ein elektrisches Überkreuzpotenzial lag in der Luft, ein fast überstürztes Gefühl von Lustbarkeit und Jammer. Hin und wieder verursachte ein auf der Tafel angezeigter Preis Aufregung unter den Maklern, den Spezialisten, den Börsendienern. Lyle beobachtete die Aktien-Codes, und die gestelzten Zahlen darunter, den Computerauswurf. Imaginierte Sexualverbrechen. Ein Fantasiegewebe aus Gewalt und Gehässigkeit. Das war die Schande seiner Pubertät. Wenn alle wussten, was er momentan dachte, wenn diese Botschaft, die da in grünlichen Ziffern über die Tafel wanderte, die Ausdrucke, Lyle Wynant darstellten, dann wäre es allein der seelische Müll, der ihn beschämen würde, der ganze unartikulierbare Schutt, die Scherben, Lumpen und Papierfetzen seiner winzigen undefinierbaren Manien. Die Selbstgespräche, die er führte, wenn er in einem Tunnel am Haltegurt hing. All die zeremoniellen Muster, die Hausarbeit der Seele. Die waren viel entlarvender, fand er, als irgendeine herkömmliche Inzestvariante. Auf dem Parkett entstand wieder laute Aufregung, als Xerox auf der Kurstafel erschien. Männliche und weibliche Boten flirteten im Vorübergehen. Der Papiermüll türmte sich auf. Es war unter älteren Kindern und Heranwachsenden wahrscheinlich nicht ungewöhnlich zu meinen, alle wüssten, was man denkt. Dadurch rückte man in den Mittelpunkt, wenn auch auf eine passive und erschreckende Art und Weise. Sie wissen, was ich denke, zeigen es aber nicht. Als es weniger hektisch wurde, ging er zur Raucherzone direkt hinter Stand 1. Frank McKechnie war dort und zerpflückte eine Zigarette.
»Ich bin nicht in Laune.«
»Ich auch nicht.«
»Völliger Verfall.«
»Worüber reden wir?«, fragte Lyle.
»Über die Außenwelt.«
»Ist sie noch da? Ich dachte, wir hätten sie schon wirksam negiert. Ich dachte, darauf läuft’s hinaus.«