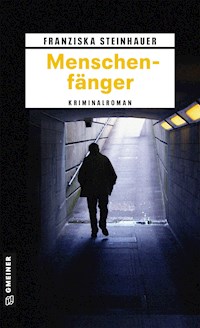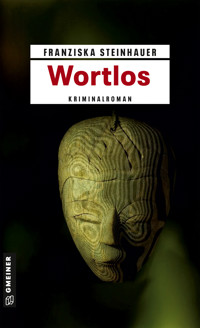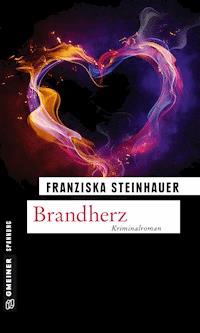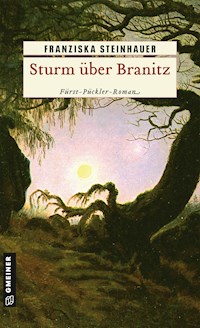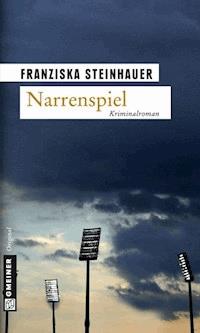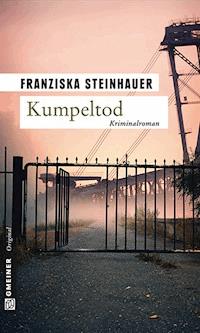
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Peter Nachtigall
- Sprache: Deutsch
Trotz heftiger Proteste wird ein Dorf in der Lausitz abgebaggert, auch der Friedhof muss dem Kohlebagger weichen. Bei ihrer Arbeit stoßen die Totengräber in einem alten Grab auf eine frische Leiche. Kommissar Peter Nachtigall wird zum Tatort gerufen, auf der Fahrt wird sein Wagen von der Straße gedrängt. Die Ereignisse überschlagen sich, als nach dem Fund einer Bombe ein großer Bereich in der Stadt geräumt wird und einer der evakuierten Mieter bei seiner Rückkehr eine grausige Entdeckung macht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Franziska Steinhauer
Kumpeltod
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2012 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: illleeeegal / photocase.com
und © Andreas F. –
Prolog
Als es zu dunkel wurde, griff er nach dem Nachtsichtgerät.
Faszinierend, dachte er beiläufig, Wunderwerk der Technik. Nie hätte er eine solche Qualität erwartet!
Gestochen scharf konnte er den schwarzen Schatten erkennen, der über das freie Feld lief. Schussfeld, drängte sich ihm auf und er kicherte verhalten.
Wie ungeschickt von dem Schwarzen.
Die Bewegungen deutlich unkoordiniert.
Der Schatten sah sich um. Hektisch.
Wandte sich nach links, stolperte, rappelte sich auf, wankte, rannte weiter.
Die Augen des Beobachters klebten an der dunklen Figur des Flüchtenden. Seine Mundwinkel zuckten verächtlich. Dieses miese kleine Arschloch!, überlegte er, hat doch tatsächlich geglaubt, es käme damit durch!
Der Koffer in der Hand des Schattens behinderte diesen offensichtlich beim Laufen.
Mag sein, diese untrainierte Lusche ist nach den paar Metern schon aus der Puste, mutmaßte der Beobachter und drehte den Oberkörper leicht nach rechts, um den Verfolger ins Bild zu bekommen.
Da!
Geschmeidig wie eine Wildkatze folgte eine zweite Gestalt dem Fliehenden.
Angespannt beugte der Beobachter sich vor, drehte an der Scharfstellvorrichtung. Die Waffe hielt der Zweite locker in der Hand, während er der Fährte des anderen folgte.
Lange konnte es nun nicht mehr dauern.
Gleich würde er die beiden gemeinsam ins Blickfeld bekommen.
Als er den Körper leicht nach links schwenkte, bemerkte er mit Genugtuung, dass der Erste schon wieder gestürzt war.
Diesmal kam er nur noch mit Mühe auf die Beine.
»Memme!«, spuckte der Beobachter geringschätzig.
Offensichtlich hatte sich der Typ auch noch verletzt! Es dauerte ziemlich lang, bis er sich unbeholfen in Bewegung setzte.
Der Verfolger holte unerbittlich auf.
Plötzlich waren beide aus dem Fokus des Nachtsichtgeräts verschwunden!
»Scheiße!«, fluchte der Beobachter und drehte hektisch an den Stellschrauben, um die beiden wieder einzufangen. Zischte wütend Verwünschungen in die Nacht.
Gerade als er enttäuscht seinen Platz verlassen wollte, entdeckte er die beiden!
Er atmete auf. »Wäre doch jammerschade gewesen, wenn ich nun ausgerechnet den Showdown verpasst hätte!«
Die beiden Männer standen sich vor dem schwach erhellten Horizont gegenüber.
Der Flüchtende mit gebeugtem Oberkörper und im Becken seltsam eingeknickt, der Verfolger kerzengerade. Vollkommen ruhig und gesammelt. Langsam hob er den gestreckten Arm, brachte die Schusshand in Position.
Sekunden später spaltete grelles Mündungsfeuer die Schwärze der Nacht. Ein Geräusch war nicht zu hören.
Zufrieden nahm er das Nachtsichtgerät herunter, wickelte still vergnügt den Riemen auf, wartete auf das leise Brummen des Mobiltelefons.
Nur Atemzüge später war es soweit.
»Erledigt!«
»Bestens. Sorg dafür, dass es keine verwertbaren Spuren gibt!«
»Ist klar!«
Der Beobachter registrierte eine Unsicherheit in der Stimme des anderen, ein Stocken, eine Veränderung der Atmung. »Ist noch was?«
Sprachlosigkeit antwortete ihm.
»Nun?«, knurrte er unverhohlen drohend.
1
Die Scheinwerfer fraßen sich durch die Finsternis, die nur zögernd der Morgendämmerung Platz machen wollte.
»Herbst eben! Grau am Tag und ansonsten dunkel! Wieso fangen die eigentlich so früh mit den Arbeiten auf dem Friedhof an? Die Toten werden ja wohl kaum ungeduldig darauf warten, endlich umzuziehen!«
Verärgert erinnerte Nachtigall sich daran, warum er ausgerechnet zu dieser Zeit nach Brieskowitz unterwegs war.
Englische Woche beim FC Energie Cottbus. Die Kollegen hatten alle Hände voll zu tun, die Fans zu kontrollieren und das Stadion zu sichern. Bereitschaftspolizei aus Sachsen war schon unterwegs. Ein Spiel gegen Dresden war allemal ein explosives Event. Doch in Brieskowitz hatte es Morddrohungen gegen die Männer gegeben, die die Umbettung des Friedhofs durchzuführen hatten. Kriminalpolizei vor Ort sollte die aufgebrachten Bürger in ihre Schranken weisen, ihnen klarmachen, dass Todesdrohung kein Scherz war.
Pech! Das Los für heute Vormittag hatte ihn und Michael Wiener getroffen.
Im Rückspiegel entdeckte er ein paar Scheinwerfer.
»Noch einer, der heute früh aufstehen musste«, murmelte er.
Die grellen Lichter kamen überraschend schnell näher.
Nachtigall starrte auf die regennasse Straße, kontrollierte die Temperaturanzeige im Tacho. Weit entfernt vom Gefrierpunkt – keine Gefahr.
Die Scheinwerfer des anderen blendeten ihn und er kippte den Rückspiegel an.
»Verdammt! Wenn du unbedingt rasen willst, dann überhol’ gefälligst«, ermunterte er den Fahrer des Wagens. »Kofferraumkriecher!«
Ziemlich hochbeinig, registrierte er noch automatisch, vielleicht ein Geländewagen – da krachte es gewaltig und sein eigenes Auto wurde rüde beschleunigt.
»Idiot!«, fluchte der Hauptkommissar wütend. Umklammerte das Lenkrad noch fester.
Er setzte den Blinker, um dem anderen zu signalisieren, er wolle rechts ranfahren und den Schaden überprüfen – da bemerkte er den dunklen Wagen in seinem linken Außenspiegel.
»Aha! Jetzt versuchst du auch noch Fahrerflucht!«
Die massige Silhouette war hinter den gleißenden Scheinwerfern nur undeutlich auszumachen. Ein Touareg? Ein Q7?
Unerwartet folgte der zweite Stoß, diesmal von der Flanke.
Nachtigall steuerte gegen, sein Wagen schlingerte bockig, brach aus und schleuderte über die Fahrbahn.
»Was zum Teufel …«, keuchte er, als es ihm gelungen war, das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen. Das ist kein Versehen, wurde ihm bewusst, das ist Kalkül.
»Der Kerl will mich umbringen!«
Der Geländewagen war zurückgefallen. Offensichtlich beobachtete der Fahrer die Szene, wartete darauf, dass Nachtigall ›freiwillig‹ einen Unfall haben würde.
Der Hauptkommissar zwang grimmig seinen Wagen zurück in die richtige Spur.
Langsam schob sich der andere wieder näher.
Peter Nachtigall behielt die Lichtkegel fest im Auge. Drückte auf die Kurzwahltaste für Michael Wiener.
Gerade als hektisches Piepen das Herstellen der Verbindung anzeigte, donnerte der Dunkle mit Macht in seine Seite, katapultierte ihn von der Straße.
Wie im Zeitraffer.
Nachtigall beobachtete, wie sich der Acker unter seinem Auto durchdrehte. Spürte sein nicht unerhebliches Gewicht im Gurt, fühlte, wie das Blut in den Kopf stieg, bemerkte große Erdbrocken, die neben den Seitenscheiben aufspritzten.
Vorbei, dachte er mit tiefem Bedauern.
Deine Familie siehst du nie wieder.
Erstaunt stellte er fest, dass er auch Emile, seinen Schwiegersohn, gern wiedergesehen hätte. Wie sonderbar.
Das Wagendach landete mit einem heftigen Schlag in der Erde.
Wie seltsam, schoss ihm noch durch den Kopf, jetzt werde ich auf dem Weg zum Friedhof umgebracht. Welche Ironie!
Danach war nur noch Schwärze.
2
Die Transparente schlugen klappernd gegen die Metallstangen.
In Schmieders Ohren klang das wie die Begleitmusik der schweigenden Schaulustigen, die einer öffentlichen Hinrichtung zusehen wollten. Er hatte gelesen, was darauf stand. ›Fahrt zur Hölle‹, ›Ihr seid Helfershelfer des Bösen‹, ›Lasset die Toten ruhen‹, ›Finger weg von unseren Ahnen‹. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Schließlich machte er das hier weder gern noch freiwillig. Diese selbstgerechten Hüter des Dorfes wollten einfach nicht begreifen, dass es um seinen Job ging. Eine Weigerung und die Kündigung flatterte ins Haus, das war sicher. Statt zu akzeptieren, was eh nicht zu ändern war, schickten sie ihm, dem Totengräber, Morddrohungen.
Unfassbar.
Heute Morgen hatte er die sechste aus dem Briefkasten gefischt.
Dieses sei die letzte, hatte dort gestanden, nun würde man unweigerlich zur Tat schreiten.
Kein Witz, fand die Polizei, bei der er sofort angerufen hatte. Es kämen Beamte zu ihrer Sicherheit. Ha! Vor solch fanatischen Spinnern konnte sie niemand beschützen.
Vorsichtshalber schloss er das große Tor hinter ihnen ab, als er den skandierenden Mob näher kommen hörte.
Sie hatten hier zu arbeiten – da blieb keine Zeit für sinnentleerte Diskussionen mit aufgehetzten Dörflern.
»Muss der Herr Pfarrer sich eben bemerkbar machen, wenn er kommt. Pünktlichkeit gehört wohl nicht zu seinen Stärken«, nörgelte er, als er den Schlüssel in die Hosentasche schob.
Hannes Schmieder seufzte.
Sein Blick wanderte langsam über die Kreuze und Grabsteine seines Friedhofs.
»Mann, Mann, Mann! Irgendwie kann ich schon verstehen, dass den Leuten die ganze Aktion nicht gefällt. Ich meine, da beerdigst du deinen lieben Angehörigen, denkst, das ist für die Ewigkeit und schon nach kurzer Zeit zerren sie ihn wieder ans Licht.«
»Wieso dürfen die das denn überhaupt?«, wollte der junge Kollege wissen. »Ist doch ganz klar Störung der Totenruhe! Oder etwa nicht?« Stefan Bomme spuckte einen gelblich-grünen Schleimbatzen neben sich auf den Weg. Schmieder versuchte, nicht hinzusehen. Ihm wurde schon allein vom Anblick der ekligen Masse übel. Und den Toten gefiel so ein Benehmen sicher auch nicht.
»Sicher Sondergenehmigung!«
»Diese großen Konzerne! In diesem Staat dürfen die sich so richtig austoben. Müssen sich für gar nichts mehr verantworten und es ist niemand da, der ihnen Einhalt gebietet. Ist echt kein Wunder, wenn dieser Staat mit Mann und Maus untergeht! Ehrlich!«
Hannes hatte keine Lust auf eine Diskussion mit Stefan über Politik. Führte zu nichts.
»Von wegen ›letzte Ruhestätte‹! Pustekuchen. Wenn du dem Geld im Weg ruhst, wirst du eben einfach ausgegraben und umgetopft!«
»Ja, ja!«, murrte Schmieder, dem der Neue gehörig auf die Nerven ging. »Hier auf meiner Liste steht genau drauf, wo wir heute mit der Arbeit beginnen sollen. Warte mal – das ist …«, grübelte er und streckte dann triumphierend den Zeigefinger aus, »dort drüben!«
Bomme murrte bei jedem Schritt.
»Wenn noch mal so was auftaucht wie gestern, dann kriege ich sicher Albträume. Sah aus, als wäre der beinahe noch lebendig. Huh!«
»Wir sind erst den zweiten Tag hier!», erinnerte ihn der Ältere. »Was hast du denn erwartet? Was glaubst du, findet man auf einem Friedhof?«, fuhr er den anderen an. Diese Arbeit ist eben nichts für Sensibelchen und Weicheier, dachte er, da braucht es schon den ganzen Kerl mit extra starken Nerven.
»Aber so was? Nee, wirklich nicht!«
»Fettwachsleiche«, erklärte Schmieder ungerührt. »Gibt es in unserer Gegend häufig. Wenn der Boden nicht durchlässig ist und die Leiche immer im Wasser liegt. Dann findet eben keine Verwesung statt.«
»Öfter?« Jetzt klang Bomme zunehmend hysterisch. »Du meinst, da sind noch mehr davon? Und was ist, wenn Grabstätten aufgelöst werden?«
»Ist ein echtes Problem«, räumte der Ältere augenzwinkernd ein. »Hast du gewusst, dass der durchschnittliche Grabbesucher etwa 1.000 Liter pro Jahr beim Gießen der Blumen über die Leiche schüttet? 1.000 Liter! Dazu kommen dann noch die Niederschläge.« Er musterte den anderen prüfend, setzte dann vorsichtshalber hinzu: »Du weißt schon – Regen und Schnee.«
»Du meinst, der säuft ab?«, staunte Bomme respektlos. »Und so viel Wasser vertragen doch die Blumen gar nicht.«
»Ich würde das anders ausdrücken – aber im Prinzip stimmt’s. So! Hier fangen wir an. Ist ein ziemlich frisches Grab. Sieh mal, ist schön locker der Boden.« Schmieder hob den Spaten von der Karre. »Es geht bei der Gießerei auch gar nicht allein um die Pflege. Es ist mehr das Bedürfnis, dem lieben Verstorbenen eine Freude zu machen, Zuwendung zu zeigen. Die Leute wissen ja nicht, dass das Wasser durch den Boden in die Grube tröpfelt. Darüber denkt doch keiner nach!« Er reichte dem Jüngeren ebenfalls einen Spaten.
»Ist das echt ein frisches Grab?« Bomme beäugte den Erdhügel skeptisch.
»Nicht taufrisch. Aber jedenfalls keines von den alten.«
Eine Weile war nur das raue Geräusch der Spaten zu hören, die durch das Erdreich schnitten.
»Und verbrennen? Also, ich meine nur, wenn es gerade in eurer Gegend so ein Problem mit dem Verwesen ist, wäre das doch eine Variante.« Das Thema schien Stefan Bomme nachhaltig zu beschäftigen.
»Nee, das geht auch nicht. Wegen der Dioxine, Furane und anderer Gase.«
»Hä?«
»Das sind Gifte, die beim Verbrennen frei werden. Und wenn du nun alle kremierst, wird auch jede Menge davon in die Luft abgegeben. Außerdem muss man ja auch den Gasverbrauch bedenken.«
Bomme grunzte nur.
Von nun an herrschte Schweigen beim Arbeiten.
Hannes war zufrieden. Er hatte es gern ruhig.
Als sein Spaten auf einen Widerstand stieß, meinte er trocken: »So, nun müssten wir es gleich geschafft haben. Tja, sieht so aus, als hätten wir wieder mal den Deckel durchstoßen.« Zu seinem Kollegen gewandt setzte er hinzu: »Hol doch schon mal eine von den Kisten. Ich lege hier alles frei.«
Stefan Bomme trollte sich.
»Nun bleibt der Kerl sicher wieder ewig weg! Muss noch schnell eine rauchen, eine SMS an die Freundin schicken und seine Mails checken«, knurrte Schmieder dem sich entfernenden Rücken nach.
Den nächsten Stich führte er oberflächlicher aus.
Nach zwei weiteren starrte er verwundert auf das, was zwischen seinen Beinen lag.
»Da wird er aber staunen, der Kleine. Fettwachs ist das nicht! Der ist frisch!«
3
Michael Wiener musste hilflos mit ansehen, wie der Wagen vor ihm den vorausfahrenden von der Straße drängte.
»Spinnsch du?«, brüllte er. »Du wirsch den andere noch umbringe! Ist ja wie im Film!« Mit brennenden Augen stierte er auf den dunklen Wagen, dem die Zusammenstöße mit dem wesentlich kleineren Fahrzeug nicht das Geringste anzuhaben schienen.
»Hier fährt ein Verrückter vor mir!«, schrie Wiener in sein Funkgerät. »Ein Streifenwagen sollte ihn in entgegenkommender Fahrtrichtung stoppen. Bin auf dem Weg von Cottbus nach Brieskowitz. Der Fahrer versucht das vorausfahrende Auto von der Straße zu drängen. Vielleicht eine Trunkenheitsfahrt!« Er gab das Kennzeichen durch.
»Okay, wir versuchen, ihn zu stoppen und machen eine Halterabfrage«, schnarrte es zurück.
Erst in dem Augenblick, in dem der kleinere Wagen durch die Luft geworfen wurde, erkannte Wiener das Fahrzeug.
»Oh Gott! Das isch ja Peters Auto!«
Der SUV startete durch, wirbelte Wasser auf, als wolle er in einer Nebelwolke untertauchen.
Wiener hielt mit quietschenden Reifen am Straßenrand.
»Peter!«
Nachtigalls Wagen qualmte ein gutes Stück entfernt von der Asphaltpiste.
»Rettungswagen! Schnell!«
Er rannte los, das Handy mit offengehaltener Leitung in der Hand.
»Peter!«
»Er antwortet nicht!«, schrie er verzweifelt dem Leiter der Rettungsstelle zu.
Keuchend erreichte er den Wagen, der wie ein schutzlos ausgelieferter Käfer auf dem Rücken lag – die Räder quirlten sich noch immer durch die Luft.
Das Handy landete in einer Ackerfurche.
Energisch zerrte der junge Mann mit beiden Händen an der Fahrertür. Endlich! Widerstrebend ließ sie sich öffnen. Er tastete in der Jacke nach der scharfen Gurtklinge und durchschnitt das Band, das sich über den Oberkörper des Freundes spannte. Schluchzend – was ihm gar nicht bewusst wurde – bekam er Nachtigall zu fassen und zog ihn aufs Feld.
»Peter! Bitte!«, flehte er, fühlte, wie ihm der Boden unter den Füßen verlorenging, er im freien Fall ins Nichts stürzte.
»Peter!« Er schlug dem Freund kräftig ins Gesicht. »Peter!«
Stabile Seitenlage, fiel ihm plötzlich ein. Mit Mühe gelang es ihm, den schweren Körper auf die linke Hälfte zu ziehen.
»Welches Bein muss ich jetzt anwinkeln?« Michaels Denken war blockiert.
Erst Albrecht und jetzt Peter. Das darf nicht sein, kreiste hinter seiner Stirn.
»Wo bleibt denn der verdammte Notarzt?« Ein gewaltiges Zittern lief durch Wieners Körper, jeder Versuch die Kontrolle wiederzugewinnen scheiterte.
»Was soll ich denn nun machen?« Er hatte das Handy wiedergefunden.
»Tasten Sie mal nach seinem Puls«, wies ihn die Stimme ruhig an.
Wieners bebende Finger flatterten über Nachtigalls Hals.
»Nichts!«, informierte er seinen gesichtslosen Gesprächspartner. Nichts, hallte es in seinem Kopf nach, nichts, nichts, nichts.
»Das glaube ich nicht. Ganz ruhig, Kollege. Strecken Sie mal Ihren Arm aus, beugen Sie ihn wieder und dann versuchen Sie es erneut.«
»Nichts!«, wiederholte Wiener ohne jede Hoffnung.
Als er die zuckenden Blaulichter sah, stand er auf und trat zur Seite.
Stumm.
Jetzt erst bemerkte er, dass er weinte.
Er verzichtete darauf, die Tränen abzuwischen.
Und ich habe dabei zugesehen, dachte er gebetsmühlenartig, ich habe dabei zugesehen …
Nur von fern nahm er die Menschen wahr, die über das Feld gerannt kamen.
Zu spät, viel zu spät.
Aktivitäten entwickelten sich.
Wieners Verstand klinkte sich aus.
Langsam, als müsse er vor jedem Schritt überlegen, wie Laufen funktionierte, setzte er sich in Bewegung, kehrte zu seinem eigenen Wagen zurück.
»Habt ihr den Kerl?», erkundigte er sich matt über Funk.
»Nein. Der muss sich zwischen hier und da in Luft aufgelöst haben! Wie geht es Nachtigall?«
Wiener verzichtete darauf, die Frage zu beantworten.
Ich bin der ganze Rest unserer Ermittlungsgruppe, fiel ihm plötzlich ein.
Was nun? Weiterfahren zu diesem Friedhof, der umgefriedet werden sollte, um die Totengräber vor den Bürgern zu schützen? Bleiben? Bis man Peter …?
Er barg das Gesicht in den Händen.
Jemand klopfte ihm ungeschickt auf die Schulter.
Er sah nicht auf.
»Na, sieht so aus, als müsstest du uns beide fahren. Erst mal zu diesem Friedhof, dann ins Klinikum. Geht’s wieder – können wir?«, fragte eine Stimme durch das heruntergelassene Fenster.
Wiener starrte beharrlich in den Fußkasten und schüttelte den Kopf. Alles war unwichtig.
»Das ist schlecht. Mein Auto ist nämlich nicht mehr fahrtüchtig – und ich auch nicht.«
Wiener wandte sich um.
»Peter! Mein Gott! Und ich han scho denkt …«
Die Erleichterung trieb dem jungen Mann erneut die Tränen über die Wangen.
»Ich hoffe, du weinst jetzt nicht, weil du mich doch nicht losgeworden bist«, brummte Nachtigall gerührt.
Ächzend ließ er sich auf den Beifahrersitz fallen.
»Ich bringe dich sofort ins Klinikum! Zum Friedhof fahre ich allein.«
»Es ist nicht viel passiert, Michael, ehrlich. Ein Schlag auf den Hinterkopf, ein bisschen ausgeknockt und leider den Arm etwas lädiert.«
Er wies den stabilisierenden Verband vor.
»Ausgerechnet Dr. Manz! Mein spezieller Freund an Tatorten! Na ja. Er hält es für möglich, dass der Arm gebrochen ist. Wir werden ja sehen.«
»Aber du hattest keinen Puls!«
»Doch. In der Aufregung hast du den bloß nicht gefunden!«, meinte Nachtigall verständnisvoll.
Wiener startete mit zitternden Fingern den Motor.
»Das war ein Mordversuch! Ich hab elles gesehe! Peter, ich dachte wirklich, du bist …«
»Scheißgefühl!«, knurrte der Hauptkommissar. »Haben wir den Kerl?«, fragte er finster.
Michael Wiener fuhr langsam.
Er misstraute seiner Konzentrationsfähigkeit.
»Nein. Der ist mitten auf der Strecke verdampft.«
4
Hannes Schmieder pfiff durch die Zähne. So etwas – noch nie in seinem ganzen langen Arbeitsleben war ihm das untergekommen!
Bomme wäre vor Schreck beinahe auch noch in die Grube gefallen. In letzter Sekunde war es ihm gelungen, seinen Oberkörper zurückzureißen und nach ungeschicktem Schwanken unsanft auf dem Steiß zu landen.
»Ist der tot?«, keuchte er heiser.
»Ja, was soll er wohl sonst sein?« So ein kompletter Idiot, dachte der Ältere wenig nett über seinen Kollegen. »Lagen doch fast zwei Meter Erde auf ihm!«
»Und was machen wir nun?«, fragte Bomme und kratzte sich am Haaransatz unter der Wollmütze.
»Polizei! Ist doch klar!« Schmieder kontrollierte die Uhrzeit. »Komisch. Eigentlich wollten die doch längst da sein!«
Ein Auto hielt vor der Friedhofsmauer.
»Das sind sie wohl. Lauf mal vor und schließ ihnen das Tor auf. Können wir sie ja gleich mit unserem Fundstück bekannt machen!«
»Wie sehen Sie denn aus?«, entfuhr ihm wenig später, als die beiden Cottbuser Kriminalbeamten auf ihn zukamen. »Üble Kneipenprügelei mit Schlammschlacht?«
Wiener und Nachtigall sahen an sich hinunter. Die Modderspuren hatten sie in der Aufregung gar nicht bemerkt. Auf der schwarzen Kleidung, die beide mit Vorliebe trugen, hoben sie sich mit schreiender Deutlichkeit ab. Nachtigalls Statur, fast zwei Meter hoch und etwas zu üppig um die Mitte, bot besonders viel Fläche. Unwillkürlich tastete der Hauptkommissar nach seinem Zopf, um zu erfühlen, ob der womöglich durch den Schlamm bretthart nach hinten abstand.
»Unfall – vor einer halben Stunde etwa.«
»Ach du Schreck! Sie hatten einen Autounfall? Hm. Na ja, das Auge verwandelt sich in ein prächtiges Veilchen und wenn Sie mich fragen – der Arm … also die Hand sieht so aus, als wäre der Arm gebrochen. Hatte ich auch mal.«
»Mag sein«, tat Nachtigall die Besorgnis des Totengräbers ab. »Es wird mich nur wenig bei meiner Arbeit beeinträchtigen. Und«, setzte er gutmütig hinzu, »ich muss ja nicht graben.«
»Da wäre ich mir jetzt gar nicht mal so sicher!«, orakelte Bomme düster. »Da hinten in dem Grab liegt einer!« Wieso unterhalten die sich über solche Belanglosigkeiten, wenn nur wenige Schritte entfernt eine Leiche liegt, dachte er missbilligend, das kann doch nicht wahr sein!
Nachtigall sah ihn fragend an. »Da liegt einer? Aber ist das nicht der Grund dafür, dass Sie beide hier graben?«
»Ja, doch. Sicher! Dort drüben, in dem Grab, bei dem wir heute angefangen haben – da liegen zwei, wo nur einer sein sollte«, klärte Schmieder die beiden Kripobeamten auf.
Nachtigall trat an das ausgehobene Loch, kämpfte mit einem leichten Schwindelgefühl.
»Ich sehe, was Sie meinen«, murmelte er dann überrascht. »Michael, wir brauchen ein Tatortteam.«
Wiener warf ebenfalls einen Blick in das Grab, nickte, trat beiseite und begann aufgeregt zu telefonieren.
»Das war ein relativ frisches Grab, nicht wahr?«, erkundigte sich der Hauptkommissar.
»Ja«, bestätigte Schmieder. »Vor ein paar Monaten war die Beisetzung. Gestorben am 5.7., um genau zu sein. Dann muss die Beisetzung so etwa drei Tage später stattgefunden haben.« Dabei zeigte er auf das Holzkreuz, das sie heute Morgen entfernt hatten.
»Wussten die Menschen im Dorf damals nicht schon, dass der Friedhof umgebettet werden muss?«
»Ach ja. Wissen ist ja nur das eine – Hoffen kann man damit nur ganz schwer ausrotten.«
»Das mag schon richtig sein«, grübelte Nachtigall laut. »Aber wenn jemand aus dem Ort eine Leiche hier versteckt, muss er eine verdammt große Portion Hoffnung gehabt haben. Kennen Sie den Mann?«
»Der liegt auf dem Bauch. Alles voller Erde. Vielleicht wenn wir ihn mal eben umdrehen …«
Der Totengräber machte Anstalten, wieder in die Grube zu springen.
»Halt, halt!« Der Hauptkommissar hielt ihn mit dem unverletzten Arm zurück.
»Wieso? Bis gerade war ich doch auch drin.«
»Stimmt schon. Aber jetzt ist es ein Leichenfundort. Ab sofort darf hier nur noch die Polizei rein- und rausklettern.«
»Aha!« Schmieder schüttelte unwillig den Kopf.
»Der Trupp kommt gleich«, verkündete Wiener, der gehetzt wirkte. »In einer halben Stunde etwa.«
»Ach? Und was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Däumchen drehen?«, quengelte Stefan Bomme, der um seinen pünktlichen Feierabend fürchtete.
»Verabredet, wie?«
»Und wenn? Wie geht es nun weiter?«
»Weitergraben?«, schlug Schmieder grinsend vor.
»Ich denke, wir dürfen nicht!«
»Nur hier nicht – wenn ich das richtig verstanden habe. Beim übernächsten Nachbarn dürfen wir bestimmt.«
Nachtigall nickte. »Geben Sie vier Gräber als Nahtzugabe. Dann kommen wir uns bei der Arbeit sicher nicht in die Quere.«
»Na, los!« Schmieder gab dem Jüngeren mit dem Griff des Spatens einen rüden Stoß in die Seite. »Nix wie ran!«
Lustlos trollte sich Bomme, um die Schubkarre zu holen.
Nach kurzer Zeit war das unangenehme Knirschen der in die Erde stoßenden Spaten wieder das einzige Geräusch, das die Friedhofsstille störte.
»Ein beinahe frisches Grab. Kaum vier Monate alt. Ist doch eigenartig. Entweder hat derjenige, der ihn hier deponierte, nichts von der geplanten Umsetzung der Gräber gewusst oder wollte diesen hier nach angemessener Zeit wieder abholen und anderswo unterbringen.«
»Diese Schinderei – zweimal? Das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Da hätte er doch mit Sicherheit eine zugänglichere Stelle finden können«, widersprach Wiener.
»Vielleicht musste es schnell gehen.« Doch nach einem weiteren Blick auf das Opfer revidierte Nachtigall mit gerunzelter Stirn seine Meinung. »Na, ja. Wenn ich es genau bedenke, dauert es sicher ziemlich lang, all die Erde aus dem Grab zu schaufeln. Außerdem muss er nachts gegraben haben – tagsüber hätten ihn wahrscheinlich Angehörige überrascht.«
Sonne, Meer, Strand.
Er freute sich unbändig, dem heranziehenden schlechten Wetter zu Hause entkommen zu sein. Was für eine wunderbare Fügung des Schicksals, dass nun gerade er das Los gezogen hatte! Also war er ins Paradies beordert worden. Eine ganze Woche Afrika!
Er würde jede Sekunde davon in vollen Zügen genießen.
»Benehmen Sie sich wie ein ganz normaler Tourist«, hatte die raue Stimme gefordert. »Wir werden zu gegebener Zeit von uns aus Kontakt mit Ihnen aufnehmen.«
Wie ein normaler Tourist, frohlockte seine innere Stimme, nichts leichter als das. Schließlich bin ich einer.
Nach der Zwischenlandung in Gran Canaria ging’s mit einer kleineren Maschine weiter.
An der afrikanischen Küste entlang.
Sand, so weit das Auge reichte.
Vier Stunden später setzte das Flugzeug sanft auf.
Wie ihm schien, mitten in der Wüste. Ein betagtes Vehikel, das allgemein als Bus bezeichnet wurde, brachte ihn und die anderen Touristen auf den Weg nach Santa Maria. Scheppernd und quietschend fraß der Kleintransporter Kilometer um Kilometer der erstaunlich gut ausgebauten Strecke.
»Die anderen Straßen, auf denen Sie vielleicht während Ihres Aufenthalts noch entlang fahren werden, sind natürlich in einem gänzlich anderen Zustand. Meist sind es nur festgefahrene Sandpisten, staubig und wenig komfortabel«, informierte die Reisebegleiterin ihre Kunden.
»Eine weitgehend unbewohnte Insel. Und was gibt es hier? Einen Kreisverkehr nach dem anderen!«, flüsterte er der Scheibe zu, die die Hitze nicht draußen zu halten vermochte. Schicht um Schicht zog er aus, bis nur noch das dünne T-Shirt übrig blieb.
»Bei Ihnen zu Hause in Deutschland regnet es heute«, kommentierte die Reiseleiterin schadenfroh. »Freuen Sie sich auf eine sonnige Auszeit hier bei uns.«
Die Sprache würde ein Problem werden. Logisch! Das hatte er nicht anders erwartet.
Überall gab es plötzlich nur noch Schwarze, die weder Deutsch- noch Englischkenntnisse hatten. Man sprach Kreolisch, die Sklavensprache, ein Gemisch aus den unterschiedlichsten afrikanischen Dialekten – und Portugiesisch. Auch bei noch so intensivem Hinhören war für ihn nicht ein Wort zu verstehen. Er konnte, nachdem er vor ein paar Jahren einen Volkshochschulkurs besucht hatte, leidlich Englisch.
Irgendwie würde er schon klarkommen.
Unerwartet spürte er so etwas wie Einsamkeit in sich aufsteigen. Heimweh?
Quatsch, schimpfte er in Gedanken mit sich, das kann ja wohl nicht sein, du bist ja erst seit ein paar Stunden aus Deutschland weg!
An der Rezeption des Hotels die nächste Überraschung: Auch hier beherrschte niemand gut Englisch.
Antworten oder Erklärungen der Mitarbeiter führten zu fragenden und ratlosen Blicken der Gäste. Zum Glück konnte die Reiseleiterin die ersten Hürden nehmen helfen. Irgendwann reichte ihm die junge Frau, die ihm sofort wegen ihrer kunstvollen Frisur aufgefallen war, lächelnd seinen Zimmerschlüssel und eine Plastikkarte.
Mit Mühe verstand er, dass er diese Karte mit Geld aufladen und dann zum Bezahlen im Hotel benutzen könnte.
Wie praktisch! Kein Bargeld an Pool und Strand.
Afrika!
Im Grunde hatte er es sich völlig anders vorgestellt.
Das Zimmer picobello aufgeräumt. Minibar und Klimaanlage liefen einwandfrei. Die Bettwäsche war so weiß, dass es direkt den Augen wehtat. Afrika?
Na, ja. Erst mal abwarten, wie das Essen schmeckt!
Träge fiel er auf sein Bett.
Wartete eine Weile darauf, dass sich sein Kontaktmann melden würde, schlief fast zwei Stunden und entschloss sich dann, zum Strand hinunterzugehen.
Überwältigend.
Breit, feinsandig, wundervoll.
Nicht zu überbieten.
Das Meer: Blau, türkis und dunkelgrün brandete es ungezähmt und hungrig über den Sand. Aggressiv bewies es jedem seine Kraft, drohte, alles in die Tiefe zu zwingen. Der permanente Wind peitschte es auf, blies Sand gegen die nackten Beine der Besucher. Das hatte den Effekt von Schmirgelpapier.
Er war beeindruckt.
Auch von dem Wachmann, der am Tor zur Beach Posten bezogen hatte.
In der sengenden Sonne, in schwarzer Uniform und unübersehbar bewaffnet.
5
»Einen forensischen Archäologen brauchen wir hier wohl nicht mehr«, stellte Peddersen lapidar fest, als er mit seinen Leuten am Fundort eintraf.
Der Fotograf grätschte durchs Gelände, versuchte die Auffindesituation aus jedem nur denkbaren Blickwinkel festzuhalten. Am Ende stellte er das Stativ direkt an der Grube auf, holte einen extralangen Maßstab aus seinem Wagen und machte weitere Aufnahmen.
»Ziemlich frisches Grab. Ich nehme an, dem Täter ist gelungen, seine Sondergrabung gut zu verbergen?«
»Ja. Ist ja auch nicht so schwierig. Wenn du dir überlegst, wie viele Kränze und Blumen manchmal auf so einem Grab liegen.« Wiener kämpfte gegen das Brennen hinter seinen Augen an. Er mochte lieber nicht mehr in diese Grube sehen – auf den Toten, den Sarg. Schließlich war es noch kaum zwei Stunden her, da hatte er befürchtet, in wenigen Tagen am Grab seines Freundes stehen zu müssen.
»Aber es war doch nicht nötig, den ›Neuzugang‹ so tief zu begraben.« Nachtigall stützte den verletzten linken Arm unauffällig mit der Hand, legte die Stirn in dicke Falten. »Wer auch immer – er hat die Erde bis auf den Sarg hinunter ausgehoben. Wozu? Der halbe Weg hätte doch auch gereicht.«
»Meinst du, der war am Ende noch gar nicht tot?«, flüsterte Michael Wiener entsetzt. »Der Täter hat Berge von Erde auf ihn gehäuft, damit er sich nicht mehr befreien kann?«
»Denkbar. Das findet der Rechtsmediziner raus.«
Dr. Manz, Notarzt, warf Nachtigall im Vorbeigehen einen bösen Blick zu.
»Aha. So sieht es also aus, wenn Ihnen der Notarzt am Unfallort rät, nach Hause zu fahren. Sie sollten den Arm …egal. Er wird gebrochen sein, Sie haben eine nette Gehirnerschütterung. Aber ist in Ordnung, Sie sind ein erwachsener Mann! Ihre Entscheidung.« Danach stapfte er zornig weiter.
»Wieso holt man eigentlich mich? Hier braucht man keinen Notfallmediziner mehr! Der Mann ist schon seit Tagen tot«, hörte man ihn wenige Schritte später protestieren.
»Sie waren doch vor Ort. Und wir brauchen jemanden, der uns schnell und kompetent ein paar Fakten nennen kann. Womit haben wir es hier zu tun? Mord? Suizid – und jemand hat die Leiche nur verschwinden lassen? Kaum einer kann das so gut wie Sie«, behauptete Peter Nachtigall mit unergründlichem Blick.
Der Mediziner sprang in die Grube hinunter.
Fluchte.
»Auf einem Sarg habe ich auch noch nie gestanden! Sie verlangen die unmöglichsten Dinge von mir!«, beschwerte er sich.
Betrachtete interessiert den Körper.
Der Mann lag auf dem Bauch, das linke Bein angewinkelt, das andere gestreckt. Die Arme befanden sich in einer für Lebende durchaus bequemen Position, die Hände knapp über Schulterhöhe.
Bekleidet war der Tote mit einer Sommerjeans und einem T-Shirt, das seitlich hochgerutscht war und so den Blick auf die Rückenpartie freigab. Schuhe oder Strümpfe waren nicht zu sehen.
»Wir brauchen eine Plane, an der man seitlich Seile befestigen kann. Hier unten kann ich nichts sehen!«
Während sich einige Beamte auf die Suche nach einem geeigneten Hubsystem machten, begann Dr. Manz damit, die verbliebene Erde von der Leiche zu streichen.
»Was wollten Sie noch mal genau wissen?«
»Unfall, Suizid, Mord?«
»Ach ja, das war’s. Ich kann ausschließen, dass dieser Mann Opfer eines Unfalls wurde. Suizid scheidet wohl ebenfalls aus.«
»Das ging aber schnell!«, staunte Peter Nachtigall.
»So schwierig war es nicht. Er hat das Kabel noch um den Hals!«, rief der Arzt aus der Tiefe. »Es handelt sich um ein flaches Stromkabel, schwarz, ohne Schalter – wenn ich das richtig sehe. Es liegt locker um den Hals. Vielleicht hatte der Täter beide Enden gepackt und zugezogen – nach der Tat legte er sie lose zusammen.«
Ein schwarzer Leichensack wurde hinuntergereicht.
»Soll ich ihn wirklich …? Nicht, dass es später Ärger mit Ihrem Gerichtsmediziner gibt.«
»Wir müssen wissen, um wen es sich handelt. Dazu brauchen wir einen Blick in sein Gesicht. Sehen Sie irgendwelche Insekten in der Nähe? Die müssten wir natürlich einsammeln.«
»Sie glauben doch nicht, dass diese kleinen Aasfresser noch hier sind! Nachdem jemand die ganze schützende Erdschicht entfernt hat? Licht – und sei es noch so wenig – mögen die nicht. Ich fürchte, diese Fressstelle hat deutlich an Attraktivität verloren«, grunzte Dr. Manz und hob gleichzeitig das T-Shirt ein wenig an, um nachzusehen, ob sich einige Insekten vielleicht dorthin geflüchtet hatten. »Nichts zu sehen«, stellte er fest.
Nachtigall glaubte Enttäuschung in seiner Stimme ausmachen zu können.
Vorsichtig rollte Dr. Manz den Leichnam in den Kunststoffsack.
Danach führte er Seile darunter durch, und vier Beamte hievten den Körper aus der Grube.
Etwas ungeschickt folgte auch der Arzt über die Leiter. Der Sack wurde zwischen die Gräber bugsiert und Dr. Manz zog den Reißverschluss auf.
Nachtigall schlug der Geruch des Todes entgegen.
Er bemühte sich darum, den Atem flach zu halten, starrte in das grün-bläulich verfärbte Gesicht eines noch Namenlosen.
»An Ihrer Seite treffe ich wirklich auf die seltsamsten Patienten«, murrte der Notarzt. »Wie gesagt, dieser hier ist nicht mehr ganz frisch, er muss schon seit einigen Tagen tot sein. Das sehen Sie schon an der seltsamen Farbe. Fäulnis! Hier ist auch schon ein Pilzrasen! Schimmelpilze, nehme ich an.«
Er ging in die Hocke, schielte mit einem Auge nach dem Hauptkommissar.
»Seien Sie froh, dass wir an der frischen Luft sind. Der Rechtsmediziner arbeitet im Gebäude und die Lüftung …«
»…schafft es nie! Ich weiß!« Peter Nachtigall hörte das leichte Zittern in seinem Tonfall. Ihm war übel. Um ein Haar wäre ich jetzt von diesem Zustand auch nicht weit entfernt, schoss ihm durch den Kopf. Er schüttelte sich, um diesen quälenden Gedanken zu verscheuchen – was den Schmerz im Arm verschlimmerte. Ich lebe noch!, registrierte er selig, von den Umstehenden unbemerkt.
Dr. Manz schob seine Brille auf die Nasenwurzel.
»Hier, das ist das Kabel. Sehr praktisch – er hat an die Enden kleine Holzstäbchen als Knebel geknotet. So kann man es besser halten. Ist ja ziemlich schlüpfrig sonst. Und das Anziehen wird natürlich auch erleichtert. Liegt einfach besser in der Hand.«
»Wollen Sie vielleicht umsatteln, Dr. Manz? Wir könnten bei Dr. Pankratz ein gutes Wort für Sie einlegen«, schlug Michael Wiener vor.
»Ach! Und wer klammert dann die Platzwunde am Kopf Ihres Kollegen, wenn ihn das nächste Mal einer in den Acker scheucht? Nee, auf meine Dienste im Notfallwesen können Sie gar nicht verzichten«, gab Dr. Manz grinsend zurück.
»Da haben Sie auch wieder recht«, räumte der Hauptkommissar gutmütig ein. »Also: Mord, er wurde erdrosselt, Tatwaffe ist vermutlich das Kabel um seinen Hals und es ist nicht erst gestern passiert.«
»Genau. Ich weiß sogar, dass er nicht länger als 14 Tage tot sein kann.«
Nachtigall sah den Mediziner verblüfft an.
»Na – das ist Heiner Lombard!«, erklärte Dr. Manz in einem Ton, als müsse jeder diesen Namen kennen.
»Hä?« Auch Wiener konnte damit wohl nichts anfangen.
»Heiner Lombard! Der ehemalige ›Pressesprecher‹ der Gruppe ›Wir sind keine Kohleopfer‹. Die organisieren doch seit Jahren eine Kundgebung nach der anderen, weil sie die Abbaggerung verhindern wollten. Aber nun ist es ja zu spät.«
»Klar, jetzt fällt es mir ein! Den habe ich oft genug bei Interviews im rbb gehört und einmal auch gesehen. Ist schon eine ganze Weile her – bei ›Brandenburg aktuell‹«, erinnerte sich Wiener.
»Ja. Und dem Grabstein nach zu urteilen, lag er auf dem Sarg seines Vaters.«
»Eine Art Familienzusammenführung?«, wunderte sich Wiener.
»Nee«, widersprach Nachtigall, »hier auf dem Kreuz steht ein völlig anderer Name!«
Dr. Manz seufzte genervt. »Ja. Lombard war der Name von Heiners Frau. Die Ehe hatte kein halbes Jahr Bestand. Seine Eltern heißen John. Tja, der Vater hat das viele ›Schachtwasser‹ nicht überlebt.«
»Schachtwasser?« Nachtigall schüttelte ratlos den Kopf.
»Das müssten Sie aber eigentlich noch wissen! Die Bergarbeiter bekamen früher einen Teil ihres Lohns als Schnapskontingent. Ein übles Gesöff. Nicht jede Leber war über eine solche Dauerspülung glücklich«, stellte der Arzt flapsig fest.
»Aha. Und dieser Schnaps hieß Schachtwasser?« Traurig dachte Michael Wiener daran, dass er diese Frage jetzt nicht zu stellen bräuchte, wäre Albrecht Skorubski noch in ihrem Team. Dem älteren Kollegen waren all diese Dinge geläufig gewesen.
»Na ja, Schachtwasser war die Bezeichnung, die die Bergmänner ihm gegeben haben.«
»Nein«, knurrte Nachtigall. »Die meisten haben ihn ›Kumpeltod‹ genannt.«
»Ach ja? Nun, das war wenigstens eine treffende Bezeichnung, nicht wahr?« Dr. Manz stellte die Todesbescheinigung aus, reichte sie an Nachtigall weiter und steckte den Stift wieder ein.
»Unnatürlicher Tod. Wir müssen also Dr. März anrufen.«
»Ich muss weiter. Besser Ihr Rechtsmediziner packt ihn aus – und sicher wollen die Techniker auch noch ran.« Damit schloss der Arzt den Reißverschluss wieder, das Gesicht verschwand. »Viel Kleidung trägt er ja nicht gerade.«
»Stimmt. Vielleicht liegen Schuhe und Strümpfe tiefer im Grab«, murmelte Nachtigall dumpf. »Wir suchen danach.«
6
Die großen Metallschaufeln gruben sich mit ihren langen Krallen tief in den sandigen Boden.
Hier sollte ein Anbau an die Blutspende sowie ein Parkplatz für Mitarbeiter und Besucher des Carl-Thiem-Klinikums entstehen.
Joachim Bauers Tochter arbeitete als Krankenschwester in einem der gelben Gebäude – er ließ seinen Blick an der Fassade entlanggleiten. Sinnlos, er wusste nicht wo.
Er hob die Schaufel an, drehte seine Kabine auf dem Fahrwerk und kippte das Gemisch aus Sand, Erde und Bauschutt auf die Ladefläche eines Lasters.
Schwang den Fahrersitz wieder zurück.
Bauer genoss es!
Er betätigte gern all die Hebel, die den Koloss in Schwung brachten, beherrschte die Feinabstimmung so perfekt, dass die Kollegen manchmal sprachlos zusahen, wie er die kniffligsten Aufgaben löste.
Wieder biss die Schaufel ein großes Stück aus dem Boden.
Er füllte die Kippfläche des LKWs.
Alles eingespielte Abläufe.
Beim nächsten Mal allerdings änderte sich die Situation von Grund auf: Statt tief einzutauchen, rumpelten die Krallen über einen unerwarteten Widerstand.
Klong!, hörte Bauer.
Stoppte jede Bewegung sofort.
Das kannte er nur allzu gut. Dieses Geräusch bedeutete immer Ärger. Wirklich immer!
Auch die Kollegen in der Nähe hatten es mitbekommen.
Metall auf Metall.
»Scheiße!«, fluchte Bauer und sprang aus der Kabine.
»Könnt ihr was erkennen?«, fragte er die Männer, die am Rand des Lochs die Hälse reckten. Auch der Baggerführer bemühte sich, wollte sehen, auf was er da in der Tiefe gestoßen war – doch vergeblich.
»Vielleicht ein alter Kühlschrank!«, witzelte Bernd und Florian lachte: »Na, ein Trabbi kann’s jedenfalls nicht sein! Zu wenig Metall!«
Angespannt zog Bauer sein Handy aus der Tasche am Knie seiner Cargohose. »Chef, wir haben da ein komisches Geräusch gehört. Ja! Beim Versenken. Ich denke, Sie sollten lieber schnell herkommen!«
Amadeus Winzer hatte offensichtlich keine Zeit verloren.
Eine Viertelstunde später schon stand er zwischen seinen Arbeitern, starrte in die Grube und konnte genauso wenig erkennen wie seine Männer.
»Metall? Sicher?«
»Ja, absolut.« Bauer war inzwischen ziemlich blass um die Nase. Er ahnte wohl als Einziger, was da unten lauerte.
»So! Also von hier ist nichts zu sehen!« Winzer, drahtig, trainiert, voller Energie und unerschrocken, sprang mit einem Satz in das Loch.
Bauer hielt den Atem an. War der Kerl denn vollkommen verrückt geworden? Der hatte doch auch Frau und Kind zu Hause, da konnte er doch nicht …
»Vorsicht!«, keuchte er. »Das Ding könnte echt gefährlich sein!«
Schweigend beobachteten die Versammelten ihren Chef, der systematisch die Grube absuchte.
»Wenn es jetzt knallt, gehen wir alle drauf!«, flüsterte Joachim Bauer und dachte an seine Simone und die drei Kinder, spürte, wie die Angst in seinen Eingeweiden wühlte.
»Hab ich noch nie gehört, dass es knall macht, wenn man eine vergrabene Waschmaschine ausbuddelt«, grinste Bernd.
»Ach! Ist besser, du hältst dein Maul!«, beschied ihm Bauer. »Wetten, das ist keine Waschmaschine? Das ist ein explosiver Gruß aus Kriegszeiten!«
Bernds Grinsen wirkte plötzlich erfroren.
Amadeus war wenig erfreut.
Als sich ihm helfende Hände entgegenstreckten, war die steile Zornesfalte über der Nasenwurzel nicht zu übersehen.
»Hat zufällig einer von euch die Nummer vom Kampfmittelräumdienst?«, knarrte er grantig. »Wir müssen denen Bescheid geben. Keine Ahnung, was für ein Baby das ist, aber weiterarbeiten können wir hier erst mal nicht.«
Er teilte seinen Leuten andere Aufgaben zu.
Einige murrten unwillig. Die meisten trollten sich kommentarlos.
»Wenn wir wissen, was genau da schläft, sehen wir weiter.« Besorgt wanderten seine stahlblauen Augen über die Fassade des Klinikums. »Ist ein ziemlich großes Ding. Wenn wirklich evakuiert werden müsste, würde das ganz schön Action geben. Sind doch sicher mehr als 1.000 Kranke, die dann verlegt werden müssen.«
Eine Stunde später herrschte gespanntes Schweigen an der Fundstelle. Sprengmeister Jan-Dirk Pfitzner hockte vor dem Metallkörper, den er sehr vorsichtig, beinahe andächtig, freigelegt hatte. Er betastete ihn an den unterschiedlichsten Stellen, nutzte allerhand seltsam anmutende Technik, klopfte ein paarmal sanft gegen die Außenhaut.
Bauer beobachtete das Treiben neugierig.
Ein ganzes Team war angerückt. Es wurde heftig diskutiert.
Amadeus Winzer tigerte derweil ungeduldig am Rand entlang und sah aus, als wolle er im Minutentakt nachfragen, wie und wann die Arbeiten denn nun weitergehen sollten.
Pfitzner beriet sich mit seinem Team. Sie gestikulierten wild.
Sieht nicht gut aus, dachte Bauer, zu ernste Gesichter.
»Herr Winzer?« Jan-Dirk Pfitzner war so behände aus dem Loch geklettert, als sei das seine liebste tägliche Übung, und winkte den Chef des Bautrupps zu sich heran.
»Tut mir leid, die Bombe hat einen funktionsfähigen Zünder. Und – den kann ich nicht einfach so ausbauen. An eine kontrollierte Sprengung ist nicht zu denken – es müssen zuvor umfangreiche Maßnahmen getroffen werden, bevor man die Bombe abtransportieren kann.«
Winzers Miene verdüsterte sich. Umfangreiche Maßnahmen – das klang in seinen Ohren nach erheblicher Verzögerung der Arbeiten.
»Aha. Wie geht es denn nun weiter?«
»Es handelt sich um eine 50-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich werde versuchen, den Zünder zu entfernen, das wäre für alle die günstigste Lösung. Wenn es gelingt, dann wird der Rest abtransportiert. Wenn nicht – dann geht das Ding hoch. Es ist eine Beutebombe, die sind unberechenbar.«
»Beutebombe? Wie? Jemand hat sie den Soldaten abgenommen und dann hier versteckt, um sie bei passender Gelegenheit wieder abzuholen? Zur späteren Nutzung?«
»Nein, nein!« Der junge Mann lächelte breit und Winzer beobachtete misstrauisch, ob daraus etwa ein Auslachen entstünde. Doch die Miene des Sprengmeisters wurde wieder ernst. »Diese Bombe wurde – wahrscheinlich von den Russen – erbeutet, mit einem neuen Zünder versehen und über Cottbus abgeworfen. Ein Blindgänger. Diese Bomben sind außerordentlich gefährlich und mit 50 Kilogramm verfügt sie über eine gewaltige Sprengkraft.«
»Und wenn sie detoniert, während Sie …?«
»Dann geht hier alles hoch.« Pfitzner wirkte völlig ruhig und entspannt, als er das sagte.
Scheißjob, dachte Winzer.
Er zuckte ergeben mit den Schultern. »Wann?«, erkundigte er sich knapp.
»So schnell wie möglich. So ein explosives Baby sollten wir nicht offen liegen lassen. Wir informieren sofort Feuerwehr und Polizei. Die veranlassen eine Evakuierung. Ich gebe Ihnen Bescheid.«
»In welchem Radius wollen Sie denn räumen lassen?«, wollte Bauer wissen, dem das Procedere gut bekannt war. Schließlich hatte er mehrere Jahre in Berlin gearbeitet. Da waren solche Funde fast an der Tagesordnung.
»Etwa ein Kilometer rund um die Fundstelle. Das wird schon nötig sein.«
»Ach du Schreck! Das ist ja fast bis zum Bahnhof! Das gibt ein hübsches Verkehrschaos.«
»Ja, das ist richtig, aber nicht zu ändern. Die Klinik wird eine Lösung suchen müssen, und es bedeutet auch, dass die Wohnhäuser evakuiert werden. An der Thiemstraße bis rüber zur Straße der Jugend. Natürlich wird auch der Straßenabschnitt hier vollständig gesperrt. Das Sichern übernimmt die Polizei.«
Als der junge Mann davonstürmte, bemerkte Bauer, dass einer aus dem Team an der Grube zurückgeblieben war.
Wohl die Wache, der wird sicher von der Polizei abgelöst, überlegte er, damit die Beutebombe nicht noch einmal erbeutet werden kann.
7
»Hat dieser junge Mann hier Familie?«
»Wenn man das so nennen will. Seine Frau hat ihn schon vor Jahren verlassen. Als ich ihn das letzte Mal besuchte, wohnte er auf einem Vierseitenhof mit gefühlten 150 Katzen als Gesellschaft. Und jung ist er auch nicht mehr. Mitte 40 schätze ich. Seit die Proteste gegen den Bergbau angefangen haben, hat er sich sehr zurückgezogen. Seine Mutter wohnt allerdings hier um die Ecke, im Ort, neben der kleinen Kirche.« Dr. Manz wies diffus nach Süden.
»Danke«, murmelte Nachtigall. »Wir fahren gleich bei ihr vorbei. Ist das ihr einziges Kind?«
»Nein, nein! Kinder sind eine ihrer Leidenschaften. Sie hatte, glaube ich, sechs. Aber nur Heiner ist in der Gegend geblieben. Die anderen leben alle mit ihren Familien im Ausland. Als das mit dem Widerstand so richtig losging, das Abbaggern zum Thema wurde, hat das wohl bei vielen gehörig an den Nerven gezerrt. Heiners Geschwister sind jedenfalls schon vor vielen Jahren so weit wie möglich von hier weggezogen.«
Dr. Manz notierte für Nachtigall die Adresse. Als er ihm den kleinen Zettel gab, musterte er ihn scharf.
»Sie sind sicher, dass es Ihnen gut geht? Sieht nämlich nicht danach aus, wenn ich das mal sagen darf! Noch sind wir hier, aber in spätestens fünf Minuten müssen Sie allein klarkommen.«
Der Cottbuser Hauptkommissar begann sich zu ärgern, nickte aber nur schlicht, um eine Diskussion zu vermeiden.
»Na gut. Ihre Entscheidung. Sie sind ja kein kleines Kind mehr«, gab der Notarzt knapp zurück. »Wir sind weg!«
»Herr Schmieder?« Nachtigall trat zu den beiden Männern, die inzwischen schwer atmend Erde aus einem anderen Grab schaufelten.
»Ja.«
»Schließen Sie das Tor immer ab? Oder war das nur eine Sicherheitsmaßnahme wegen der Demonstranten?«
»Heute war es zur Sicherheit. Aber normalerweise ist es tagsüber offen, damit die Leute ungehindert Zutritt haben. Jetzt im Herbst wird gegen 18 Uhr abgeschlossen. Es gab Anfang des Jahres hier Vandalismus, Grabsteine wurden umgestoßen und so ein Blödsinn. Jugendliche. Seither sorgt die Gemeinde dafür, dass die über die Mauer und den Zaun klettern müssen«, keckerte der Mann.
»Das bedeutet, der Mann, der die Leiche auf den Sarg gelegt hat, konnte auch nur auf diesem Weg rein. Er musste den Toten über den Zaun heben«, überlegte Nachtigall laut.
»Das ist wohl so.«
»Michael?« Der junge Mann starrte noch immer wie hypnotisiert in das geöffnete Grab.
»Hmhm. Weißt du, ich frage mich, ob der Mörder wusste, dass er sein Opfer im Grab des Vaters versenkt hat. Er hieß ja nicht Lombard.«
»Stimmt. Du meinst, wenn es Absicht war, muss er über die persönlichen Verhältnisse Bescheid wissen. Der Mörder ist vielleicht einer aus dem Ort.«
»Dann war ihm bewusst, dass man Lombards Leiche bald findet.«
Das kleine Häuschen aus dunklem Klinker lag verborgen hinter einer mannshohen Hecke, inmitten eines winzigen Gartens.
Auf ihr Klingeln antwortete niemand.
»Hallo?«, rief plötzlich eine brüchige Stimme aus dem Mansardenfenster des Nachbarhauses. »Suchen Sie Hedwig?«
»Ja, genau!«, bestätigte Michael Wiener.
»Die ist bei ihrem kleinen Liebling. Auf dem Friedhof«, wehte es zu den beiden Beamten herüber.
»Meinst du, sie hat noch mehr Kinder zu betrauern? Ein totes Enkelkind?«, flüsterte Nachtigall betroffen.
Wiener zuckte mit den Schultern. »Ich lebe ja auch nicht hier. Und Freunde aus der Ecke habe ich auch nicht. Wir werden es erfahren.«
Offensichtlich hatte die Nachbarin inzwischen erkannt, dass ihr Hinweis möglicherweise nicht verstanden worden war. Unerwartet tauchte ihre grüngefärbte Dauerwelle am Gartenzaun auf.
Eine Kittelschürze, registrierte Peter Nachtigall fast ein wenig wehmütig, die war schon zu Tante Ernas Zeiten aus der Mode. Jedenfalls hatte er sie nie eine tragen sehen.
»Seit sie ihren geliebten Lukas verloren hat, ist nichts mehr los mit ihr. Erst der Mann und dann der kleine Liebling. Das war wohl zu viel für sie. Ach, Entschuldigung, mein Name ist Hermine Schildermacher.«
»Frau Johns Mann ist im Sommer verstorben, nicht wahr? Ich habe das gerade erst erfahren.«
Michael Wiener staunte nicht schlecht. Peter musste nur freundlich lächeln. Schon war das Eis gebrochen und aus den Leuten sprudelten die Informationen.
»Ach Gott, ja! Es war nun wirklich kein schönes Sterben. Der Alkohol eben. Ist ja auch kein Wunder. Immerhin hat er fast sein ganzes Leben im Tagebau gearbeitet.«
Wiener sah ratlos von einem zum anderen. Gab es diese unheilvolle Verbindung tatsächlich, oder war die eher ein Gerücht?
»Ja – der Fluch des Kontingents. Trinkschnaps. Aber nach der Wende gab es das ja nicht mehr.«
»Zum Glück. Dieses Schachtwasser hat so vielen Kumpeln Unglück gebracht. Und die arme Hedwig musste das all die Jahre ertragen. Erst den besoffenen Ehemann, der oft genug nur noch grunzend in der Ecke lag, einnässte und einkotete wie ein Baby – dann den Abhängigen, der mit dem verbilligten Kontingent nicht auskam und von dem schmalen Lohn noch was für seine Sauferei abzwackte, den prügelnden Widerling, der sie selbst dann noch grün und blau drosch, wenn sie schon wieder trächtig war. Und die Gören hat er auch nicht verschont! Am Ende war er nur mehr ein Häufchen Elend. Die Leber hat nicht mehr mitgespielt, Ofen aus.«
»Kumpeltod hat man das Schnapskontingent genannt«, wusste Nachtigall. »Beziehungsreich.«
»Nun, die Kumpel wussten natürlich, was ihnen von dem Zeug drohte. Alle wussten, wie schädlich es war, und haben es dennoch gesoffen. Um sie herum starben die Freunde und Kollegen – Magen, Herz, Leber – so manch einem hat es auch das Hirn weggeätzt. Dann gingen sie auf die Beerdigung und haben sich hinterher mit Schnaps getröstet. Eine Schande«, plapperte die Frau munter.
»Dann war Tillmann Johns Tod also vorhersehbar«, sagte Nachtigall leise.
»Ja. Und relativ schnell ist es gegangen. Als er gelb wurde, ging er zum Arzt. Kurze Zeit später ist er seiner Frau unter den Händen gestorben. Gevatter Tod hat ihn verflixt schnell kalt und starr werden lassen.«
»Und der zweite Todesfall?«
»Ach ja«, lachte die Frau und hielt dabei ihre Lockenwickler fest, die das Gesicht bunt umrahmten. »Der Kleine. Fett und träge. Ich habe ihr immer gesagt, der wird eines Tages daran sterben, dass sie ihn so sehr verwöhnt. Aber sie wollte es ja nicht wahrhaben. Und dann, so etwa vor einer Woche, hat er es eben nicht mehr fix genug über die Straße geschafft. Der Laster mit Obst für den Supermarkt vorn an der Ecke war eindeutig der Gewinner – und der Kleine platt. Der Fahrer hat ja noch nicht einmal bemerkt, was passiert ist. Tja, der Lukas.«
»Wie?« Wiener war empört über die emotionale Kälte dieser Frau. »Der überfährt ein Kind und merkt nichts davon? Die Polizei hat ihn doch sicher ermittelt!«
Die Nachbarin musterte den jungen Mann belustigt. »Kind? Quatsch! Der kleine Liebling war der fette Kater von Hedwig. Der durfte sogar in ihrem Bett schlafen, neben ihr auf dem Kopfkissen. Sie war eben völlig vernarrt in ihn. Wo die Liebe hinfällt, sage ich immer.«
»Sie ist auf dem Friedhof bedeutet in diesem Fall auf dem Tierfriedhof?« Nachtigall hatte schon davon gehört. Neulich, als er mit den Katzen zur jährlichem Impfung im Wartezimmer des Tierarztes saß, hatte er eine Broschüre gelesen. Sogar ein eigenes Krematorium hatte man.
»Natürlich. Ich glaube, nach der Beerdigung ist sie nicht wieder an Tillmanns Grab gewesen. Er hat ihr nichts mehr bedeutet. Aber zu Lukas fährt sie jeden Tag. Sie ist ja nun ganz allein in dem Haus, das setzt ihr ganz schön zu. Die Kinder sind natürlich alle viel zu beschäftigt, da kommt aber auch nicht eines mal vorbei und sieht nach ihr. Denen ist die Anreise zu weit, zu beschwerlich und was es noch so an Ausreden gibt. Um die Eltern kümmern ist aus der Mode. Lassen sich großziehen und dann sind sie weg – kein Verantwortungsgefühl mehr!«
»Wo ist denn dieser Tierfriedhof?«
»Drei Dörfer weiter. Wenn Sie hier rausfahren ist es nicht weit. ›Seelenfried‹ heißt er. Ist ausgeschildert.« Sie machte eine Pause und setzte dann vehement hinzu. »Da hat dieser geschäftstüchtige Herr ein Waldgrundstück, wo die ›Hinterbliebenen‹ die Urnen ihrer Lieblinge besuchen können. Reine Geldschneiderei, wenn Sie mich fragen. Früher hat man eine tote Katze hinterm Haus im Garten beerdigt, schon der Kinder wegen, vielleicht noch einen hübschen Stein aufs Grab gelegt und sich bald eine neue Katze gehalten. Aber Hedwig zahlt eine stattliche Summe für den Platz dort. Fast so wie auf dem Friedhof für Menschen. Überall werden nur noch Geschäfte gemacht und traurige, einsame Menschen abgezockt!« In ihrer Empörung hatte sie die Lockenwickler vergessen, die sich nun, einer nach dem anderen, aus den schütteren Strähnen lösten.
Lachend sammelte sie die Plastikrollen vom Boden auf und schob sie in die Taschen ihrer grellgemusterten Kittelschürze.