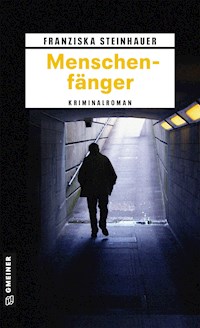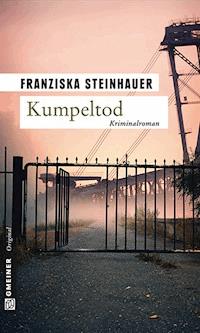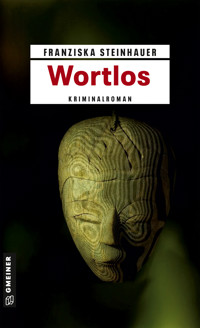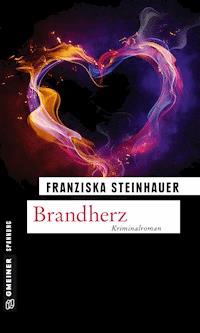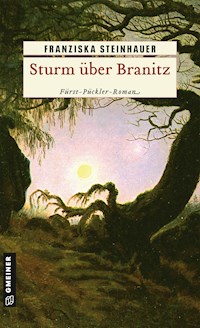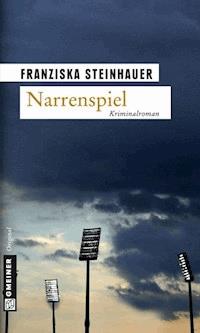Franziska Steinhauer
Schloßstraße
Ein Berlin-Thriller
Berlin-Thriller
Schloßstraße
Schloßstraße
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Warum der Blue Cube
Impressum
Prolog
Der Mann zwängte sich in sein schwarzes Outfit.
Hauteng – das verminderte die Gefahr, irgendwo hängen zu bleiben.
Keine Label.
Keine auffälligen Nähte.
Nichts Individuelles. Extravagantes.
Die Stiefel waren bis zur halben Wade geschnürt, die Hose tief hineingeschoben. Kein Fähnchen mit Logo – alles schwarz.
Einen leichten, schwarzen Seesack trug er über der Schulter, den er wärmend und verbergend über sich legen konnte. Die Dinge, die sich darin befanden, machten kein Geräusch. Jedes Teil war sorgsam in schwarzen Samt gewickelt. Das gesamte Arsenal in kleinen Teilen.
Handschuhe – schwarz.
Sturmhaube. Hochgeschoben sah sie wie eine harmlose Mütze aus.
Der Schädel – glattrasiert. Nichts, was man als Frisur identifizieren konnte.
In wenigen Minuten würde er seinen Platz einnehmen. Er – den ganz Deutschland in ein paar Stunden unter dem Namen Mr. No Mercy kennen würde.
No Mercy wohnte erst seit sechs Monaten hier.
Gerade so lang, wie er brauchte, um seinen Plan auszuarbeiten und alles für die Durchführung in die Wege zu leiten, zu besorgen, auszuprobieren. Dennoch hatte er es nicht versäumt, sich mit den Nachbarn locker zu befreunden. Keine Hürde, wenn man so ein sympathischer Typ war wie er. Offen, freundlich, höflich, hilfsbereit …
Er hatte die Katze des linken Nachbarn versorgt, die Enkelin des rechten von der Schule abgeholt, als der plötzlich zum Zahnarzt musste, war für die alte Frau Meister in der dritten Etage einkaufen gegangen. Alle waren froh, ihn als Mitmieter in der Hausgemeinschaft zu haben.
Er grinste abschätzig in den Spiegel.
Wenn man wusste, wie es funktionierte, war es kein Problem, Menschen zu manipulieren. In seinem letzten Job gehörte diese Fähigkeit quasi zur Stellenbeschreibung. Wie sollte man sich sonst Vertrauen erschleichen, um in die Häuser misstrauischer Menschen eingeladen zu werden. Seine Nachbarn würden alle ziemlich entsetzt sein, wenn sie bemerkten, wem sie da so grenzenlos vertraut und sogar ihre Liebsten zur Betreuung überlassen hatten.
Während er also über die persönlichen Verhältnisse der anderen Hausbewohner bestens informiert war, würden diese erst bei den Interviewfragen der Boulevardblätter feststellen, dass sie selbst nichts über seinen persönlichen Hintergrund zu erzählen wussten. Sorgfältig hatte er darauf geachtet weder von Familie, Alter, Beruf oder gar Hobbys zu sprechen, im Gegenteil, er war derjenige, der sich jederzeit und jedermann als Zuhörer anbot. Aktives Zuhören war eine Spezialbegabung bei ihm, die er zur Perfektion trainiert hatte.
Die Menschen erzählten – alles.
Er verschwieg.
Dunkle Geheimnisse blieben eben lieber im Dunkel. Das hatte er schon früh begriffen.
Zufrieden mit seinem Outfit, schulterte er den Seesack, verließ seine Wohnung, in der außer einem Bett kaum andere Möblierung vorhanden war, und machte sich auf den Weg.
Ab sofort war er die Quelle maßlosen Schreckens.
Es wurde Zeit, dass auch Berlin das bemerkte!
1
Manja und Tobias tobten durchs Wohnzimmer.
»Nein! Das ist nicht wahr! Ich habe die Gummibärchen nicht allein aufgegessen!«, brüllte Tobias bebend vor Zorn und stampfte mit dem Fuß auf. »Du warst das! Ich habe nur ganz wenige davon abgekriegt.«
»Und es ist trotzdem so«, gab die Schwester patzig zurück. »Bei der Schokolade neulich hast du das auch behauptet. Und da klebte der Rest noch an deinen Fingern. Mama weiß genau, dass du sie weggenascht hast. Sie wird dir nicht glauben. Auch wenn du lügst: Ich weiß, dass du es warst. Es ist die Wahrheit!«
»Ist es nicht!«, beharrte der Kleine. »Du hast sie alle aufgegessen! Ich nicht. Das ist nicht wahr!«
»Ist es doch!«
»Nein!«
Als den beiden die Worte ausgingen, flogen die Fäuste, kratzten Fingernägel, hackten Tritte. Handgreifliche Argumente hatten, Manjas Meinung nach, bei ihrem Bruder größere Überzeugungskraft.
Hatten sie nicht.
Zumindest nicht heute.
Tobias war nicht gewillt, in diesem Punkt nachzugeben.
»Was ist denn hier los?« Die Mutter trennte mit geübten Griffen die beiden Streithähne aus der gegenseitigen Umklammerung.
»Ich habe von den Gummibärchen nur ganz wenige genascht«, quengelte Tobias weiter. »Manja sagt immer, sie darf mehr davon abbekommen, weil sie schon sechs ist und ich erst vier.«
»Sicher, sie ist die Ältere von euch beiden«, bestätigte die Mutter. »Aber beim Teilen von Süßem spielt das gar keine Rolle.«
Der Kleine fing an zu weinen. »Sie hat meine …«
»Das ist doch nicht so schlimm. Wir werden sicher noch ein paar finden«, beschwichtigte die Mutter.
Die Schwester grinste. Triumphierend. »Siehst du. Mama glaubt dir nicht.«
»Aber es stimmt! Sie hat …«
»So, Schluss jetzt mit dem Gezanke. Wir gehen alle zusammen in den Zoo. Papa kommt mit.«
»Juchhhuh!«, jubelten die Geschwister einträchtig.
Wischten sich die Spuren der Tränen von den Wangen, funkelten sich ein letztes Mal wütend an.
»Kommt, ich mache noch einen heißen Kakao für euch.« Monika wusste, Schlichtung funktionierte in beinahe allen Fällen auf diese Weise. Lachend sah sie den Kindern nach, die in die Küche tobten.
Der Streit war fast vergessen.
Björn Andermatt stand unter der Dusche und genoss das warme Wasser, das über seinen durchtrainierten Körper floss.
Frei!
Ein ganzes Wochenende mit der Familie. Gestern Weihnachtswaldspaziergang, heute Zoo.
Sein Handy klingelte fordernd.
»Ich habe frei!«, rief er ihm zu. Als es nicht aufhörte, stöhnte er genervt. Stellte das Wasser ab.
»Andermatt hier – und nur zur Info: Ich bin nicht im Dienst!«
»Wir haben hier einen Notfall!«
»Ich nicht! Ihr vielleicht. Johann, dieses Wochenende gehört meiner Familie.«
»Björn, wir brauchen dich. Geiselnahme im Cube. Steglitz ist doch bei dir um die Ecke. Der Täter hat schon eiskalt zwei Leute erschossen, sich nun im Möhrchen, diesem Bioladen im Erdgeschoss, verschanzt. Er stellt keine Forderungen, die von ihm als Voraussetzung für die Freilassung der Geiseln benannt werden, kein Laut ist zu hören. Wir haben nur die Drohung von ihm, es werde noch viel mehr Opfer geben, und die Aussage, er wolle den Besten. Dich!«, haspelte Johann Steinmann eilig, als fürchte er, Björn könne das Gespräch beenden, bevor er alle Informationen gegeben hatte.
»Was?« Björn zuckte zusammen.
»Er will, dass du den Einsatz übernimmst.«
Andermatts Gedanken überschlugen sich. »Seit wann suchen sich Kidnapper ihre Gesprächspartner bei der Polizei selbst aus? Habe ich da was verpasst? Und woher weiß der Kerl von mir?«
»Wir wissen nichts. Gar nichts. Vielleicht hat er dich ja mal bei einer Liveübertragung von irgendeinem Einsatz gesehen. Alles Spekulation.«
»Wer ist er?«
»Wissen wir auch noch nicht. Er macht keine Angaben. Bisher gibt es nur den Zettel mit der Drohung. Computerausdruck, also vorbereitet. Kein Hinweis auf eine Organisation oder Gruppe von Aktivisten im Hintergrund, für die er stellvertretend Geiseln genommen hat. Komm her, sieh dir das Video an. Dann verstehst du, was das für einer ist. Wir haben erste Opfer – einfach so abgeknallt. Der Kerl ist irgendwie unheimlich.«
»Habt ihr Kontakt?« Der Einsatzleiter seufzte.
»Nein. Wir haben keine Ahnung, wie er reagiert, wenn plötzlich das Telefon klingelt. Und selbst hat er noch keinen Versuch unternommen, uns zu erreichen.«
Björns gute Laune war wie weggeblasen.
»Okay. Ich komme vorbei. Aber nur damit das klar ist – ich lasse mich nicht auf solche Spielchen mit Geiselnehmern ein. Ich sehe mir alles an, aber übernehme nicht den Einsatz. Wer ist vor Ort? Das Center ist evakuiert? Alles abgesperrt?«
»Yupp. Alles gesichert. Tom Sendelmann ist schon hier, Technik steht, SEK hält sich bereit. Und eine Polizeistreife patrouilliert als Sahnehäubchen on top.«
»Bis gleich.«
Mürrisch vor sich hin murmelnd, trocknete Björn sich ab.
Der Millimeterschnitt bedurfte keiner besonderen Zuwendung.
Er schlüpfte schuldbewusst in sein Arbeitsalltagsoutfit. War sich im Klaren darüber, dass er seine Familie enttäuschen musste.
Nicht das erste Mal. Die Kinder würden später über ihn erzählen, dass seine Versprechen nicht die Spucke wert waren, die man brauchte, um sie auszusprechen.
Die Mienen der Kinder verfinsterten sich, als er ins Wohnzimmer trat.
»Papa! Du kannst doch nicht so in den Zoo gehen! Mit der dicken Polizeijacke.« Manja sah ihn flehend an. »Und du willst doch mitkommen?«
Der Vater ging in die Hocke, umfasste mit jeder seiner Pranken zwei Kinderhände. »Doch, ich will. Und das klappt auch. Wir machen es so: Ihr fahrt mit Mama vor und wir treffen uns später bei den Eisbären. Ich komme, so schnell ich kann!«
»Und wie schnell kannst du?«, erkundigte sich Monika, seine Frau. Er hörte die mühsam unterdrückte Wut unter ihren Worten, konnte ihre Enttäuschung physisch spüren.
Schnell richtete er sich auf und schloss die zierliche Gestalt in seine trainierten muskulösen Arme, die ohne Mühe einen Kleinwagen anheben konnten.
»Du hast frei!«, protestierte sie bebend.
»Ja. Das bleibt auch so. Wir haben eine Geiselnahme im Blue Cube«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Der Kerl will mit mir sprechen. Ich aber nicht mit ihm. Sie haben ein Video von der Geiselnahme. Das sehe ich mir an und treffe euch danach bei den Eisbären.«
Im Flur angelte er den Autoschlüssel aus der Schublade, winkte der Familie zu und stürmte los. Ahnte noch nicht, dass er sein Versprechen nicht würde einlösen können.
2
»Echt? Du hast schon einen konkreten Plan?«, erkundigte ich mich aufgeregt. »Wie sieht der aus?« Ich ruckelte nervös auf meinem Stuhl hin und her, beugte mich weit über den Tisch, um nur nichts zu verpassen. Endlich eine Route!
»Nun, am besten starten wir in Bogotá. Es gibt einen direkten Flug ab Berlin. Wir sehen uns die Stadt an, tauchen ein bisschen ein in den Trubel dieser riesigen Metropole. Nur weil wir aus humanitären Gründen hinfliegen, müssen wir ja nicht darauf verzichten, uns Sehenswürdigkeiten anzusehen. Wer weiß, wann wir später wieder so eine Chance bekommen werden!« Nicolas blaue Augen blitzten voller Vorfreude, er lachte leise. Bei seiner Statur geriet es dennoch laut. Ein sportlicher junger Mann, muskelbepackt, tätowiert, dessen ursprünglich modischer Haarschnitt mit üppiger, zur Seite gewellter Tolle inzwischen einer praktischeren Frisur gewichen war, einer Art Bürstenschnitt mit Seitenscheitel. Unser Plan sah einen Koffer für Pflegeprodukte und Styling-Technik nicht vor. »Es gibt eine Kontaktadresse für Interessenten, die sich bei einer Hilfsorganisation engagieren wollen. Dort habe ich mich bereits hingewandt, die vermitteln uns einen Kontakt vor Ort.«
Ich beobachtete die Kellnerin, die von Tisch zu Tisch lief.
Für jeden hatte sie ein freundliches Wort, erkundigte sich nach Angehörigen. Stammkunden, konstatierte ich. Sie möchte ihnen ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln, Kundenbindung.
Mir kam es so vor, als werfe sie immer wieder misstrauische Blicke in unsere Richtung. Wahrscheinlich entsprachen wir zu wenig dem Bild der »normalen« Cafébesucher. Drei junge Männer mit dunklen Haaren, kurzen Bärten, legerer Kleidung, die konspirativ beieinandersaßen und offensichtlich Pläne schmiedeten. Möglicherweise finstere. Wir waren auf jeden Fall suspekt.
Die Kellnerin trat zu ihrem Kollegen an den Tresen, es entwickelte sich ein kurzes Gespräch zwischen den beiden.
»Wir fallen auf«, erklärte ich den anderen beiden. »Die Kellnerin ist davon überzeugt, dass wir uns hier treffen, um einen Banküberfall zu planen. Das liegt an unserem Aussehen.«
»Quatsch. Warum sollte sie? Dann müsste sie ja auch annehmen, die alten Damen da drüben«, Nicola deutete mit dem Kopf leicht nach links, »gehören zu einem Kinderschmugglerring. Woher willst du überhaupt wissen, was sie denkt? Gedankenlesen war schon immer eine Fähigkeit von dir?«
Nicola eben. Arrogant.
»Nein, ich habe einen Freund, der nach einer Infektion sein Gehör verloren hatte. Ich kann Lippenlesen.«
»Das ist ja toll!« Felipe war ehrlich erstaunt. »Das kann man einfach so lernen?«
»Einfach so nicht. Nur mit Ausdauer«, gab ich mich bescheiden, freute mich aber sehr darüber, wenigstens Felipe beeindruckt zu haben.
»Und der Kollege hinterm Tresen glaubt auch, wir hätten Böses vor?«
»Nein«, konnte ich Nicola beruhigen. »Er glaubt, wir organisieren eine Überraschungsparty für einen Freund.«
»Na, dann ist ja alles geklärt. Kommen wir zum Thema zurück.«
Wir bestellten drei Gin Tonic.
Legten die Speisekarte griffbereit an den Rand des Tisches, signalisierten so, dass wir noch mehr ordern würden.
Das Café in der Schloßstraße war gut besucht.
Die übrigen Gäste schienen an uns sehr interessiert zu sein, es kam mir vor, als versuchten sie zu erlauschen, was wir wohl zu besprechen hatten.
»Vielleicht sollten wir uns etwas leiser unterhalten«, gab ich zu bedenken.
Nicola sah sich kurz um, nickte.
»Okay. Wir haben nichts zu verbergen, aber unser Plan muss auch nicht Stadtgespräch werden.«
Fortan wurde bei uns eher geflüstert, um ausschließen zu können, dass an den Nachbartischen etwas von unserem Gespräch aufgeschnappt würde. Was uns sicher in den Augen der Kellnerin und der anderen Gäste noch verdächtiger machte.
Mit der Zeit würde man sich an unseren Anblick und unsere Art gewöhnen.
»Ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass es mit der Organisation unseres Einsatzes so einfach funktionieren wird.« Felipes Hände waren sorgfältig manikürt, sahen weich und zärtlich aus. Während er mit warmer Märchenerzählerstimme sprach, bewegten sie sich sanft, unterstrichen seine Worte perfekt, gaben ihnen Gewicht – selbst wenn die Aussage im Grunde gar nicht fundamental wichtig war. Der Blick, mit dem seine braunen Augen Nicola streiften, war ein wenig skeptisch, vielleicht ein bisschen ängstlich. Die langen, dunklen Haare wurden von einem weichen Gummiband gehalten, das er während des Sprechens immer wieder neu fixierte.
Ich warf einen Blick auf meine derben, klobigen Finger und schob sie unter die Oberschenkel.
»Kennt ihr beide euch gut?«, fragte ich unvermittelt, rau und ein wenig besorgt. Die Rolle als mitgeschlepptes Anhängsel würde mir nämlich nicht gefallen.
Nicola überließ es Felipe zu antworten.
»Wir wohnen in einem Haus mit lauter WGs. Gesehen haben wir uns schon öfter, aber ich wurde erst aufmerksam, als Nicola einen Aushang am schwarzen Brett gemacht hat. ›Soziales Engagement in Kolumbien‹. Das hat mich angesprochen. Und, wie gesagt, ich nahm an, es könnte eine komplizierte Angelegenheit werden. Und nun sieht es gar nicht danach aus.«
»Wie abgemacht: Wir sprechen uns nur mit den spanischen Namen an.« Nicolas Ton wurde eindringlich. »Wenn wir erst in Kolumbien sind, sollte uns besser kein Fehler mehr unterlaufen. Ihr wisst ja, es gibt dort Gruppen, Untergrundorganisationen oder auch Clans, Kartelle – wie auch immer man sie bezeichnen will –, die Menschen verschleppen und gegen Lösegeldzahlungen freigeben, oder auch nicht.«
Ich nickte. »Die gewählte Präsidentin haben sie auch verschleppt. Ingrid Betancourt. Seit etwa drei Jahren wird sie irgendwo gefangen gehalten. Unfassbar.«
»Genau. Deshalb verwenden wir dort keine deutschen oder nordeuropäischen Namen. Nur die Organisation kennt unsere wahren Identitäten, ich musste uns natürlich mit ordentlichen Papieren anmelden. Kopien der Originale liegen also schon dort. Aber ansonsten ist niemand eingeweiht. Auch unsere Begleiter direkt vor Ort wissen nicht, woher wir kommen. Wir werden uns bei jeder Gelegenheit nur mit unseren Vornamen vorstellen. Dann ist es einfach.«
»Im Grunde kannst du doch gar nicht mehr sicher sein. Trotz all der Verschleierungsmaßnahmen. Denkt mal an dieses Ehepaar, das auf den Malediven entführt wurde. Gefühlt haben die mich ein ganzes Jahr lang in jeder Tagesschau genervt. Die beiden mussten sich an den Kosten für die ›Befreiung‹ beteiligen. Fand ich nur gerecht.« Felipe, Jurastudent, grimassierte wild. »Aber bei uns ist nichts zu holen. Da haben wir im Ernstfall vielleicht schlechte Karten.«
Nicola lächelte beruhigend. »Macht euch keine Sorgen. Uns wird man nicht für eine gute Einnahmequelle halten. Wir tragen Jeans und möglichst unifarbene T-Shirts ohne Aufdruck oder sichtbares Label. Normale, stabile Turnschuhe, keine Luxusmodelle. Niemand wird Notiz von uns nehmen.«
»Muss man Spanisch können?« Ich rutschte wieder unruhig auf meinem Stuhl hin und her. »Also, wenn es notwendig ist, dann besuche ich einen Kurs an der Volkshochschule. Aber ehrlich, ich bin kein Sprachenlerngenie.«
»Wie schon gesagt, wir werden an eine Kontaktperson vermittelt. Dann klappt die Kommunikation auf Englisch.« Nicola hatte sich offensichtlich bereits umfassend informiert. Ich fand, er hatte viel von einem Beamten. Bürohengst, der alles minutiös durchplante.
Wenn man so einen Trip plant, sollte man sich in der Gruppe wohlfühlen, den anderen vertrauen. Falls wir wirklich in eine brenzlige Situation geraten würden, konnte ich sicher sein, dass die beiden sich auch um mich scherten?
Wäre sich nicht doch jeder selbst der Nächste?
Deshalb beschloss ich, sehr aufmerksam zu sein.
Ich beobachtete meine zukünftigen Reisebegleiter unter meinen halb geschlossenen Augenlidern, als ich vorgab, die Karte des Cafés zu studieren. Die beiden kannten sich ganz offensichtlich nicht erst seit dem ersten Treffen der Dreiergruppe. Wie lange genau, wie eng, darüber hatten sie nur nebulöse Angaben gemacht, auch über die Anzahl der weiteren Mitbewohner der angeblichen WGs. Ich selbst hatte auch nicht jedes Detail meiner Biografie preisgegeben, es gab einfach Dinge, die waren eben privat!
Wenn man mich nicht direkt danach fragen würde, blieben sie es auch.
Mir ging ein Spruch durch den Kopf, den meine Mutter immer gern verwandt hatte, wenn sie der Meinung war, ich sei zu leichtgläubig, zu vertrauensselig.
Der mit der sprichwörtlichen Leiche im Keller. Jeder hat seine eigene. Solange sie nicht stinkt, ist alles in Ordnung.
»Wusstet ihr eigentlich, dass dieses Café hier eine bemerkenswerte Historie hat?«
»Nein. Es ist ein Café, mehr nicht.« Nicola hasste es offensichtlich, wenn man ein Thema anschnitt, das ihm unbekannt war.
»Ja, wirklich. Das Café Reichert ist ein Traditionsbetrieb, wenn auch an dieser Adresse erst seit etwa einem halben Jahrhundert. Es hatte Zeiten gegeben, da gehörte es neben dem Kranzler und dem Mohring zu den berühmtesten der Stadt. Aber die Gründung des Caféhauses, das ursprünglich eine Confiserie war, ging auf das Jahr 1822 zurück. Finde ich toll. Aber das erklärt vielleicht auch, warum wir hier wie Paradiesvögel wirken.«
»Möglich.« Nicolas Blick war deutlich.
Unterbrechungen dieser Art hätte ich in Zukunft zu vermeiden, war klar darin zu lesen.
»Gesundheitscheck ist notwendig. Schließlich will wohl keiner von uns ausgerechnet während dieses Aufenthalts in ein lokales Krankenhaus.« Felipe lachte leise, wollte wohl die Situation entschärfen. Warm, sympathisch, trotz der mahnenden Worte unbesorgt. »Extraktion von Zähnen ohne Anästhesie? Huh!«
»Ne. Klar nicht.« Ich nickte. »Ich mache einen Termin zum Check für etwa vier Wochen vor Abflug aus. Wenn dann doch was ist, kann man es vielleicht rechtzeitig bis zum Reisetermin in den Griff kriegen.« Ich hörte selbst, dass ich unsicher klang. Dabei wollte ich eigentlich als abenteuerlustiger Draufgänger rüberkommen, das musste besser werden. Unangenehm deutlich spürte ich den investigativen Blick Nicolas, der offensichtlich versuchte, meine Tauglichkeit zu checken. Immerhin würden wir drei aufeinander angewiesen sein, gerade in brenzligen Situationen. Ein Bedenkenträger und Angsthase könnte entstehende Probleme durch unüberlegtes Handeln vergrößern. Ganz automatisch straffte ich meinen Körper, richtete den Rücken auf, präsentierte eine unbeeindruckte Miene und breite Schultern, ließ meine Bizepse zucken. Mit den Muskeln Nicolas konnten sie natürlich nicht mithalten. Dennoch schien er beruhigt von dem, was er sah, nahm seinen Blick zurück und atmete tief durch.
Nicola zog ein buntes Buch aus der Jackentasche und blätterte es an einer markierten Stelle auf. »Ich habe hier einen Reiseführer. In dem findet man auch die Durchschnittstemperatur für die einzelnen Monate und die ›feuchten‹ Zeiten. Je nachdem, wo unser soziales Engagement stattfinden soll, werden wir mit zum Teil extremen Wetterbedingungen zu tun haben.« Neugierig beugten wir uns darüber.
»Okay. Ich verstehe, was du meinst.« Felipe strich nachdenklich durch den Bartansatz am Kinn. »Das müssen wir bedenken. Vielleicht können wir uns mit der Hilfsorganisation enger abstimmen, was dieses Thema angeht.«
»Anden. Dort kann es verflixt kalt werden, in anderen Landesteilen ist es zur selben Zeit schwül und lastend heiß. Was können wir besser ab, warm oder kalt? Oder nehmen wir es, wie es kommt?«
»Das Problem ist ja die Ausrüstung«, wandte Felipe vernünftig ein. »Mir wird schnell kalt. Aber wir wollen natürlich nicht den ganzen Kleiderschrank einpacken, für alle Fälle. Also denke ich, es wäre schon ganz praktisch, genauer zu wissen, welches Wetter uns erwarten wird.«
»Ich friere auch leicht«, sprang ich dem eher zarten jungen Mann zur Seite. »Du hast recht, wir sollten nicht unnötig Kleidung mitnehmen, die wir absehbar nicht benötigen werden.«
»Ich habe schon mal grob geguckt. Vielleicht wäre es ganz gut, Ende Dezember oder kurz nach Silvester aufzubrechen. Ich versuche unseren Einsatzort zu klären, bevor wir uns das nächste Mal treffen. Klar ist schon jetzt: Wir landen in Bogotá. Dort verbringen wir ein paar aufregende Tage, bevor wir in unser Einsatzgebiet gebracht werden.« Nicola zog eine Karte aus seinem Rucksack. »Hier sind alle Museen eingezeichnet und im Begleitheft gibt es Rezensionen dazu.«
Schnell waren wir drei in unsere weiteren Planungen für den ersten Reiseabschnitt vertieft.
Vielleicht verpassten wir zu diesem Zeitpunkt den richtigen Moment für ein Gespräch über unsere unterschiedlichen Motivationen. Damals erschien es uns nicht wichtig.
Meine Geschichte hätte sich in etwa so angehört: Als ich um die fünfzehn Jahre alt war, sagte meine Mutter zu mir: »Schnäpschen, weißt du, bis zu deinem zwanzigsten Geburtstag solltest du wirklich wissen, was du werden willst und wie du es erreichen kannst. Setz dir ein Ziel, verliere es nicht mehr aus den Augen.«
»Schnäpschen«. Natürlich wusste sie, dass ich diesen Spitznamen hasste. Immer wenn ich mir etwas hinter die Ohren schreiben sollte, verwandte sie ihn. In ihrer Konnotation positiv besetzt, denn ein kleiner Schnaps wirkte sich gut auf Stimmung und Verdauung aus – tat einfach gut.
Dennoch, mir gefiel er nicht.
Es macht keinen Spaß, ständig damit rechnen zu müssen, plötzlich »Schnäpschen« gerufen zu werden. Das war unendlich peinlich. Besonders, wenn auch noch meine Klassenkameraden neben mir standen!
»Was deine Mutter meint, Zwerg, ist, dass, wenn du noch immer Lokomotivführer werden möchtest, du es bis zu deinem zwanzigsten Geburtstag geschafft haben solltest, im Führerstand oder neudeutsch Cockpit zu sitzen. Wenn du absiehst, dass das nicht klappen wird, such dir beizeiten etwas anderes. Wichtig ist nur, dass du weißt, ab wann du eine Familie gründen und ernähren kannst.« Typisch mein Vater. Planung war das Wichtigste.
»Zwerg«. Seine Art sich über meine Statur lustig zu machen. Sogar zum Arzt waren sie mit mir gegangen! Der hatte meine Hände geröntgt und einige andere Untersuchungen durchgeführt. Danach stellte er lachend klar, es sei alles in Ordnung mit dem Kind, es werde einfach deutlich länger als die anderen Kinder wachsen. Das Problem werde sich also im wahrsten Sinne des Wortes auswachsen. Diese Prognose hatte gestimmt.
Der »Zwerg« war dennoch an mir hängen geblieben.
In Bezug auf die Pläne meiner Eltern erschien mir »eine Familie gründen« der am schwierigsten zu erfüllende Teil zu sein. Wahrscheinlich war es gar nicht möglich. Ein unerreichbares Ziel.
Aber das hatte ich bisher wohlweislich verschwiegen.
Präferenzen ändern sich, Dinge nehmen einen anderen Lauf als geplant.
Als mein zwanzigster Geburtstag anstand, war ich noch immer nicht Lokomotivführer geworden.
Ich studierte.
Philosophie und Soziologie.
Und nun, da mein Weg abgesteckt schien, wollte ich noch ein letztes Mal richtig aussteigen. Der Plan: Für kurze Zeit in definiertem Rahmen etwas ganz anderes zu tun. Den theoretischen Teil des Studiums mit Realitätskontakt konkret zu hinterlegen.
Deshalb saß ich mit den beiden anderen hier.
Und ganz nebenbei würde mich der Sozialeinsatz weit weg von zu Hause führen. Weit weg von all den Lebenslügen, Zwängen, Vertuschungen, psychischen Verletzungen und dem ständigen Leugnen.
Weder kannten die anderen diese noch ich ihre Geschichte.
Wirklich, wir hätten vor der Reise alle ehrlicher miteinander über unsere Motivation sprechen sollen!
3
Der Blue Cube.
Schon als das futuristische Bauwerk nur als Architektenentwurf vorlag, hatte es heftige Diskussionen gegeben. Ein dunkelblauer Riesenwürfel, ohne Fenster in der Fassade, mit indirektem Lichteinfall. Massig würde das Center werden, befürchteten viele Berliner, kalt die Außenhaut, abweisend, sachlich, ungemütlich.
Als Björn die Mall im Sonnenlicht des Winters von fern sah, schien keine der Befürchtungen wahr geworden zu sein. Samtig, warm und einladend sah der Komplex aus, der ohne reißerische Aufmachung auskam. Keine Fahnen oder Banner, keine LED-Reklame, blinkend und nervig. Fast geheimnisvoll, dachte Andermatt, verströmte der Blue Cube ein wohliges Gefühl von Geborgenheit und versprach grenzenlose Freude an Entdeckungen, die man hier machen könnte.
Das Ungewöhnlichste: Wenn man an der blauen Fassade entlangschlenderte und stehen blieb, wurde das Blau plötzlich durchsichtig. Gab den Blick frei auf Mode, Schmuck und Accessoires. Schaufenster on demand – sozusagen.
Heute allerdings war alles anders.
Beim Näherkommen blieb von der sonst so einladenden Atmosphäre nichts übrig.
Das beliebte Einkaufscenter in der Schloßstraße wirkte an diesem Morgen gespenstisch – ja beinahe feindselig. Blaulicht zuckte, Polizisten riegelten weiträumig ab. Hektische Betriebsamkeit störte die vorweihnachtliche Stimmung und Konsumlaune.
Björn wies seinen Ausweis vor, wurde durch die Absperrung gewinkt.
Sein Kollege Tom Sendelmann erwartete ihn bereits an einem der hinteren Eingänge, führte ihn durch das Labyrinth von Passagen, Fluren und separaten Treppenhäusern zu den Räumen, die den Besuchern verborgen blieben.
Monitore an den Wänden.
Auf den ersten Blick wirkte es, als habe jemand auf allen Frequenzen das Standbild festgehalten. Björn wusste, dass dieser Eindruck daher rührte, dass sich tatsächlich niemand mehr durchs Haus bewegte. Alles still, seltsam ausgestorben. Wie in den Stunden nach Ladenschluss.
»Also? Was soll ich mir nun ansehen?«
Tom zog ihn zu einem Schreibtisch, auf dem ein Laptop stand.
»Hier. Das sind die Bilder, die eine der Überwachungskameras von der Geiselnahme aufgezeichnet hat.«
Björn beugte sich weit vor.
Wollte sich kein noch so winziges Detail entgehen lassen.
Eine Mitarbeiterin des Bioladens »Möhrchen« schob mit behandschuhten Händen die Glassegmente zur Seite. Kaum war genug Platz, drängten schon die ersten Kunden an ihr vorbei, als überraschend am linken Bildrand vor dem Schaufenster eines Dessousladens eine schwarze Gestalt auftauchte.
Der Blick des Schwarzvermummten ging für den Bruchteil einer Sekunde in Richtung Kamera. Nur ein grün blitzendes Augenpaar. Den Rest verdeckte die Sturmhaube. Das Gewehr lag ihm locker in der Hand, alle Bewegungen waren geschmeidig, entspannt, selbstverständlich. Plötzlich riss er die Waffe mit einem kurzen Ruck zur Hüfte hoch und schoss im Gehen beiläufig zur Seite. So, als spiele er einem Kind den weggerollten Fußball zurück. Er sah nicht einmal hin.
Der Getroffene warf die Arme in die Luft, in seinem Gesicht lag ein Ausdruck grenzenloser Überraschung. Er stürzte zu Boden. Blieb unbeweglich liegen. Andere Passanten rannten schreiend davon, liefen kopflos die Gänge entlang. Kinder wurden gepackt und eilig aus der Gefahrenzone gebracht.
Niemand versuchte, den Schützen aufzuhalten. Keiner eilte dem Opfer zu Hilfe.
»Stopp! Fahr noch mal zurück!«, forderte Björn. »Ich glaube, der Mann hat noch die Lippen bewegt.«
Tom spielte die Sequenz erneut ein.
Ein weiteres Mal wurden sie Zeugen des Sterbens des Passanten.
»Okay. Er hat nur nach dem Warum gefragt«, erkannte Björn und beugte sich noch weiter vor. »Niemand spricht ihn an, alle rennen weg. Panik. Verständlich, wenn man Zeuge einer solchen Aktion wird. Um das Opfer kümmert sich auch niemand, wahrscheinlich dachten alle, es sei ohnehin tot. Die riesige Blutlache spricht auch eher gegen ein Überleben. Woher wisst ihr, dass er mich als Verhandlungspartner will?«
»Kommt gleich.«
Der Schwarzgekleidete trieb die Menschen, die entsetzt aus dem Ladenlokal zu entkommen suchten, wieder zurück hinter die Glassegmente, nötigte Passanten aus dem Gang, das Geschäft zu betreten. Scheuchte sie vor sich her wie Hühner, die abends in den Stall gejagt wurden. Angstvoll wichen die Leute zurück, starrten auf die Waffe in der Hand des Mannes. Der schoss ein zweites Mal wie uninteressiert zur Seite durch den Gang. Ein zweiter Kunde, der versucht hatte, auf diesem Weg zu entkommen, stürzte erst auf die Knie, stützte sich mit den Armen ab, konnte sich dann nicht mehr halten. Ein Schwall Blut quoll aus seinem Mund. Auch er blieb ruhig im Gang liegen. Der Schwarzvermummte wandte nicht einmal den Kopf in seine Richtung. Die Angestellte schob mit zitternden Armen die Elemente an ihren Platz zurück. Mehrfach sah es aus, als wollten ihre Knie den Dienst versagen, als könne sie ohnmächtig werden. Doch schließlich war die Ladenfront wieder komplett geschlossen. Der Unbekannte blieb die ganze Zeit über regungslos stehen, beobachtete das Geschehen, die Waffe locker im Anschlag.
Bevor die letzte Lücke endgültig verriegelt wurde, flatterte ein Zettel zu Boden, blieb neben dem toten Körper liegen.
Danach war alles still.
Die Aufzeichnungen der Kamera zeigten, dass einzelne Mutige sich zu den Körpern wagten, hektisch telefonierten. Und plötzlich setzte mit ohrenbetäubendem Lärm die Alarmanlage ein. Tom stellte auf Schnelllauf. Sanitäter und Notarzt wuselten durchs Bild. Die beiden Opfer wurden hastig geborgen und abtransportiert, Polizisten und Mitarbeiter des Wachschutzes huschten über den Bildschirm, trieben Besucher und Personal vor sich her.
Danach herrschte befremdliche Leere.
»Was stand auf dem Zettel?«, fragte Björn voll böser Ahnung.
»Hier, sieh selbst!« Tom schob ihm sein Mobiltelefon mit der geöffneten Datei des Papierstücks zu.
»Ich spreche nur mit dem Besten! Mehr Tote sind nicht mein Problem!«
»Nicht mein« war zweimal unterstrichen.
»Aha! Gleich ein Versuch, die Schuld für Tote und Verletzte anderen zuzuschieben. Und deshalb musste ich kommen? Wieso glaubt ihr, dass er mich meint?«
Tom Sendelmann grinste schief. »Ach komm! Ist doch klar. Ich meine, wir hätten behaupten können, du seist in Urlaub. Stell dir vor, der Kerl weiß vielleicht, dass das nicht stimmt? Der Beste! Das war der Titel einer Reportage über unsere und speziell deine Arbeit. Der ist leicht im Netz zu finden. Sieh dir die Aufnahme mal weiter an!« Toms Finger bebten leicht, als er damit über den Rand seiner Unterlippe strich.
Tatsächlich kam nach einiger Zeit wieder Bewegung in die Situation.
Das erste Glassegment wurde leicht gedreht. Gab einen Spaltbreit frei.
Eine Person wurde in zusammengesunkener Haltung mit den Füßen voran von mehreren Händen durch den Spalt geschoben. Sobald die Hände losließen, fiel der Körper zur Seite und die Hände rollten den Körper bis auf den Gang.
Leblos.
Eine junge Frau.
Auf ihrer weißen Bluse ein dunkler Fleck, der sich rasch vergrößerte.
Toms Stimme schwankte, als er sagte: »Er vertreibt sich die Wartezeit auf dich mit dem Töten seiner Geiseln. Deshalb bist du hier. Weil du der Beste bist.«
Björn konnte die Augen nicht von dem wachsenden dunklen Fleck losreißen. »Ist sie tot?«
»Ja. So wie die beiden ersten auch.«
»Wer ist das?« Björns Stimme klang heiser. Er griff nach einer Wasserflasche, trank einen großen Schluck.
»Bisher haben wir keine Erkenntnisse dazu. Kein klärendes Schreiben, in dem jemand die Verantwortung übernimmt, keinen erläuternden Bekenneranruf – nichts.«
»Wie ist er reingekommen?«
»Auch das ist noch nicht sicher geklärt. Wir werten natürlich gerade alle Aufnahmen aus, auch vom Bereich der Zulieferzone.«
»Okay. Der Typ bewegt sich völlig locker und entspannt, selbstbewusst. Vielleicht ein klein wenig unrund in der Drehung. Hat keinen Zweifel an der Richtigkeit seines Handelns. Ich gehe davon aus, dass er stolz darauf ist, die Lage dominieren zu können, alles im Griff zu haben. Vielleicht ist er davon überzeugt, dass sein Motiv diese Morde rechtfertigt. Er schießt tödlich, ohne anzuvisieren, aus der Hüfte. Gut ausgebildet. Scharfschütze? Armee? Polizei? Grenzschutz? Wann taucht er zum ersten Mal sicher auf den Videos auf?«
Tom tippte eine Adresse ein.
Ein neues Video öffnete sich.
»Hier. Das ist eine Aufzeichnung aus dem Personalbereich. Eigentlich hat dort kein Unbefugter Zutritt. Er hat die Waffe nicht in der Hand, nur der Gurt spannt über seiner Brust. Allein seine Erscheinung hätte allerdings stutzig machen müssen.«
»Er versucht nicht, sich zu verbergen!«, knurrte Björn. »An Tagen wie diesen wäre ein Weihnachtsmannkostüm die perfekte Verkleidung gewesen. Aber nein! Er will gesehen werden. Er zögert nicht eine Sekunde, bewegt sich so, dass niemand wagt, ihn anzusprechen. Arrogant, abweisend, narzisstisch. Für mich sieht es aus, als habe er sich extra für uns dort von der Kamera entdecken lassen. Er zeigt uns seine Unerschrockenheit, seine Entschlossenheit. Wir sollen wissen, dass er uns nicht fürchtet, weil er überlegen ist.«
»Ja, das könnte gut sein. Er verschwindet nämlich danach auch wieder. Wir können allerdings ausschließen, dass er mit den ersten Kunden in den Cube drängte. Die Aufnahmen von den Eingangsbereichen für Kunden haben wir schon ausgewertet.« Tom zuckte mit den Schultern. »Er wäre sofort aufgefallen. Das Outfit …«
»Er hat sich liefern lassen?« Björns linker Augenwinkel zuckte.
»Das checken wir gerade.«
»Das Gewehr – eine Kalaschnikow, oder? Ist nicht klar zu erkennen. In Berlin bekommst du das Ding an so gut wie jeder Ecke, behaupten jedenfalls die Judoschüler meiner Frau. Oder problemlos im Darknet. Zuverlässige, präzise Waffe. Er überlässt nichts dem Zufall. Er wählt einen Laden, dem gegenüber eine Videokamera installiert ist. Wenn er Zugang zum System hat, überblickt er genau, was vor seiner Tür abgeht – was im gesamten Haus vor sich geht.«
»Ihr meint, er guckt uns über die Schulter?«, erkundigte sich Johann Steinmann beim Leiter des Security-Teams des Cube besorgt. »Er sieht, was wir sehen? Dann hat er dich auch kommen sehen?«, fragte er an Andermatt gerichtet.
»Ja. Allerdings sehe ich aus wie viele der anderen Leute, die sich im und ums Gebäude bewegen. Ich gehe davon aus, dass er sich ins System eingehackt hat. Vielleicht musste er das aber auch gar nicht. Jeder Laden hat eine eigene Überwachung?«
Der Teamleiter der Center-Security nickte. »Klar. Die sehen ihre Filiale. Innenraumüberwachung. Standard. Ich gucke schon nach, ob er sich ins Gesamtsystem gehackt hat. Dauert ein bisschen, das System checkt auch die IP-Adressen der User. Normalerweise braucht er ein Passwort …«
»Das Letzte, was wir von ihm sehen, ist das Betreten des Ladens und die Angestellte, die die Segmente schließt. Warum sehen wir ihn jetzt nicht mehr?«
»Entweder hat er die Kamera ›gekillt‹ oder die Innenraumüberwachung ausgeschaltet, was natürlich eleganter wäre. Dabei wird ihm die Angestellte geholfen haben. Wir checken das gerade.«
»Er will nicht, dass wir wissen, was im Geschäft vor sich geht, ist andererseits natürlich brennend daran interessiert zu erfahren, was wir so treiben. Deshalb müssen wir ihm vorgaukeln, dass er uns beobachten kann, ihm aber real jede Chance dazu nehmen«, entschied Björn sachlich.
Johann, der Jüngste im Team, verfärbte sich blass-grünlich. »Das merkt der doch!«
Tom warnte: »Wenn er mitkriegt, was wir da tun, bringt er eiskalt den Nächsten um!«
»Oder der rastet völlig aus!«, presste Johann hervor. »Bringt alle um.«
»Dann müssen wir es eben geschickt genug anstellen!« Björn wandte sich an den Mitarbeiter der Überwachungsfirma. »Ruckelt die Anlage, wenn wir die Kameras auf Standbild schalten?«
»Ja. Ganz leicht, wenn wir den Modus ändern. Wenn der Kerl wirklich zuguckt, dann sieht er, was Sie vorhaben.«
»Können Sie feststellen, ob und wie weit er sich Zugriff auf die Daten verschafft hat?«
»Wir prüfen das gerade. Wie gesagt, das dauert ein bisschen.«
»Das ist zu gefährlich, Björn. Wir wissen ja nicht einmal, wie viele Geiseln er genau in seiner Gewalt hat.« Tom trommelte mit den Fingern einen nervösen Rhythmus auf der Tischplatte.
»Fünfunddreißig plus Personal.« Björn wandte sich wieder an den Angestellten der Firma. »Wie viel Personal ist normalerweise in diesem Bioladen? An einem Tag wie heute?«
»Zwei.«
»Innenraumüberwachung ist off.« Ein weiterer Mitarbeiter der Center-Security rief die Information über seine Schulter.
»Fünfunddreißig Kunden und zwei Personen vom Personal sind siebenunddreißig.«
»Woher weißt du so genau, wie viele Kunden …«
»Ich habe sie gezählt. Geht bei mir ganz automatisch. Eine Geisel hat er uns erschossen vor die Füße rollen lassen – bleiben also sechsunddreißig Menschen in seiner Gewalt.«
»Sechsunddreißig mögliche Todesopfer«, murmelte einer der Männer aus dem Security-Team.
Björn sah in die Runde. »Wenn wir etwas unternehmen, können wir alle oder viele retten. Unternehmen wir gar nichts, sind wahrscheinlich alle verloren. Also werden wir nun wieder die Führung in dieser verflixten Lage übernehmen.«
Er baute sich in eindrucksvoller Pose vor dem Team auf. »Während wir in den anderen Modus schalten, müssen wir ihn ablenken. Das bedeutet, dass vor seiner Tür ein Manöver gestartet wird, um seine Aufmerksamkeit zu fokussieren. Und eines danach. Damit er keinen Verdacht schöpft. Falls er das Hakeln bemerkt, vor seiner Tür aber Bewegung ist, wird er dem Ruckeln vielleicht keine Bedeutung beimessen. Erst dann, wenn er uns nicht mehr beobachten kann, wird es für uns möglich, aus einem der Nachbargeschäfte Sonden anzubringen, damit wir dauerhaft hören und sehen können, was da drinnen passiert. Also, her mit euren Ideen!«
4
Bianca hatte wie an jedem Morgen das Frühstück für ihren Freund Manuel zubereitet, während er unter der Dusche stand. Nahrhaft sollte es sein, gesund und lecker. Seit der Kleine da war. Als ob er mit Stillen beschäftigt gewesen wäre! Sie schmunzelte kurz bei dem Gedanken, wurde aber sofort wieder ernst.
Während sie das Obst für sein Müsli in mundgerechte Stücke schnippelte, ging sie ihren geheimen Plan noch einmal durch. Wenn sie ihn diesmal wieder nicht umsetzte – wie schon so oft –, dann würde sie es wohl nie schaffen, ihr Leben und das des kleinen Julian in die eigenen Hände zu nehmen.
Gestern Abend.
Er hatte sie geschlagen. Schon wieder.
Vorsichtig betastete sie die schmerzenden Stellen im Gesicht, am Körper. Ließ die Finger auf der Wunde an der Stirn nur flüchtig verweilen, strich vorsichtig über die geplatzte Lippe und fragte sich, ob es ihr gelingen würde, das schicke Veilchen zu überschminken, das er ihr verpasst hatte.
Zum Glück schlief Julian in der Regel tief.
Oder tat zumindest so. Bianca fragte sich, ob schon so kleine Kinder spürten, wann es für sie besser war, nicht auf sich aufmerksam zu machen, selbst wenn sie schreckliche Angst hatten.
Auch gestern Abend war er nicht ein einziges Mal unruhig geworden. Selbst dann nicht, als sein Vater die Lampe in den Glasschrank geworfen hatte, in dem Weingläser und Sektkelche standen. Stunden dauerte es danach, all die Scherben aus dem hohen Flor des Teppichs zu klauben. Unter Manuels wachsamem Blick und im Schein einer lichtstarken Taschenlampe, mit der er die kleinsten Splitter aufblitzen lassen konnte.
»Gib dir gefälligst Mühe! Wenn dein Blödmann hier morgen rumkrabbelt, soll er sich doch nicht verletzen, oder?«
Manuel hatte ihr sogar die Pinzette aus dem Bad geholt, die sie für ihre Augenbrauen verwendete. Damit sie die winzigsten Partikel aufnehmen konnte. Als der Lichtkegel nichts mehr fand, erlaubte er ihr, den Staubsauger zu benutzen.
»Man darf es dir nicht zu einfach machen! Sonst lernst du ja wieder nichts! Du kapierst nicht! Du allein bist schuld. Wenn du nicht mit anderen rummachen würdest, hätte ich keinen Grund, dich zu bestrafen! Sieh mal in den Spiegel! Du siehst verboten aus! Die Lippe aufgeplatzt, die Augenbraue, eine Schwellung unter dem Auge. Es ist nicht zu fassen, dass du mich zu so etwas zwingst! Da möchte ich doch am liebsten gleich noch mal zuschlagen!«
Schweigend hörte sie ihm zu.
Sie war keine Schönheit – war es nie gewesen. Zu Beginn ihrer Beziehung hatte Manuel das nicht gestört. Im Gegenteil. Mit einer Art Besitzerstolz hatte er ihre üppigen Rundungen gestreichelt und über andere Frauen im Freundeskreis abwertend als »Hungerhaken« gesprochen. Das galt längst nicht mehr. Zu dick, zu wenig Haar, die Augen zu weit auseinanderstehend, der Mund nicht sinnlich, die Lippen nicht voll genug. Da fielen die aktuellen Blessuren kaum ins Gewicht, fügten sich eher ins Gesamtbild. Seine Kritik nahm kein Ende und die »Hungerhaken« zogen mittlerweile seine Blicke magisch an.
Sie saugte den Teppich ab.
Tupfte immer wieder vorsichtig und unauffällig das Blut von Lippe und Stirn, damit es keine Flecken im hellen Flor gäbe.
Dem Mann ihrer Freundin Hella hatte es hinterher wenigstens immer leidgetan.
Nach jeder Prügelattacke heulte der und bat um Verzeihung, schwor, dass er nie wieder die Hand gegen sie erheben würde. Eilig drängte sie den Gedanken an Hella zurück. Erst vor zwei Wochen war die Beerdigung gewesen. Hella, nur eines von mehr als hundert weiblichen Todesopfern häuslicher Gewalt pro Jahr. Hirnblutung nach stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Schädel, hatte in der Zeitung gestanden. Hellas Mann benutzte gern Gegenstände zur Züchtigung, um seine empfindlichen Hände zu schonen. Chirurgenhände. Das Desinfektionsmittel brannte sonst in offenen Abschürfungen und möglicherweise wären Erklärungen fürs OP-Team notwendig geworden. Das ließe sich ja vermeiden, hatte er Hella erklärt.
Der Prügler wartete in Handschellen vor dem Sarg. Der Mörder. Unerträglich. Und vor allem: zu spät verhaftet. Zu spät, um das Prügeln zu verhindern, zu spät, um die Freundin zu retten.
Am Grab von Hella hatte sie beschlossen, ihr Leben und das von Julian zu retten.
Heute.