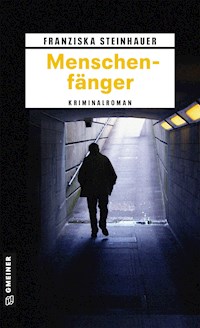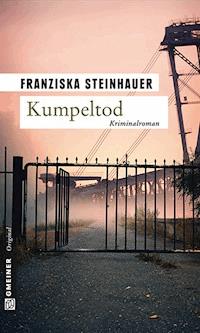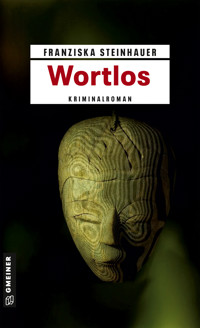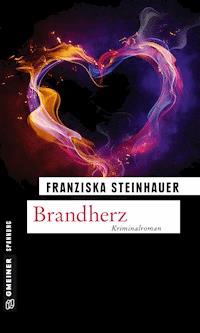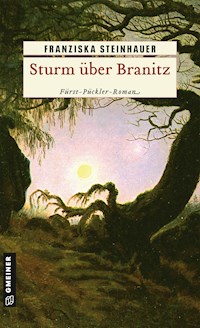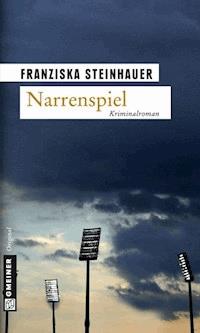10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Peter Nachtigall
- Sprache: Deutsch
Als eine junge Frau am Morgen nach einer Party erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden wird, scheint die Lösung des Falls zunächst recht einfach: Die Gäste entstammten alle der Cottbuser Parkyszene, offensichtlich war die Situation im Alkohol- und Drogenrausch eskaliert. Doch im Zuge der Ermittlungen tauchen immer mehr Verdächtige auf, von denen jeder ein ausreichendes Motiv für einen Mord gehabt hätte - aber nichts ist greifbar oder verwertbar. Dann erhält Hauptkommissar Peter Nachtigall einen Hinweis, der den Fall in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt, und ihm bleibt nur noch wenig Zeit, um weitere Morde zu verhindern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Franziska Steinhauer
Seelenqual
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2006 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines
1
Montag
Die Wohnung war mit einem Mal erschreckend leer.
Die Wände schienen sich auf sie zuzuwälzen, zogen sich wieder zurück, dehnten sich, beulten sich nach innen oder außen. Es war schwierig aufzuräumen, wenn man nicht sicher wusste, wo der Gegenstand sich befand, nach dem man greifen wollte. Sie würde mit Falco reden müssen – so ein Zeug sollte er ihr bloß nicht noch mal andrehen!
Vielleicht würde ein Schluck Wasser helfen.
Langsam tastete sie sich durch die Dunkelheit in die Küche. Jimmy Hendrix’ Stimme erfüllte die ganze Wohnung. Woodstock. Er singt für mich ganz allein, dachte sie entrückt, nur für mich.
Überall brannten Kerzen. Sie bildeten Inseln des Lichts und warfen bizarre, lebendig erscheinende Schattenfiguren an Wände und Decke. Plötzlich kamen sie ihr nicht mehr gemütlich vor – sie wirkten bedrohlich, als könnten sie sich jeden Moment von der Tapete lösen, um nach ihr zu greifen und sie ins Verderben zu ziehen. Schauer huschten über ihren Rücken. Sie fühlte sich von tausend Augen beobachtet. Jeder Schritt wurde aufmerksam verfolgt.
Das Gehen fiel ihr schwer – der Fußboden schien sich immer wieder wellenförmig vor ihr aufzuwerfen. Seltsame, filigrane Tiere in pink und blau mit Flügeln aus hellgrünem, glänzendem Metall schwammen darin. Versuchte sie über die Erhebungen zu klettern ohne eines der zarten Wesen zu verletzen, lösten sie sich mit der Welle in bunten Wolken auf und sie trat unnötig hart auf, geriet ins Taumeln. Nur gut, dass keiner meiner Nachbarn etwas sehen kann, sie lachte leise, die Vorhänge waren zum Glück alle geschlossen.
Ein Geräusch ließ sie herumfahren.
Verstohlene Schritte.
Die heftige Bewegung verstärkte den Schwindel und sie wäre beinahe zu Boden gestürzt.
Mit zusammengekniffenen Augen versuchte sie in der Dunkelheit etwas zu erkennen.
Waren doch noch nicht alle gegangen?
Sie schalt sich eine Närrin, die sich von den Schatten der Kerzen ins Bockshorn jagen ließ. Die Party war vorbei – und eigentlich konnte sie die Kerzen jetzt löschen und die Deckenbeleuchtung einschalten!
Ihre Hand tastete nach dem Lichtschalter.
Ihr Atem stockte.
Auf dem Schalter lag die kühle, glatte Lederhand eines anderen!
In ihrem Kopf gab es eine heftige Explosion, als sie sich darum bemühte einen klaren Gedanken zu fassen. Ihr Puls raste und ihr Atem ging viel zu schnell. Da war jemand in der Wohnung, es war keiner ihrer Gäste, die waren schon alle gegangen – aber das Schlimmste war, dass sie nichts erkennen konnte! Vielleicht lehnte da eine dunkle Gestalt an der Wand – oder auch nicht. Jedenfalls bewegte sie sich nicht.
Oh, Shit – warum kann ich nicht mehr richtig denken?, überlegte sie träge. Undeutlich wurde ihr bewusst, dass sie allen Grund hätte sich zu fürchten. Sie versuchte sich daran zu erinnern, ob man das, was hier gerade geschah einen Überfall nannte, kam aber zu keinem abschließenden Ergebnis. Vage erkannte sie, dass sie solch eine Situation befürchtet hatte. Ihr fiel wieder ein, dass sie sich bedroht gefühlt hatte – deshalb waren auch immer alle Vorhänge zugezogen und die Wohnungstür abgeschlossen gewesen, erinnerte sie sich mühsam. Aber – wie war die Gestalt dann hereingekommen? Hatte sie vergessen nach Marlin wieder abzuschließen?
»Wer bist du? Ich kann dich nicht sehen!«, der Kloß in ihrem Hals ließ ihre Stimme fremd klingen. Einen Moment lang lauschte sie den Worten nach, unsicher, ob sie sie wirklich ausgesprochen oder nur gedacht hatte.
»Dein Tod.«
Was war das denn für eine kryptische Antwort? Bereitwillig entstanden in ihrem Kopf Bilder eines Sensenmannes mit Totenkopf und schwarzem Umhang – fröhlich tupften Jimmy Hendrix und Falcos Pillen ein paar bunte Blumen darauf. Trotz ihrer Angst konnte sie das aufsteigende Kichern nicht gänzlich unterdrücken – es hatte allerdings selbst in ihren Ohren einen hysterischen Klang.
»Gut – wir müssen aufräumen. Du kannst helfen!« Wahrscheinlich war alles nur ein Spaß. Irgendwer wollte ihr einen Mordsschrecken einjagen und hatte im Dunkeln gewartet bis alle Partygäste gegangen waren. Ihre Freunde hatten mitunter einen seltsamen Humor. Mit aufschießender Panik fiel ihr Udo ein. Was, wenn es Udo war?
»Ja – ich bin auch zum Aufräumen hier«, flüsterte die fremde Stimme in ihr Ohr.
Als sie die lange spitze Klinge aufblitzen sah, wusste sie plötzlich, dass sie nicht über dieselbe Art Aufräumen gesprochen haben konnten.
Sie wollte weg.
Doch ihre Bewegungen waren unkoordiniert, die Beine gehorchten ihr nicht. Eine Hand packte sie schmerzhaft am Handgelenk und riss sie zurück, die andere presste sich fest auf ihren Mund. Alles begann sich wild zu drehen, ihr wurde übel. Der Boden schien auf sie zuzustürzen und sich dann in rasendem Tempo wieder von ihr zu entfernen. Mal war alles um sie her blau, mal grün, dann violett. Was war das nur für ein Scheißzeug, das Falco ihr da untergejubelt hatte!
»Du wirst sterben – langsam. Nutze die Zeit um über dich nachzudenken!«, mahnte die Stimme, die von weit her zu kommen schien, nachdrücklich.
Das Messer drang tief in ihre Seite ein und die Knie knickten unter ihrem Körper weg. Langsam rutschte sie an der Wand entlang auf den Boden. Es tat gar nicht so weh, wie sie befürchtet hatte. Die Gestalt beugte sich über sie und stach wieder zu, immer wieder – sie zählte nicht mit.
Der enge Flur füllte sich mit dem metallischen Geruch nach frischem Blut. Ihrem Blut. Warm konnte sie es um sich herum spüren. Die Gedanken verschwammen.
Du stirbst. Einen Moment lang war sie belustigt. Es war einfach lächerlich in einem Flur zu sterben – auf jeden Fall nicht das, was sie sich ausgemalt hatte. Sie wartete auf den finalen Stoß, doch der kam nicht. Das Türschloss schnappte – sie war wieder allein!
Vielleicht kann man mir noch helfen, fiel ihr ein, wenn jemand käme, könnte man mich ins Krankenhaus bringen und dort würden sie die Stiche einfach wieder zunähen.
Sie musste nur die Tür erreichen.
Der Boden unter ihr war feucht und glitschig. Sie mobilisierte alle Kräfte und schob sich auf die Tür zu. Sie keuchte vor Anstrengung – die Luft wurde knapp. Quälend langsam kam sie voran.
Ich könnte um Hilfe rufen, schoss ihr ein neuer hoffnungsvoller Gedanke durch den benebelten Kopf.
Doch der Schrei geriet nur zu einem heiseren Krächzen.
Sie fror erbärmlich.
Mit größter Anstrengung gelang es ihr mit dem rechten Fuß gegen die Tür zu treten. Zufrieden lauschte sie dem dumpfen Geräusch nach und wartete. Doch ihre sonst so aufmerksamen Nachbarn schienen nichts gehört zu haben. Für einen zweiten Versuch fehlten ihr Kraft und Entschlossenheit.
Du verblutest in deinem eigenen Flur. Stirbst allein!
Wie lange konnte es dauern, bis alles Blut aus ihr herausgelaufen war? Minuten, Stunden? Der Schatten wollte, dass sie ihre verbliebene Zeit zum Nachdenken nutzte – würde er sie retten, wenn sie das richtige dachte? War das der Schlüssel zur Rückkehr ins Leben?
Nein – wahrscheinlich nicht. Sie war allein.
Denk nach! Denk nach!
Müde schloss sie die Augen und wartete auf das gleißende, helle Licht am Ende des Tunnels.
Das sonderbare Geräusch hinter der Wohnungstür im Erdgeschoss ließ ihn zusammenzucken. Er zögerte.
Vorsichtig trat er direkt an die schwere Holztür heran und lauschte. Doch in der atemlosen Stille konnte er nur sein eigenes Blut rauschen hören.
Wie beim Schlüssellochgucken ertappt, sah er sich verstohlen um und trat dann wieder einen Schritt zurück um seinen mühevollen Aufstieg in den vierten Stock fortzusetzen, da hörte er es wieder. Ein Scharren, oder Röcheln.
Eilig wandte er sich wieder um und klopfte gegen die Tür.
»Kindchen, ist mit Ihnen alles in Ordnung?«
Als keine Antwort kam, versuchte er es ein zweites Mal.
»Brauchen Sie vielleicht Hilfe?« Das kam schon lauter und eindringlicher. »Einen Arzt?«
Wieder war kein Laut aus der Wohnung zu vernehmen.
Was bin ich doch für ein alberner alter Opa. Samuel Engel sah peinlich berührt auf seine Schuhspitzen.
Dabei bemerkte er die dunkle, zähe und klebrige Flüssigkeit, die durch den Türspalt suppte und nur noch teilweise vom Fußabtreter aufgehalten werden konnte.
»Blut!«, flüsterte Samuel Engel schockiert. »Das ist Blut!«
2
Seufzend ließ sie sich auf ihrem Stammplatz nieder. Ihr Atem ging rasselnd und pfeifend. Die feisten Unterarme stützte sie auf einem dicken Sofakissen ab, damit die Gelenke nicht so schnell schmerzten. Eine Packung ihrer Lieblingskekse mit der leckeren Schokoladenfüllung und eine Thermoskanne Kaffee mit viel gehaltvoller Kondensmilch hatte sie auf einem Hocker neben sich stehen. Wenn der mobile Pflegedienst kam, würde sie schnell eine Decke darüber werfen, um sich nicht das ewige Gemecker der Schwester über ihren ungesunden Lebenswandel anhören zu müssen. Schließlich war sie alt genug um zu wissen, was ihr bekam und was nicht. Bewegung, Obst und Salat waren moderner Kram für die jungen Leute, die sich gern so einen Quatsch einreden ließen. Sie vertrug das rohe Zeug nicht und außerdem - wer war denn letzte Woche gestorben? Die vegetarische Frischluftfanatikerin aus dem Nachbarhaus, die schon immer ausgesehen hatte wie eine verschrumpelte Möhre. Und die war immerhin mehr als zehn Jahre jünger gewesen als sie. Das war wohl Beweis genug, fand sie, und der Gedanke stimmte sie ausgesprochen zufrieden.
Luise Markwart war eine Institution.
An ihr kam keiner vorbei.
Ihre listigen, grauen Augen unter der gelockten Pudelfrisur huschten eilig die Straße entlang – ihr Morgencheck. Amüsiert stellte sie fest, dass der junge Herr Menzel wohl mal wieder zu spät zur Arbeit kommen würde, sein Auto stand noch vor dem Haus. Bestimmt würde er gleich aus der Tür stürzen, das Hemd aus der Hose gerutscht, die Krawatte nur lose umgehängt, das Jackett über der linken Schulter, den Schlüssel im Mund und die Tasche in der rechten Hand – wie mindestens dreimal pro Woche. Der würde sicher bald seinen Job verlieren. Luise Markwart grinste voll boshafter Zufriedenheit.
Ihre Augen registrierten einen Falschparker vor dem CITY Hotel. Während sie mit der linken Hand nach dem schnurlosen Telefon unter dem Kissen tastete, überlegte sie: Sollte sie gleich die Polizei verständigen oder lieber noch ein bisschen warten? Vielleicht würde sie herausfinden, wohin der Fremde gegangen war. Sie beschloss, bis sie zu einer Entscheidung gekommen war, die Nummer des Wagens in ihrem Ereignisheft zu notieren, fischte blind nach der schmalen Kladde über deren Außeneinband sie einen Stift geklemmt hatte. Ordentlich schrieb sie das Datum auf eine neue Seite, unterstrich es zweimal und vermerkte das Autokennzeichen. Gehässig kichernd schob sie das Heft wieder unter das Kissen zurück und dachte weiter über den geheimnisvollen Fahrer nach. Vielleicht war es ein Besucher der jungen Frau Salm, deren Mann zurzeit in Norwegen auf einer Großbaustelle arbeitete. Das wäre doch eine wirklich interessante Neuigkeit. In aller Ausführlichkeit begann sie sich das Gespräch mit dem heimgekehrten Ehegatten auszumalen: Wie schön, dass Sie wieder zurück sind, Ihre Frau wird sich sehr freuen, und wie gut, dass Sie ihr regelmäßig einen Freund als Beistand geschickt haben, das hätte bestimmt nicht jeder bedacht, wo die arme Frau sich doch gerade nachts so ängstigte ...
Sie war noch mit dem Abwägen des Für und Wider einer Anzeige beschäftigt, als ein Streifenwagen mit Blaulicht in die Straße einbog. Luise Markwart lehnte sich weit aus dem Fenster.
Der Streifenwagen hielt vor dem übernächsten Haus. Schnell rekapitulierte sie die Namen der Bewohner. Womöglich würde jetzt einer von ihnen verhaftet. Bestimmt dieses kleine Flittchen, obwohl, man konnte nie wissen. Na ja, da konnten die Leute noch so nett sein, in ihre Seelen konnte man schließlich nicht gucken und so manch einer…
Sirenengeheul unterbrach ihre Überlegungen und von einem Moment auf den anderen war in der sonst so ruhigen Gegend die Hölle los. Ein Notarztwagen raste durch die schnurgerade Straße und kam mit quietschenden Bremsen zum Stehen. Noch bevor die Reifen zu rollen aufgehört hatten, war der Mann, wohl ein Notarzt, aus dem Wagen gesprungen und auf den Hauseingang zugerannt. Ein Rettungswagen folgte und kurze Zeit später parkte auch noch eine dunkle Limousine vor dem Haus.
Gespannt wartete Luise Markwart, was nun passieren würde. Seit Jahren war vor ihrem Fenster nicht mehr so viel los gewesen!
3
Kriminalhauptkommissar Peter Nachtigall sah dem Arzt über die Schulter, der den leblosen Körper gründlich untersuchte.
»Ich denke, sie ist verblutet. Die einzelnen Stiche waren jeder für sich nicht tödlich. Insgesamt hat der Täter sechsmal zugestochen.« Dr. Manz, ein junger Mann mit lockigem, dunklen Haar und unzähligen Fältchen um Augen und Mund, deutete auf einige deutlich sichtbare Verletzungen am Oberkörper des Opfers.
Nachtigall nickte kurz. Was für ein einsamer Tod. Ein so junges Mädchen liegt hilflos da und spürt, wie langsam das Leben aus ihr herausströmt. Muss sich dem Tod überlassen. Ihn schauderte und er war deprimiert. Wieder ein Mordopfer im Alter seiner eigenen Tochter. Unerwünschte Bilder einer Mordserie in Cottbus vom vergangenen Herbst schoben sich in sein Bewusstsein, grausige Erinnerungen an verstümmelte Körper und tiefstes Leid. Mit einer heftigen Bewegung versuchte er sie abzuschütteln. Diesmal war sicher alles ganz anders!
Er betrachtete das Opfer genauer. Sie lag auf dem Rücken – ursprünglich direkt hinter der Wohnungstür. Beim Aufbrechen und Aufschieben der Tür war ihr Körper etwas verschoben worden – aber niemand hatte erwartet, eine Tote zu finden, sie hatten gehofft sie noch retten zu können.
Die langen Haare waren blutdurchtränkt und standen steif ab. Das T-Shirt war bis zur Brust hochgeschoben, der Rock bis zur Hüfte. Sie trug einen bunten Slip. Eine Schleifspur oberhalb ihres Kopfes zeigte, dass sie versucht haben musste sich bis zur Tür zu ziehen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ihre Haut war sehr blass, die Augen geschlossen.
Peter Nachtigall atmete tief durch.
»Ist Ihnen nicht gut?«, fragte der Notarzt besorgt, doch der Hauptkommissar schüttelte den Kopf.
»Ist schon in Ordnung. Geht mir an Tatorten immer so.«
»Ach wirklich? Das überrascht mich – viele Ihrer Kollegen sind da schon abgehärteter.«
War das als Kritik zu verstehen? Weichei statt Jäger?
»Bei mir funktioniert das Denken besser, wenn ich alle Sinne beisammen habe. Emotionale Kälte friert das Denken ein – gebe ich manchmal gerne zu bedenken.«, parierte er.
Dr. Manz zog den Kopf ein und wandte sich wieder der Untersuchung des Opfers zu.
»Wie lange hat es gedauert, bis sie tot war?«
Immer noch verlegen antwortete der Notarzt: »Das kann ich nicht ganz genau sagen - aber so ungefähr 25-30 Minuten.«
Peter Nachtigall starrte ihn entgeistert an. »Soll das heißen, sie hat eine endlose halbe Stunde lang gewusst, dass sie sterben muss, und hat nichts anderes tun können, als auf den Tod zu warten?«
Der Arzt nickte zögernd.
»Ganz so ist es nicht. Das Bewusstsein trübt sich. Am Ende hat sie wohl kaum noch etwas mitbekommen.«
Hinter Nachtigalls Stirn begann es zu pochen.
»Erstaunlich wenig Blut, oder?«, fragte er nach einer längeren Pause.
»Sie dürfen nicht glauben, dass alles Blut aus dem Körper herausfließt. So ca. zwei, drei Liter – mehr nicht. Einen großen Teil haben Kleidung und Haare aufgesogen, ein Teil wird in die Brusthöhle eingedrungen sein.«
Die zunehmende Wärme des Tages ließ die Luft in dem engen Flur unerträglich werden. Der Geruch des Blutes überlagerte alles andere und Nachtigall hatte plötzlich das Gefühl hier keine Sekunde länger bleiben zu können. Er unterdrückte den Impuls hinauszulaufen und fragte stattdessen:
»Neben dem Opfer lag dieses Küchenmesser. Das ist ein Filiermesser. Keine Zahnung, glatt geschliffen, ausgesprochen scharf mit sehr schmaler Klinge und einer deutlichen Verbreiterung zum Schaft hin, sehen Sie hier. Würden Sie das für die Tatwaffe halten?« Er zeigte dem Arzt einen transparenten Beutel mit einem blutverschmierten Messer.
»Gut möglich. Die Breite am Griff könnte hinkommen«, meinte der Arzt zögernd. »Der Pathologe kann das ziemlich genau feststellen.«
Nachtigall nickte.
»Wohin genau treffe ich, wenn ich an dieser Stelle zusteche?«
»Eventuell direkt in den Herzbeutel. Dann wäre sie praktisch sofort tot gewesen. Aber hier hat der Täter wohl knapp daneben gezielt. Zwei der Stiche haben wahrscheinlich die Lunge verletzt. Wie tief sie sind, kann ich nicht feststellen.«
»Sie war also nicht sofort tot, hmm. Der Zeuge hat ja auch Geräusche hinter der Tür gehört.«
»Was hier genau passiert ist, wird die Obduktion ergeben. Aber das viele Blut deutet darauf hin, dass die junge Frau verblutet ist. Und die Geräusche, die der Zeuge gehört haben will, müssen nicht unbedingt bedeuten, dass sie zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat. Die Körpertemperatur spricht auch dagegen – sie ist bestimmt schon seit drei bis vier Stunden tot.«
»Also seit vier oder fünf Uhr. Und was hat der Zeuge dann hinter der Tür gehört?«
»Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass Tote nicht zu hören sind.«
Peter Nachtigall sah den Arzt verblüfft an und wartete schweigend, dass der andere diese Äußerung weiter ausführen würde. Der Arzt machte allerdings keinerlei Anstalten.
»Ich fürchte, das müssen Sie mir erklären.«, hakte der Hauptkommissar deshalb nach.
»Beim Einsetzen und Lösen der Totenstarre kann es zu Bewegungen an den Extremitäten kommen. Liegt das Bein dann auf dem Boden oder lehnt an einer Wand, ist ein leises, schleifendes Geräusch nicht auszuschließen. Luft kann austreten, was sich durchaus wie ein Röcheln oder Stöhnen anhört.«
»Dann hat sie also nicht mehr gelebt, als der Mieter die seltsamen Laute gehört hat.«
»Sie ist definitiv schon seit ein paar Stunden tot.«
»Unheimlich. Eine Tote macht auf sich aufmerksam, als wolle sie erreichen, dass die Tat so schnell wie möglich gesühnt wird«, flüsterte Nachtigall abwesend.
»Herr Hauptkommissar?«
Peter Nachtigall drehte sich zu Phillip Schmidt, einem Mitarbeiter der Spurensicherung, um.
»Wir sind soweit fertig. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt lüften. Sehen Sie mal, hier im Flur haben wir an der Wand sowie an dieser schmalen Kommode Schleuderspuren gefunden. Das bedeutet: Der Fundort ist identisch mit dem Tatort. Unter dem Körper findet sich eine Lache, aus der Blut zur Tür geflossen ist. Auch die Schleifspuren stützen die These, dass sie sich selbst zur Tür bewegt hat. Soweit passt alles zusammen«, erläuterte er seine ersten Befunde akribisch.
»Schleuderspuren?«
»Wenn sie ein blutiges Messer aus einer Wunde ziehen und ausholen um erneut zuzustechen, entstehen selbst durch kleine Blutstropfen charakteristische Muster, die uns beweisen, dass hier an dieser Stelle mehrfach zugestochen wurde.«
»Aber wenn jemand sie hier attackiert hat, hätte doch das ganze Haus durch den Krach alarmiert werden müssen. Direkt hinter der Wohnungstür.«
Der Kollege schüttelte den Kopf.
»Sie wurde hier getötet. Dafür spricht auch, dass sonst nirgends in der Wohnung Blut zu sehen ist. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Warum ihr keiner geholfen hat, weiß ich auch nicht.«
»So ein junges Mädchen. Ob sie hier ganz allein gewohnt hat?« Albrecht Skorubski, der sich den Anblick der Opfer am liebsten ersparte, war schon in den Wohnraum vorgegangen und sah sich dort um. Er nickte Nachtigall zu, als dieser zu ihnen stieß.
»Hat sie«, antwortete Michael Wiener, das jüngste Mitglied in Nachtigalls Team, prompt. »Herr Samuel Engel hat uns verständigt. Seine Angabe nach handelt es sich bei dem Opfer um Friederike Petzold, die Mieterin der Wohnung.« Sein badischer Akzent war nur noch schwach herauszuhören, was, so hoffte Peter Nachtigall, erhalten bleiben würde. Er empfand die Sprachmelodie als angenehm und gemütlich.
»Frag doch mal im Haus nach, ob jemandem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Vielleicht gab es einen lauten Streit. Sie wurde im Flur getötet – vielleicht hat doch einer der anderen Mieter etwas gehört. Und wir brauchen Informationen über die junge Frau, ihre Lebensweise, ihre Interessen und so weiter. Was wir kriegen können.«
Michael Wiener nickte dem Hauptkommissar zu und lief eilfertig davon, froh dem Geruch und dem Anblick des Todes entkommen zu können.
»Schon wieder eine Mädchenleiche.« Albrecht Skorubski seufzte. »Dabei steckt mir noch die Sache von letztem Winter in den Knochen!«
»Hör bloß auf zu unken.« Nachtigall drohte dem Kollegen mit ausgestrecktem Zeigefinger. »So etwas passiert schließlich nicht jedes Jahr!«
Er trat ans Fenster und öffnete es weit, dann drückte er auch die Terrassentür auf. Obwohl es noch früh am Morgen war, ließ sich die belastende Schwüle des Tages schon erahnen. Es ging kein Luftzug.
»War die Tür zur Terrasse eigentlich verriegelt?«, rief er Phillip Schmidt nach, der gerade die Wohnung verlassen wollte.
»Nur zugezogen.«
Schon wieder eine Mädchenleiche, Albrecht hatte recht, sie alle hatten den Fall vom letzten Herbst noch nicht verarbeitet.
Kurz vor Weihnachten hatten sie einen Serientäter in Cottbus gejagt, der drei junge Frauen ermordet und grauenhaft verstümmelt hatte. Peter Nachtigall hätte damals um ein Haar seine eigene Tochter an den psychopathischen Täter verloren. Noch jetzt, acht Monate später, wachte er manchmal schweißgebadet auf, weil ihn die schrecklichen Bilder bis in seine Träume verfolgten.
Er gab zwei Herren in dezenten, grauen Anzügen ein Zeichen. Die Hände der Toten steckten in Tüten, die eventuell vorhandene Gewebe- oder Faserreste auf dem Transport in die Pathologie sichern sollten. Die Träger hoben das Opfer zunächst in einen dunklen Kunststoffsack und danach in einen Metallsarg. Ein forensischer Pathologe würde die Obduktion durchführen. Nachtigall hoffte, es würde Dr. Pankratz aus Potsdam sein, ein Gerichtsmediziner, den er schon seit Jahren kannte und dessen Urteilsvermögen er sehr schätzte.
Als das Opfer abtransportiert war, erkundete er die einzelnen Zimmer der kleinen Wohnung.
»Sieht nach einer wilden Party aus, wie? Das sind mindestens fünfundzwanzig leere Flaschen! Und was für ein Zeug!« Albrecht Skorubski klang beeindruckt.
»Hochprozentiges. Lauter billiger Fusel.«
»Billig aber wirksam«, mischte sich der Notarzt ein und ließ seinen Koffer geräuschvoll zuschnappen. »Die jungen Mädchen üben sich heutzutage im Kampftrinken! Je schneller das Koma erreicht wird, desto besser. Womit ist gleichgültig. In der Notaufnahme liegen jedes Wochenende ein paar Opfer!«
»Reiche Ernte für den Erkennungsdienst!«, frotzelte Skorubski und fuhr sich mit beiden Händen über seine fast perfekte Glatze, die er wegen der zu erwartenden Hitze heute nicht unter seiner Schirmmütze versteckt hatte. »Mit ein bisschen Glück haben wir einige der Partygäste in unserer Datei.«
Die Luft in dem engen Wohnzimmer war abgestanden. Überall Gläser, Flaschen oder überquellende Aschenbecher. Nachtigall entdeckte zwischen den Zigarettenkippen Reste von Joints. Die Sonne schien durch schmutzige Scheiben und das Licht fiel erbarmungslos auf graue Essensreste, verdrecktes Geschirr, fleckige Polster und einige größere Lachen auf dem Boden, die wie Erbrochenes aussahen. Ein widerlicher Geruch lag über dem ganzen Raum, süßlich und Ekel erregend.
Ging Jule auch zu solchen Partys, die in irgendwelchen schmuddeligen Wohnzimmern, in denen gekifft, getrunken und wer weiß noch was, veranstaltet wurde? Nachtigall hoffte, so etwas wäre ihr zuwider, aber es wurde ihm wieder einmal schmerzlich bewusst, dass er über vieles, was seine Tochter tat, nicht Bescheid wusste. Da ging es ihm nicht besser als den meisten anderen Vätern.
»Na sieh mal einer an, wenn das keine kleinen Glücksbringer sind!« Paul Feddersen vom Erkennungsdienst hielt ein transparentes Tütchen mit bunten Tabletten hoch.
»Tolle Party, alle Achtung!«
»Das Labor …«
»… soll für euch rauskriegen, was das für ein Zeug ist. Schon klar.« Damit schob Paul Feddersen das Tütchen in einen zusätzlichen Beutel und beschriftete ihn sorgfältig.
Ein strubbliger Rotschopf erschien in der Tür.
»In der Toilettenschüssel schwammen drei benutzte Kondome, im Mülleimer haben wir zwei weitere gefunden und im Schlafzimmer liegen lauter aufgerissene Packungen. Einen Teil der Flecken auf der Polsterung der Couch halten die Kollegen für Sperma, alles andere muss noch untersucht werden.«
»Ab damit ins Labor «, wies Peter Nachtigall den Kollegen an.
»Das war wohl eher eine Orgie als eine Party. Bestimmt gab es am Ende Streit und einer der Gäste hat die junge Frau im Alkoholnebel erstochen.« Albrecht Skorubski war erleichtert. Ein klarer Fall. Der Täter würde wohl schnell gefunden werden. Endlich mal eine gute Presse für die Polizei.
»Das glaube ich nicht. Für mich sieht es nach einem überlegt durchgeführten Mord aus. Glaub mir, so einfach ist die Lösung nicht«, orakelte Peter Nachtigall düster und Skorubski zog kritisch eine Braue hoch.
»Wieso? Intuition?«
»Ja, vielleicht. Ich glaube, dass die Verletzungen absichtlich so gesetzt wurden, damit sie langsam verblutet. Sie sollte leiden!«
Albrecht Skorubski seufzte ergeben. Er hatte in den vielen Jahren ihrer Zusammenarbeit gelernt, dass Nachtigall sich in solchen Fragen nur selten täuschte. Ein wenig angeschlagen, versuchte er sich von der Vorstellung zu verabschieden, dieser Fall sei schnell und unkompliziert zu lösen.
4
»Herr Engel, können Sie mir etwas mehr über das Opfer erzählen? Um den Täter möglichst schnell zu fassen, müssen wir uns ein genaues Bild von der jungen Frau und ihren Lebensumständen machen können.«
»Tja, was soll ich Ihnen dazu sagen?« Samuel Engels Stimme klang brüchig. Sie saßen in seinem Wohnzimmer, in dem es muffig und staubig roch. Die verschlissene Couchgarnitur, schätzte Michael Wiener, war alt, die Tapete vergilbt und an einigen Stellen löste sie sich von der Wand. Die Schäden würden bald unübersehbar sein. Alles hier wirkte vernachlässigt, selbst der Garderobenspiegel war trübe geworden und von Wand zu Wand hatten fleißige Spinnen eifrig dicke Gespinstfäden gezogen, an denen der Staub haften blieb. Dunkle Vorhänge sperrten das helle Sonnenlicht so komplett aus, als hause hier ein Vampir.
»Die Kleine war halt ein bisschen ungestüm. Sie hat ganz gerne Leute zu sich eingeladen und – wie’s bei den jungen Dingern heute so ist – wurde es schon mal ein wenig lauter. Deswegen haben die anderen sie auch nicht leiden können.«
»Sie war also nicht sehr beliebt im Haus?«
»Ha!«, lachte der alte Mann unfroh, »nicht beliebt ist eine nette Umschreibung! Die anderen konnten das Mädchen nicht ausstehen! Immer wieder gab es bei der Wohnungsgesellschaft Beschwerden über sie. Aber ich habe immer zu ihr gehalten. In ein Haus voller alter Menschen gehört doch auch ein bisschen junges Gemüse. Sonst verlieren wir Greise auch noch den allerletzten Kontakt zum Leben.«
Während er sprach, gestikulierte er wild mit seinen knochigen Händen und seine vertrockneten Züge wurden lebhaft. Dann, als er sich an den schrecklichen Anblick der Ermordeten erinnerte, verschwand dieses zaghafte Leuchten aus seinen Augen und er wirkte wieder grau und einsam.
»Was für Leute kamen denn zu ihren Partys?«
»Auch so ein Streitpunkt. Es kamen eben die jungen Leute aus dem Park. Die alten Zimtzicken, die hier im Haus wohnen, haben dann die ganze Nacht nicht schlafen können, weil sie Angst hatten, die kämen nach der Party bei ihnen vorbei um sie auszurauben! Nein, nein. Beliebt war sie weiß Gott nicht in diesem Haus.« Er schüttelte den Kopf.
»Frau Junghans, Sie wohnen auf derselben Etage wie das Opfer, was können Sie uns über Friederike Petzold sagen?«, begann Michael Wiener höflich mit der Befragung der Nachbarin des Opfers. Er war froh hineingebeten worden zu sein – einige der anderen Mieter hatten ihn nur kurz an der Wohnungstür abgefertigt. Sie waren sich einig gewesen: Dazu gibt es nichts weiter zu sagen, die hat nichts getaugt und es ist nicht schade um sie. Wer das Schicksal zu oft herausfordert, den erwischt es eben.
Dann hatten sie die Türen wieder geschlossen und ihn etwas ratlos im Flur stehen lassen.
Er sah sich in der freundlichen Wohnung von Frau Junghans um. Licht flutete durch streifenfreie Fenster, die Möbel waren modern und in einem hellgrünen Ton gehalten. Zarte Regale zogen sich an den Wänden entlang und boten Platz für eine große Anzahl Bücher. Kaum zu glauben, dass die Wohnung den identischen Zuschnitt haben sollte, wie die finstere Höhle von Samuel Engel.
»Obwohl man über Tote nicht schlecht sprechen soll, muss ich Ihnen aber doch sagen, dass es mit diesem jungen Mädchen als Nachbarin kaum auszuhalten war! Das hätten Sie ohnehin ganz schnell herausgefunden – die ganze Straße hat unter ihrer Anwesenheit gelitten. Noch eine Tasse Kaffee?«
Michael Wiener sah zu, wie sie mit perfekt manikürten Fingern am Verschluss der Thermoskanne hantierte und dann die geblümten Tassen wieder auffüllte.
»Wie kann eine ganze Straße unter ihr gelitten haben?«
»Na – durch sie ist dieses ganze asoziale Pack aus den Parks doch überhaupt erst hierher gekommen! Früher gab’s so was nicht. Sie wissen schon, ich meine diese jungen Männer, die Ratten in ihren Parkataschen halten, zu faul zum Arbeiten sind und nur in den Tag hinein leben – auf Kosten der Allgemeinheit!«
Ihre Empörung war unübersehbar echt. Selbst ihre Wangen hatten sich mit einer zarten Röte überzogen.
»Und bevor Frau Petzold eingezogen ist, gab’s das nicht?« Michael Wiener sah sie skeptisch an.
»Nein, nie. Aber seit sie hier wohnt, treibt sich dieses finstere Gesindel den ganzen Tag lang in unserer Straße ’rum. Meine Mutter sagte zu solchen Typen immer Lumpenpack – und das trifft es auch ganz genau. Sie als Polizist wissen es sicher: Wo die auftauchen, wird gestohlen und schließlich wohnen hier überwiegend ältere Menschen! Wie leicht kann einem da mal die Handtasche entrissen werden!«
»Ist so etwas denn vorgekommen?«
»Na ja – man liest und hört doch ständig davon. Sicher wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen!«
Michael Wiener räusperte sich.
»Hat sie denn öfter solche Partys gefeiert?«
»Ja, jedes Wochenende. Und immer mit dieser lauten Hottentottenmusik! Grauenhaft! Es war ein einziges Gegröle! Ich hatte sogar überlegt an den Wochenenden zu meiner Schwester zu fahren um mir das zu ersparen – aber wenn solche Typen im Haus sind, kann man seine Wohnung nicht guten Gewissens alleine lassen. Und dann stapft dieses Gesocks mit seinen verdreckten Schuhen die Treppe hoch – und immer musste ich dann den Dreck wegputzen! Schließlich hat sich die junge Dame nicht einmal an der Kehrwoche beteiligt. Wahrscheinlich wollte sie sich ihre zarten Fingerchen nicht schmutzig machen. Also, wenn Sie mich fragen: Um die ist es nicht schade!«
Vor Wut wurde sie direkt kurzatmig.
»Ach, ja. Die arme Kleine.«
Fassungslos schüttelte Maria Gutmann aus dem zweiten Stock den Kopf und wischte sich mit zitternden Fingern ein paar Tränen aus den Augen.
»Wenn Sie schon bei den anderen im Haus waren, wissen Sie auch bereits, wie die über sie dachten.«
Michael Wiener nickte und reichte ihr einen Liter Milch aus einer der Einkaufstüten. Sanft lächelnd verstaute sie die Packung im Kühlschrank.
»Wissen Sie, Sie müssen mir nicht dabei helfen. Ich kann die Sachen auch später wegräumen.«
»Ach wo – wenn ich Ihnen schon Fragen stellen muss, kann ich Ihnen dabei auch ein wenig zur Hand gehen.«
»Ihre Oma hat Glück so einen Enkel zu haben.« Der junge Mann errötete.
»Danke. Meine Oma ist aber auch ganz besonders nett.«
»Sie mögen Ihre Oma sehr.« Die schmächtige alte Dame lächelte ihn schelmisch an. »Sie wirken so erfahren im Umgang mit älteren Damen. Tee?«
Sie setzte Wasser auf.
»Die Kleine war den Leuten hier ein Dorn im Auge. Angeblich hörte sie zu laute Musik – ja, Altersschwerhörigkeit kann auch ein Segen sein – diese ach so wichtige Kehrwoche hat sie ignoriert, bei ihr gingen immer viele Menschen ein und aus. Manchmal ziemlich gammlige Typen, ärmlich, runtergekommen. Das hat die anderen Mieter gestört und sie haben sogar versucht sie rauszuekeln. Aber mal ernsthaft: Wo kommen wir denn da hin, wenn die anderen Mieter anfangen einem vorzuschreiben, wer zu Besuch kommen darf und wer nicht! Und nun hat sie also jemand ermordet.«
»Kennen Sie denn diese Besucher näher? Vielleicht vom Sehen?«
»Nein, aber vielleicht würde ich den einen oder anderen wiedererkennen. Wenn da so ein frierendes, abgerissenes Bündel vor ihrer Tür stand, habe ich mich oft gefragt, ob es denn da keine Mutter gibt, die für den Jungen sorgen könnte – oder irgendeine staatliche Stelle, die ihm helfen würde. Aber so.«
»Es kamen also wirklich Streuner aus dem Park zu Frau Petzold?«
»Ja. Regelmäßig. Auch obdachlose Frauen waren dabei.«
»Aha. Hat sie denen geholfen – oder was wollten die bei ihr?«
Maria Gutmann sah ihn lange nachdenklich an, als suche sie die passende Formulierung. Dann sagte sie:
»Feiern und das Elend vergessen, denke ich.«
5
»Herr Nachtigall?«
»Ja – hier drüben!« Sein hochroter Kopf tauchte hinter der Couch auf. In der Hand hielt er einen braunen DIN-A-5 Umschlag, den er zwischen den Polstern des Sofas herausgezogen hatte. Er war dick und fühlte sich hart an. Flüchtig warf Peter Nachtigall einen Blick hinein, während er Paul Feddersen zuhörte.
»Im Schlafzimmer haben wir Psychopharmaka gefunden. Vielleicht wissen die Eltern, bei wem sie in Behandlung war.«
»Antidepressiva?«
In dem Umschlag steckten Fotos. Die würden sie sich später ansehen. Sie waren gut versteckt gewesen – niemand bewahrte seine Urlaubsfotos an solch einem Ort auf. Ein Geheimnis also? Peter Nachtigalls Gedanken schweiften so weit ab, dass er regelrecht zusammenfuhr, als Paul Feddersen seine Frage beantwortete.
»Sieht so aus. Auf jeden Fall verschreibungspflichtig.«
»Danke, Paul.«
»Das werden wir bei der Obduktion erwähnen. Möglicherweise wirkte das Medikament in Zusammenhang mit Alkohol betäubend. Dann hatte ihr Mörder noch leichteres Spiel.«
»Ihr Handy isch verschwunde«, meinte Michael Wiener, der wieder zu seinem Team gestoßen war, enttäuscht. »Wir werde wohl einen Gesprächsnachweis beantrage müsse und dann versuche die Nummern zuz’ordne.«
»Was sagen die Mieter?« Gedankenverloren schob Peter Nachtigall den Umschlag in seine Jackentasche.
»Es gibt hier insgesamt zehn Wohnungen. Bis auf zwei sind sich alle Mieter einig: Um die ist’s nicht schade. Ganz schön deprimierend. Und natürlich hat auch keiner was gehört.«
»Nicht sehr beliebt bei der Hausgemeinschaft!«
»Also manche glaub ich, haben sie wirklich aus tiefstem Herzen gehasst.«
»Um die ist es nicht schade!«, murmelte Peter Nachtigall hilflos. »Wie kann man denn so etwas über einen anderen sagen – noch dazu, wenn er gerade Opfer eines Mordanschlags geworden ist? Was sind denn das für Menschen?«
»Was ist denn bei euch los?«
Luise Markwart hielt Maria Gutmann an, die vergeblich gehofft hatte ungeschoren vorbeihuschen zu können.
»Die Friederike Petzold ist in ihrer Wohnung ermordet worden. Mehr weiß ich auch nicht.«
»Ach, um die kleine Hure ist es nicht schade! Über kurz oder lang war bei der so was zu erwarten. Seid nur froh, dass jetzt das ganze Assipack nicht mehr bei euch im Haus rumlungert!«
Maria Gutmann zuckte bei diesen harten Worten zusammen und suchte hastig das Weite.
6
Laras Handy dudelte den Ohrwurm des ausklingenden Sommers. Sie nahm das Gespräch an, während sie gleichgültig dem Wagen ihrer Mutter nachsah, die zum Einkaufen gefahren war.
»Schalte mal das Radio ein! Friederike ist tot!«, informierte sie die Stimme eines Freundes. »Ich bin eben an der Wohnung vorbeigekommen. Überall Polizei. Ich konnte aufschnappen, dass sie erstochen wurde.«
Als Frau Meister zwei Stunden später wieder nach Hause kam, fand sie ihre Tochter verheult in der Sofaecke kauernd.
»Irgend so ein Schwein hat Friederike in ihrer Wohnung überfallen! Sie ist tot!«, schluchzte das Mädchen. »Erstochen!«
»Bestimmt war das einer von diesen Pennern. Auch wenn du das nicht hören willst, außer dir werden nur sehr, sehr wenige deiner Freundin nachweinen.«
Es war zu erwarten gewesen. Dieses Mädchen war selbst schuld. Nur gut, dass ihre Tochter nun nicht auch in dieses asoziale Milieu abgleiten würde. Ihre anderen Freundinnen waren nicht halb so auffällig wie es diese Friederike gewesen war.
»Wie kannst du nur so kalt und herzlos sein!«, heulte Lara auf und stürmte an ihrer Mutter vorbei in ihr Zimmer. Ihre Schritte dröhnten laut auf der Holztreppe.
Frau Meister zuckte zusammen als die Tür mit einem lauten Knall zuschlug.
7
Schweigend fuhren Peter Nachtigall und Albrecht Skorubski zu der Adresse in Groß Gaglow, die Michael Wiener ihnen über Funk durchgegeben hatte. Das Haus der Weinreichs war klein, in leuchtendem Orange verputzt und kuschelte sich in einen liebevoll angelegten Garten, der offenbar auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten war. Ein von einem Sonnensegel überspannter Sandkasten, ein Basketballkorb an der Wand der Fertiggarage, eine kurz gemähte Rasenfläche, Fahrräder in verschiedenen Größen ließen Nachtigall vermuten, dass das Opfer kleinere Geschwister gehabt haben musste. Blühende Büsche fanden sich in kleinen Gruppen in den Ecken des Grundstücks und unmittelbar neben dem Haus. So kamen sie spielenden Kindern kaum ins Gehege.
Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Kaum zehn Uhr und wir brechen mit so einer Nachricht da ein.«
Er ächzte, als koste es ihn viel Kraft die Beifahrertür zu öffnen. Seit seine Frau ihn damals verlassen hatte, war dieses Szenario zu seinem persönlichen Albtraum geworden: Zwei fremde Kollegen unterbrachen seine Vorbereitungen für ein gemeinsames Essen mit Jule und teilten ihm mit, seine Tochter sei getötet worden. Einsam gestorben, während er gut gelaunt pfeifend das Gemüse putzte. Und nun war es seine Aufgabe diesen Albtraum in eine ihm unbekannte Familie zu tragen. Was konnte er ihnen schon sagen? Wie konnte er ihren Schmerz erträglicher machen?
»Im Fernsehen sagen sie immer so was wie: Wir kriegen ihn – machen sie sich keine Gedanken. Und sie sagen auch: Sie hat nicht gelitten, es war ganz schnell vorbei. Und was soll ich der Mutter sagen?«, murmelte er unzufrieden. »Wir kriegen ihn - das ist mir zu pathetisch. Und was wird, wenn ich es nicht einhalten kann? Und sie hat nicht gelitten? Mann, der Typ hat ihr jede Menge Zeit zum Sterben gegeben!«
Er sah zum Haus hinüber. Die Sonne brannte auf seinen Rücken. Der Wetterbericht hatte gestimmt, es würde heute sehr heiß werden.
»Es sind Sommerferien. Vielleicht schlafen sie noch.« Skorubski, der schon halb ausgestiegen war, ließ sich wieder hinters Steuer fallen, als es im Funkgerät zu krächzen begann.
Nachtigall bedeutete ihm, er solle im Wagen bleiben und das Gespräch annehmen. Er selbst stapfte währenddessen auf die grüngestrichene Haustür zu. Überraschend schnell wurde ihm auf sein Klingeln geöffnet.
»Frau Weinreich, ich bin von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Peter Nachtigall. Kann ich Sie einen Augenblick sprechen?« Er wies seinen Ausweis vor und die Frau nickte.
»Was hat sie denn jetzt wieder angestellt?«, wollte eine unfreundliche Männerstimme aus der Ferne wissen. Aus dem oberen Stockwerk waren helle Kinderstimmen zu hören und das Trippeln nackter Füße. Ein Hund bellte begeistert. Dort wurde offensichtlich fröhlich gespielt.
»Weiß ich noch nicht!«, antwortete die Frau müde, strich sich träge die Haare aus dem Gesicht und bat den Polizisten in die Küche. »Es geht doch um Friederike, nicht wahr?«
Nachtigall nickte. Mit seinen zwei Metern Körpergröße füllte er den ganzen Raum. Aus pragmatischen Gründen trug er immer schwarz, seine langen, dunklen Haare wurden von einem Gummiband zusammengehalten. Der kleinen Frau musste er allerdings trotz seines freundlichen Gesichts wie ein finsterer Riese vorkommen.
»Frau Weinreich, es tut mir ehrlich leid, aber ...«
»Ach, was wissen Sie denn schon! Uns tut es auch leid!«, fauchte sie ihn unvermittelt an. »Seit Jahren schon. Nur Ärger. Einmal im Monat kommt die Polizei vorbei und übernimmt dabei die Türklinke aus der Hand des Jugendamts. Ja – Friederike ist schwierig. Ja – Friederike ist hier und da kriminell, hat gestohlen und Drogen ausprobiert. Aber jetzt geht sie arbeiten und wird ihren Weg machen.«
»Ihre Tochter«, er atmete tief durch. »Ihre Tochter wurde ermordet in ihrer Wohnung in der Breitscheidstraße aufgefunden.«
Fassungslos starrte sie ihn an.
»Wir gehen im Moment davon aus, dass sie am Ende einer Party in ihrer Wohnung niedergestochen wurde. Ein Mieter des Hauses hat heute Morgen die Polizei verständigt.«
Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen.
Frau Weinreich ruderte hilflos mit den Armen und sah Peter Nachtigall flehend an.
»Das ist sicher ein Irrtum. Das ist unmöglich! Sehen Sie, Friederike hat doch so viele Pläne. Sie will als Quereinsteiger ein Studium anfangen. Psychologie. Vorher eine Ausbildung im sozialen Bereich.« Tränen liefen ihr über die eingefallenen Wangen. Sie schien es nicht zu bemerken. Nachtigall registrierte die tiefen Falten, die sich von den Mundwinkeln zum Kinn zogen. Die Augen waren tief in den Höhlen versunken und dunkle Schatten lagen darunter. Friederikes Mutter sah verhärmt und desillusioniert aus. Das blondierte Haar war am Ansatz dunkel nachgewachsen, ihre Kleidung war sauber, aber abgetragen. Wahrscheinlich mussten sie sehr sparsam mit ihren finanziellen Ressourcen umgehen, überlegte Nachtigall, ein Haus gebaut, Kinder ... Und bestimmt hatten sie auch die große Tochter unterstützt.
»Es ist kein Irrtum. Ich weiß, dass das eine furchtbare Nachricht ist.«
»Sie wollte doch jetzt ganz neu anfangen. Eigene Wohnung, eigenes Leben, große Pläne. Alles sollte gut werden.«
Zitternd schlug sie ihre Hände vor das Gesicht und setzte sich rasch auf einen der Küchenstühle.
»Was geht hier vor?« Drohend baute sich ein muskulöser Hüne vor dem ungebetenen Besucher auf.
Nachtigall richtete sich zu voller Größe auf und sah auf den Mann hinunter.
Der Herr des Hauses warf einen ratlosen Blick auf die haltlos schluchzende Frau am Küchentisch, fixierte dann Peter Nachtigall mit mühsam unterdrückter Wut.
»Was hast du mit ihr gemacht, hä?«
»Kriminalpolizei Cottbus, wir…«
»Nicht schon wieder! Was ist es diesmal? Raub? Entführung? Erpressung?«
»Mord.«
Das verschlug dem Muskelpaket erst einmal den Atem.
»Ihre Tochter Friederike wurde ermordet.«
»Die ist nicht meine Tochter.«
»Sie stammt aus meiner ersten Ehe. Deshalb trägt sie auch einen anderen Namen«, flüsterte Frau Weinreich erstickt.
»Und – wer war’s?«, fragte Herr Weinreich fordernd.
»Das wissen wir noch nicht.«
»Bei dem Gesindel, mit dem die Göre Umgang hatte, wundert mich das gar nicht. Bestimmt war das einer von diesen Junkies, der bei ihr Drogen kaufen wollte.«
»Hör auf! Hör sofort auf!«, schrie die Mutter gequält auf.
»Ist ja schon gut. Du wolltest es nie wahrhaben, dass mit deiner kleinen Prinzessin etwas nicht in Ordnung war.«
»Sie sagen, sie hat gearbeitet. Wo war das?«, mischte sich Nachtigall in den beginnenden Disput.
»Sie hat bei einem Projekt mitgemacht. Für Mädchen. Das Jugendamt hat das gefördert. Zuletzt hat sie in einer Autowerkstatt gearbeitet. Das Jugendamt hatte ihr diese Lehrstelle beschafft. Nebenher hat sie ein paar Mädchen im betreuten Wohnen unterstützt. Sie hat ihnen geholfen Anträge auszufüllen, sich beim Arbeitsamt zurechtzufinden, die Schwangerschaftsberatung zu nutzen und all so was«, schniefte die Mutter.
»Ja, genau. Ich weiß noch wie prima ich das fand. Ausgerechnet die durchgeknallte Friederike betreut Mädchen mit familiären Schwierigkeiten oder Drogenproblemen. Ha!«, höhnte der Mann. »Hätte sie mal lieber versucht ihre eigenen Probleme in den Griff zu kriegen!«
»Ich muss ihren Vater informieren«, stammelte Frau Weinreich und verließ leicht schwankend den Raum.
»Ihre Tochter war ein unsägliches Biest«, stellte der Mann lapidar fest, als sie außer Hörweite war.
»Wieso?«
»Nur Schwierigkeiten. Mit der gab’s in einer Tour Stress. War aber auch eine ziemlich blöde Situation«, räumte er dann großzügig ein.
»Ihr Vater ist Eventmanager. Im Westen. Gleich nach der Wende ist der rüber. Er macht so richtig viel Kohle. Und da ist ihm nichts Besseres eingefallen, als seine Kleine an diesem Segen teilhaben zu lassen. Was wir ihr verboten haben, hat er erlaubt. Ein Anruf bei Papi genügte. Er hat ihr im Monat 700 Euro zur Verfügung gestellt und trotzdem war sie immer klamm. Weiß der Kuckuck, wofür sie das ganze Geld verjuxt hat! Sie hat alles ausgegeben, schneller als man gucken kann. Naja – und von mir hat sie sich sowieso nichts sagen lassen. Schließlich war ich nicht ihr Vater. Es war für uns alle schwer. Eigentlich hatten wir gehofft, nach dem Auszug würde nun alles besser. Tja«, er fuhr sich mit den Fingern hilflos durch die blonden Haare.
»Seit wann arbeitete Friederike?«
»Seit vier, fünf Monaten. Früher wollte sie mal Abitur machen. Aber dann hatte sie plötzlich keinen Bock mehr auf Schule und hat alles nach der Zehnten hingeschmissen. Papi hat das unterstützt. Er meinte, kein Mensch müsse sich von diesen fiesen, machtgeilen Lehrertypen unterdrücken lassen und er habe schließlich auch kein Abitur und verdiene heute mehr als genug. Friederike machte von da an nur noch Party. Die meiste Zeit wussten wir gar nicht, wo sie sich rumtreibt. Ab und an hat eine Streife sie aufgegriffen und nach Hause gebracht – entweder besoffen oder vollgepumpt mit Drogen.«
»Hat der Vater nicht eingegriffen?«
»Doch. Er hat ihr geraten eine Therapie zu machen. Hat er bezahlt. Privat. Die Psychotante hat alles nur noch schlimmer gemacht. Sie hat ihr einen Haufen Medikamente verschrieben. Und was macht die kleine Hexe? Geht stracks damit in den Park und verhökert die Pillen an die Streuner dort. Parkys nennen die sich. Große klasse!«
»Wo ist sie denn jetzt?«, mischte sich die zittrige Stimme der Mutter wieder in das Gespräch.
»In der Pathologie. Bei Tötungsdelikten wird immer eine Obduktion durchgeführt. Ich muss sie bitten mich zu begleiten, um ...«
»Ja. Ich weiß.« Sie nickte unablässig als könne sie die einmal in Gang gekommene Bewegung nur noch schwer anhalten.
»Wie viele Geschwister hatte Friederike denn?«
»Einen Bruder, der aber bei seinem Vater lebt, und zwei Schwestern aus meiner jetzigen Ehe mit Tobias.«
Es entstand eine Pause.
»Ihr Vater wird herkommen und ihren Bruder vielleicht mitbringen. Sie haben gesagt, ich sei schuld daran, dass Friederike getötet wurde. Ich hätte besser auf sie aufpassen müssen«, erklärte Frau Weinreich dumpf.
Nachtigall erinnerte sich an das Gespräch mit seiner Exfrau, als im letzten November seine eigene Tochter in die Fänge des Serientäters geraten war. Birgit hatte ihn mit Schuldzuweisungen geradezu überschüttet – als ob er sich nicht selbst genug Vorwürfe gemacht hätte. Oh, ja. Er wusste genau, wie Frau Weinreich sich jetzt fühlte.
»Für die, die weit entfernt sind, ist es immer leicht über die anderen zu urteilen. Wer sich nicht persönlich und aktiv um die Erziehung kümmert und den ganzen alltäglichen Ärger mitträgt, hat auch kein Recht auf Kritik.«, stellte er energisch fest.
Albrecht Skorubski war in der Zwischenzeit um das Grundstück der Familie Weinreich herumgegangen. Über einen Zaun gelehnt beobachtete ihn ein Nachbar neugierig. Den Oberkörper hatte er dabei seitlich auf dem Stiel seines Rechens abgestützt.
»Kann ich Ihnen helfen?«, rief der ältere Herr ihm zu und Skorubski beschloss die Gelegenheit zu einem Plausch zu nutzen.
»Danke, ich warte nur auf einen Kollegen von mir. Bilderbuchwetter heute, nicht?«
»Ein bisschen zu trocken. Für meinen Geschmack wäre mal wieder Regen fällig.«
»Ihr Garten ist ja wirklich zum Vorzeigen«, lobte Skorubski und riss damit alle Zäune der Vorsicht und Zurückhaltung mit einem Satz nieder. »Wie das bei Ihnen blüht! Sieht wirklich toll aus.« Er ließ den Blick wie beiläufig über das Nachbargrundstück schweifen.
»Na, da drüben wohnt wohl eine Familie mit Kindern. Da muss man natürlich bei der Gartengestaltung Rücksicht nehmen, sonst hat man nicht viel Freude an den Pflanzen.«
»Jaja. Familie Weinreich. Tobias und Michaela. Sonderbaren Geschmack haben die. So ein orangefarbenes Haus, das passt doch gar nicht in das Wohngebiet hier.«
»Es hebt sich ab. Die anderen Häuser sind alle weiß«, bestätigte Skorubski.
»Wir haben noch versucht denen das auszureden – aber Sie sehen ja!«
»Kennen Sie denn die Leute näher?«
»Ja, ich kannte die schon, bevor sie das Haus hier gekauft haben. Drei Kinder! Aber die älteste Tochter ist nicht von ihm. Die heißt auch ganz anders ...« Er überlegte einen Moment lang angestrengt. »Petzold. Ja genau. So heißt die. Komische Familienverhältnisse, sage ich immer, wenn die Tochter einen anderen Namen als die Eltern trägt. Da gibt es jetzt doch so einen neumodischen Namen dafür – wie war denn der – gleich fällt mir das wieder ein – englisch war das: Patchworkfamilie. Neues Wort für ein altes Problem. Aber mit der Großen haben sie nur Ärger. Ständig die Polizei im Haus. Die kleine Frau Weinreich ist schon manchmal völlig verzweifelt. Tagelang läuft die dann mit verheulten Augen rum. Aber nun ist die große Tochter ausgezogen und die beiden kleinen Mädchen sind ganz in Ordnung. Manchmal ein bisschen wild, aber so sind die Kinder heute eben.«
»Kam denn der leibliche Vater der großen Tochter auch mal zu Besuch?«
»Nee. Aber die Friederike trifft ihn ab und an in der Stadt. Ein paar Mal ist sie auch zu ihm gefahren, aber ich glaube, das mochte der Vater nicht so gern. Es gibt, entsinne ich mich, auch noch einen Bruder. Den hat sie aber immer nur beim Vater getroffen, der kam nie hierher. Der Tobias, also Herr Weinreich, der hat mir mal erzählt, der leibliche Vater hätte eine neue Familie und da gab’s wohl Ärger mit Friederike und sie durfte nicht mehr so oft zu ihrem Vater fahren. Vielleicht hat sie dort was geklaut, oder so.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
Leutselig beugte sich der Nachbar näher zu seinem Zuhörer über den Zaun. »Gegen die Kleine hat’s doch mehrere Verfahren gegeben – aber es ist ihr nie was passiert. Als hätte die einen Freibrief. So ist das eben heute, die Richter trauen sich nicht mehr, diese jungen Leute zu bestrafen und lassen sie sofort wieder laufen. So lernen die doch nix! Also, unter uns gesagt, ich für meinen Teil hätte die schon lange eingesperrt.«
»Und wie kam die Familie mir ihr klar? Gab doch sicher häufig Streit mit ihr, oder?«
»Logisch. Da wurde es schon mal so richtig laut. Die ganze Straße können Sie da fragen. Aber den meisten Ärger gibt’s, wenn das Gör nicht da ist – dann fliegen hier die Fetzen. Der Tobias, der kann sich schon gewaltig darüber aufregen, was die Tochter seiner Frau so anrichtet. Er gibt ihr die Schuld – ist ja auch ihr Gör. Ich glaube, er wäre froh, wenn die Friederike sich hier gar nicht mehr blicken lassen würde. Die bringt nur Ärger! Und was für Typen die hier immer angeschleppt hat – peinlich, sage ich nur, peinlich!«
Skorubski fragte sich, ob der Mann seine harten Worte wohl bereuen würde, wenn er in den Lokalnachrichten vom Tod des Nachbarmädchens hörte. Er warf einen forschenden Blick in die hellblauen Augen des anderen und kam zu dem Ergebnis, dass er in seiner ausgeleierten Strickjacke einen sehr gemütlichen Eindruck machte, sein Urteil aber eher nicht revidieren oder bedauern würde. Einer von denen, die immer Recht und Ordnung hochhalten, dachte er, immer nur schwarz oder weiß sehen und die Augen vor den vielen grauen Zwischentönen verschließen. Als er Nachtigall aus dem Haus kommen sah, verabschiedete er sich freundlich und erreichte mit ihm zusammen den Wagen.
»Das war die Pathologie. Dr. Pankratz ist auf dem Weg. Er ruft auf deinem Handy an, wenn er angekommen ist und alles vorbereitet hat.«
»Gut. Frau Weinreich fährt mit einer Streife hin. Sie will sich erst noch anziehen.«
»Ich habe mich mit einem Nachbarn unterhalten. Er hat bestätigt, was wir schon gehört haben: Friederike Petzold war schwierig, hatte seltsame Freunde und war auch sonst ein Umgang, den man lieber meiden sollte.«
»Die Eltern haben sich ganz ähnlich geäußert. Es muss eine dicke Akte über dieses Mädchen existieren. Es sieht so aus, als sei sie von einer Katastrophe in die nächste geschliddert. Drogen, Alkohol, Schule geschmissen. Alles da.«
Sie schwiegen.
»Weißt du, es ist, als ob alle gedacht hätten, sie sei es nicht wert am Leben zu bleiben – und einer hat dieses Leben nun einfach getilgt. Quasi einen Fehler der Schöpfung behoben. Ist das nicht schrecklich? Wie kann man überhaupt so etwas sagen: Um die ist es nicht schade?« Nachtigalls Stimme bebte.
Albrecht Skorubski warf ihm einen raschen Blick zu und zuckte mit den Schultern.
»Wann ist es denn schade? Hängt das vielleicht vom Beruf ab? Oder vom Einkommen? Um einen Polizisten ist es schade, um einen Gerichtsvollzieher nicht? Um den Arzt schon, aber beim Pförtner müssen wir erst mal nachdenken? Ist es so? Was hat sich denn da in unser Denken geschlichen!«
Wütend schlug Peter Nachtigall die Autotür hinter sich zu.
8
»Einige der Fingerabdrücke konnte der Computer problemlos zuordnen. Liest sich wie ’ne Liste alter Bekannter: Jan Lobedan, vorbestraft wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung, Paul Neumann, zweieinhalb Jahre wegen schwerer Körperverletzung, Matz Krautzig, zwei Jahre auf Bewährung wegen Dealerei, Jörg Schuster, 17 Jahre alt, Dauergast bei der Jugendnothilfe, Verurteilung zu 20 Stunden sozialer Arbeit nach einem Diebstahl, Marie Armbruster, zwei Jahre wegen Körperverletzung und Julia Renz drei Jahre wegen eines Überfalls auf einen Juwelier – beides auf Bewährung.« Michael Wiener schob seine randlose Brille auf der Nase zurecht und fuhr sich ein bisschen affektiert durch die gestylte Föhnfrisur. Er war groß und hager, stets mit Rollkragenpullover gekleidet, der ungeschriebenen Kleiderregel der Informatikfreaks folgend. Nachtigall fragte sich oft, wie er das aushielt bei Temperaturen um die 30°C.
»Schön. Dann laden wir uns die Herrschaften doch ein. Am besten wird es sein, einen Wagen zum Goethepark zu schicken. In der Zwischenzeit fährst du bei dieser Werkstatt vorbei. Vielleicht hatte sie dort Freunde.«
»Ey, Mann! So geht das nicht. Ich hab schließlich auch meine Rechte!«
Na, das konnte heiter werden, sinnierte Peter Nachtigall, als er den stickigen Raum betrat. Die Fenster waren klein und eng vergittert, die Sonne wurde durch dunkle Rollläden ausgesperrt, doch die Hitze hatte ihren Weg längst in alle Räume des Gebäudes gefunden.