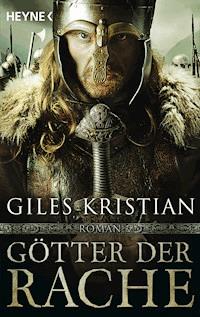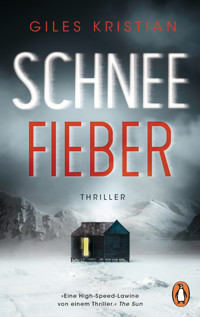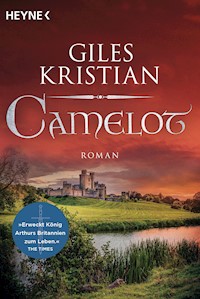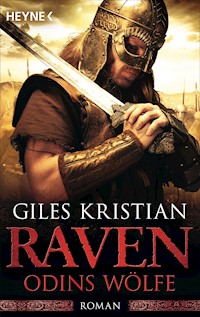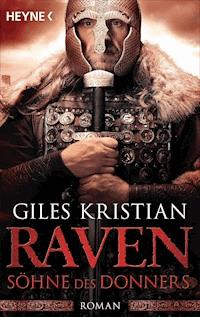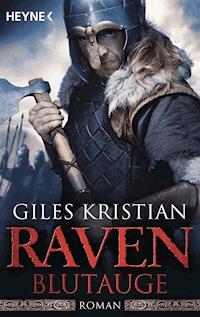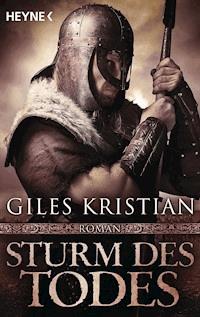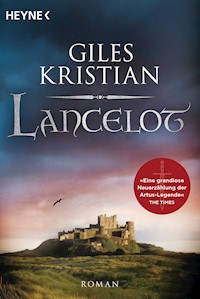
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller aus England: »Eine grandiose Neuerzählung der Artus-Legende« The Times
Die Zukunft Britanniens liegt um Dunkeln. Die Herrschaft der Römer ist nur noch eine blasse Erinnerung. Doch das Land ist zerrüttet, und die Zeit des Großkönigs Uther Pendragon neigt sich dem Ende entgegen. Fernab von den Zentren der Macht, auf einer kleinen Insel im tosenden Meer, wächst ein Junge auf, dessen Geschicke mit denen des Landes auf schicksalhafte Weise verknüpft sind. Ein grausamer Verrat machte ihn zum Waisen. Er ist mittellos, doch große Lehrmeister teilen ihr Wissen mit ihm. Er ist geschickt, und weiß mit Tieren umzugehen. Seine unverbrüchliche Treue zu einem neuen König wird dem Land Hoffnung schenken. Seine Liebe zu einer mächtigen Frau wird es spalten. Dies ist die Geschichte von Lancelot.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1055
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Das Schwert war fest in einen Schafpelz eingewickelt, dessen Fett wenigstens einen Großteil des Rostbefalls von dieser ohnehin schon uralten Klinge fernhalten sollte. Die Priesterin löste die Schnüre, warf das Fell beiseite und hielt das Schwert hoch, als wollte sie es dem herabstürzenden Wasser darbieten. Die Abenddämmerung hatte den Weiher bereits in kühle Schatten gehüllt, aber als ich den Kopf hob, sah ich das letzte Licht der Sonne noch im Scheitel des Wasserfalls glitzern.
»Excalibur«, sagte Merlin, und seine Augen waren die hellsten Punkte hier unten am dunklen Wasser. Heller noch als die Klinge selbst, die zu meiner Verblüffung weder schartig noch abgewetzt vor Alter war. Nur in der Schneide waren mehrere kleine Kerben zu sehen, und ich stellte mir vor, wie Maximus das Schwert in längst vergessenen Schlachten geschwungen und es mit den Klingen, Schilden und Helmen seiner Gegner gezeichnet hatte.
Der Autor
Seine norwegische Herkunft und die Werke von Bernard Cornwell inspirierten Giles Kristian dazu, historische Romane zu schreiben. Um seine ersten Bücher finanzieren zu können, arbeitete er unter anderem als Werbetexter, Sänger und Schauspieler. Mittlerweile ist er Bestseller-Autor und kann sich ganz dem Schreiben widmen. Mehr Informationen zum Autor finden Sie unter www.gileskristian.com
GILES
KRISTIAN
LANCELOT
ROMAN
Aus dem Englischen übersetzt
von Julian Haefs
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe LANCELOT erschien 2018
bei Bantam Books, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 01/2022
Copyright © 2018 by Giles Kristian
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Motivs von Adobe Stock/Chris
Karte U2 [>>]: © Liane Payne
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-24340-1V001
www.heyne.de
Für meinen Vater Alan James Upton (1946-2016),
der mir in seinen letzten Wochen gezeigt hat, was Mut ist.
Prolog
Ich verfolge sie. Unerbittlich. Jede Wende, jeden Haken, durch die herben Rauchfahnen zahlloser Gehöfte. Über gewölbte Hügelgräber und glitzernde Bäche. Zwischen Heuschobern, uralten Eichen und Steinsetzungen hindurch, die Heidelerche als wogend brauner Schimmer eine Krallenlänge voraus. Ein Aufblitzen ihres weißen Halses. Die schwarz-weiß gefleckten Schwungfedern. Ihr Gesang ist verstummt. Ich kann ihre Furcht im Wind schmecken.
Ich erreiche sie nicht. Eine Rolle. Eine Drehung. Wir erheben uns zu den Göttern, fallen der Landschaft entgegen. Verweben Erde und Himmel. Ich ergötze mich an der Jagd, und mehr noch an der Aussicht. Mein scharfer Blick zum Bersten gefüllt mit allen Schätzen der Welt.
Ich bremse ab, schere aus dem Windschatten der Lerche aus. Nicht das Murmeln des nahen Ozeans lockt mich, sondern das vieler Menschen. Ich lasse mich auf dem astfreien Baum nieder. Auf dem verzierten Stamm, dessen Taille ein Gürtel aus eisernen Ketten ziert. Ich rieche den schwärenden Nebel des Atems der Menge. Er wärmt meine Federn in der dünnen Morgenluft. Ich beobachte. Und fühle. Mehr, als ein einfacher Vogel fühlen sollte. Trauer, die wie ein Schleier über der Versammlung liegt. Furcht. Verunsicherung und Reue.
Das Gemurmel schwillt an, rollt wie eine Welle über die Häupter der Menge, verebbt wieder. Speerträger kommen und treiben die Menschen auseinander, vor Angst und Pflichtbewusstsein unbeholfen. Zwischen ihnen eine Frau. Sie steht ebenso gerade wie die Speere der Männer, doch ungleich nobler. Ihr Haar schwarz wie die Schwingen einer Krähe. Blau wie die Deckflügel eines Käfers. Kupfern wie das Laub der Buche am Wendepunkt der Jahreszeiten. Und noch immer gebietet sie über solche Schönheit, dass die Luft des frühen Tages in dreihundert Brustkörbe zugleich gesogen wird, Funken aus der Esse gleich, die in den Rauchfang strömen.
Wie Schlangen recken sich ihr die Arme entgegen, Hände packen zu, wollen ihr rostbraunes Kleid zu fassen kriegen. Männer und Frauen, dicht gedrängt, hungern nach einer Berührung, als sie vorübergeht. Alles lechzt danach, an ihrem Schicksal teilzuhaben. Dürstet nach einem Quäntchen ihrer Macht. Fürchtet ihre Kunst.
Mit der Erinnerung an die Lerche schwindet auch mein Hunger. Ein boshafter Knabe sieht mich und wirft einen Stein, ich erhebe mich vom Brandpfahl. Meine spitzen Schwingen schlagen schneller als Gedanken. Ich schwebe im auffrischenden Wind und betrachte noch immer die Frau, die hin und wieder unsanft gezogen wird, wie eine unwillige Stute auf dem Weg zu ihrem Beschäler.
Der Mann mit der Tonsur spricht jetzt, aber meine Ohren sind nicht meine Augen, und seine Worte nicht mehr als das Schnattern einer Gans. Sie ziehen die strauchelnde Frau auf die Bündel aus Stöcken und Reisig, legen ihr die kalte Eisenkette um die Hüften, vermählen sie mit dem Pflock. Nur ihr Blick und ihre Haltung zeugen noch von Gegenwehr. Stolz und Scham scheinen ihr einziger Zauber zu sein, was auch immer der Mann mit der Tonsur sagen mag, der die Arme hoch erhoben hat und nach dem Himmel zu greifen sucht.
Und über all dem schwebe ich, ein zitternder Ball aus reiner Kraft, gespannt wie ein Jagdbogen. Hoffentlich erspähe ich jetzt weder Lerche noch Schwarzkehlchen, weder Fink noch Baumpieper, denn meine Herrschaft über den Instinkt dieses Tieres ist flüchtig wie Morgentau; schon im nächsten Moment mag ich nach Westen ausscheren, um die nächste Beute bis ans Ende der Welt zu jagen.
Flammen lodern auf. Hell genug, dass meine Augen schmerzen. Mit Pechgestank erblühen sie aus der Spitze eines groben Stocks. Der Mann, in dessen Hand diese Fackel ruht, tritt vor, die Augen starr auf den Boden gerichtet, als fürchte er den Blick der Frau. Und daran tut er gut. Fürchtet zu Recht diese blaugrünen Augen, welche die Seelen der Männer erblickt haben, wie die Augen des Falken die Welt erblicken: bis ins kleinste, feinste Detail.
Wie erstarrt steht er da, dieser flammentragende Mann. Still und steif wie der Pfahl, dem sich zu nähern es ihm an Mut fehlt. Vielleicht fürchtet er nur die Frau. Vielleicht fürchtet er auch die Menge, die wie ein einziger gehaltener Atemzug lauert. Sie wollen Feuer, und wollen es doch nicht.
Jetzt naht der goldene Mann, dessen Schuppen trotz des stumpfen Tages hell glitzern. Und wie die Leute die Frau bedrängt haben, weichen sie nun vor ihm zurück. Sie schlagen die Augen nieder, ich aber halte den Blick und sehe zu, wie er der Hand des anderen die Fackel entreißt. Sein blasses Gesicht hat die Farbe erkalteter Asche im Herd.
Mit einer Stimme wie Schmerz ruft er der Menge zu, durchmisst mit ausladenden Schritten den Schlamm und trägt die Flamme vorwärts, ein feuriges Geschenk für jenes Gebilde, das ohne es nicht sein kann.
Dann aber hält er inne. Steht allein in einem Meer von Seelen. Fürchtet sich nicht, die Frau anzusehen. Ihre Blicke liegen jetzt ineinander. Wie Klauen verhakt. Wie Wurzeln verschlungen.
Irgendwo kreischt ein Weib. Mehr und mehr Schreie werden auf hasserfülltem Atem emporgetragen, und der goldene Mann reckt die windumtoste Fackel. Er wappnet sich und geht, erfüllt von neuer Entschlossenheit, die letzten drei Schritte.
Die Tränen der Frau benetzen das getrocknete Holz. Sie wendet ihr Gesicht ab, blickt über die Menge hinweg. Sieht jenseits ihrer Häupter durch den großen Schleier, der dieses Leben vom nächsten trennt. Die Flamme züngelt ins Stroh, das zwischen die Reisigbündel geschoben steckt. Ein Prasseln. Ein Keuchen all jener, die gekommen sind, um beizuwohnen. Die erste übel riechende Ranke schmutzig gelben Rauches erhebt sich, und ein plötzlicher Windstoß hüllt mich in ihren verkohlten Gestank. Zu viel für ein Geschöpf des unbefleckten Himmels. Ich schraube mich nach oben, fort von dem verschlingenden Hass und der Furcht. Lasse mich vom Wind hinab ins Tal reißen.
1
Feuer in der Nacht
Ich erinnere mich noch immer an den Geruch meines Vaters: Leder und Stahl. Das Wollfett in seinem Mantel, seiner Hose und auf den Klingen, das zwar wasserabweisend war, dafür aber nach Schaf stank. Das süße Heu im Stall und der alte Schweiß in den Satteldecken. Auch sein eigener Schweiß und sein herber, männlicher Geruch. Und manchmal auch der erschreckende Gestank in seinem Atem, die säuerliche Note von zu viel Bier und Wein.
An sein Gesicht kann ich mich kaum noch erinnern. Vielleicht will ich es auch nicht. Aber an seinen Geruch erinnere ich mich. Ich muss nur daran denken, und sofort bin ich wieder ein kleiner Junge.
Ich erinnere mich auch an seine Berührung, aber nur, weil sie so ungewohnt, so selten war. Die mächtige Hand, die mir das Haar zerzaust und es in Büscheln abstehen lässt. Der Granit seiner Brust in meinem Rücken, als er mir das erste Mal half, den Bogen zu spannen. Der herbe Geruch seines weichen Bartes, als er mir eines Abends am Herdfeuer zuflüsterte, meine Mutter sei die schönste Frau in ganz Benoic.
Weniger selten das Gefühl der scharfen, steinharten Fingerknöchel auf meiner Wange, die mein Ohr für den ganzen nächsten Tag taub und heiß zurückließen. Der Biss seines Gürtels, wenn ich sein Missfallen erregt hatte. Oder jemand anders. Der eiserne Griff seiner großen Hände um meinen Arm, das wilde Schütteln, das mein Hirn im Schädel erzittern ließ, und die tobende Gischt seiner wütenden Schreie in meinem Gesicht.
Seltsamerweise erinnere ich mich selbst im Chaos dieser einen Nacht sehr deutlich an das Gefühl seiner Hand. Seine raue Haut, die meine fest umklammerte. Eine breite, schwielige Zwinge, mit der er mich durch wabernden Qualm und flammenbefleckte Dunkelheit zerrte, denn unsere Feinde waren gekommen.
Ich war im Stall gewesen und hatte Malo gestriegelt, meines Vaters Hengst, der in solch finsterer Stimmung war, dass sich ihm außer mir niemand, nicht einmal Govran, nähern wollte. In jenem Winter war viel Schnee gefallen, der bis weit in den Frühling liegen blieb. Ein weißer Pelz über ganz Benoic, der die Menschen an ihren Herdfeuern, Vieh und Pferde in den Ställen hielt. Besonders einen Fürsten der Tiere und Liebling der Pferdegöttin Rhiannon brachte man nicht in Gefahr, indem man ihn ohne triftigen Grund einem Ritt bei Schnee aussetzte. Was Malo natürlich nicht einsah. Er maß fünfzehn Handbreit bis zum Widerrist und war hispanischer Abkunft – behauptete zumindest Govran. Malo war stark und schnell, herablassend und gefährlich. Heißes Blut in einem kalten Land. Und er langweilte sich. War frustriert von schierer Bewegungslosigkeit. Machte die Welt und die Götter und alle Menschen dafür verantwortlich, nur mich nicht.
Wie alle rassigen Hengste schien Malo der Ansicht, der beste Ersatz für Auslauf sei ein anständiger Kampf. »Der miese Teufel hat mir fast den Arm abgebissen, als ich ihm mit der Bürste zu Leibe rücken wollte«, hatte Govran noch auf der Türschwelle gesagt und sich dabei große Schneeklumpen von den Stiefeln geklopft, die auf den Grasmatten zu schmelzen begannen.
Govran war der erfahrene Stallmeister meines Vaters und liebte die Pferde mehr als die Menschen, seine Frau Klervi eingeschlossen, die diesen Umstand oft genug zur Sprache brachte – und von Govran nie ein Widerwort hörte.
»Dann hat er Erwan glatt auf den Arsch geworfen, als der seinen Huf nach Fäule untersuchen wollte«, fauchte Govran und blies sich in die kalten Hände. »Wir sollten den schwarzen Teufel freilassen und zusehen, wie er wutschnaubend übers Dach der Welt galoppiert und eine Fährte aus Feuer hinter sich lässt.« Er sah erst meine Mutter, dann meinen Vater an. Mich sah er nicht an. »Wenn der Teufel gestriegelt werden soll, musst du den Jungen schicken.«
Es gab nicht viele Leute, die so mit meinem Vater reden konnten. Govran schon. Sie waren Waffenbrüder gewesen, lange bevor mein Vater König wurde.
»Spricht nicht gerade für dich, Govran«, gab mein Vater zurück. Und das tat es wirklich nicht, denn ich war noch keine neun Jahre alt. »Sollte ich mich nach einem neuen Stallmeister umsehen?«
»Lieber nach einem neuen Pferd«, zischte meine Mutter.
Govran murmelte etwas, das zu seinem Glück vom Knacken der Kiefernscheite im Herdfeuer übertönt wurde. Der Vorrat an trocken gelagertem Holz war längst aufgebraucht.
Draußen frischte der Wind hörbar auf, was die Stimmung im Stall kaum verbessern würde. »Mich wird er nicht beißen, Vater«, sagte ich. Und war mir meiner Sache beinahe sicher.
Die Mundwinkel meiner Mutter beugten sich schwer wie ein schneebedecktes Strohdach. »Das Biest könnte dem Jungen mit einem Biss den Kopf abreißen und am Stück verschlucken«, sagte sie.
»Mich beißt er, weil er ab und zu vergisst, wo es langgeht«, sagte Govran, der sich noch immer die Hände warm rubbelte. »Zwischendurch glaubt er offenbar, er ist der Herr und ich der Diener, und will mir die Grenzen aufzeigen. Mistvieh.« Er hob sein Kinn in meine Richtung. »Der Junge ist für ihn keine Bedrohung.«
»Jungen werden nicht zu Männern, wenn sie nur an ihrer Mütter Rockschöße hängen«, polterte mein Vater, setzte den Tonkrug an die Lippen und nahm einen tiefen Zug.
»Jungen werden auch nicht zu Männern, indem sie sich von schlecht gelaunten Nutztieren den Kopf abbeißen lassen«, sagte meine Mutter.
Kein Lächeln. Nur Herdfeuer und Lampenflackern, Rauch und stickige Luft. Wir alle konnten den Frühling kaum erwarten.
Gemurmel und eine schnelle Handbewegung meines Vaters. Mehr brauchte es nicht, schon war ich zur Tür hinaus – ich hatte nicht einmal eine Hornlaterne mitgenommen –, stapfte durch den knirschenden Schnee und erreichte Malos erleuchteten Stall. Drinnen war es warm, die Luft erfüllt von seinem herben Geruch und schwanger mit süßlichem Atem, der rhythmisch wie aus einem Blasebalg in dichten Schwaden verströmte und so den Zorn zu entfachen schien, der alle anderen Menschen vertrieben hatte.
»Hier bin ich«, sagte ich. »Hier bin ich.« Leise und sanft wie Neuschnee auf alter Schneedecke. Erst schnaubte er nur voll Verachtung, sehr wohl wissend, dass die Männer das Feld geräumt und einen Jungen hergeschickt hatten. Er verachtete sie für diese feige Tat. Ich aber ließ ihn ausgiebig meine Hände beschnuppern und flüsterte ihm zu, er könne mich gern beißen, falls es ihm danach besser gehe. Und als er es unterließ, kletterte ich auf den Schemel des Hufschmieds, vergrub die Nase in Malos dichter Mähne, atmete seinen Duft und raunte ihm zu, dass wir Freunde seien und der Rest der Welt zur Hölle fahren könne. Dann machten wir uns ans Werk: Ich widmete mich seinem rabenschwarzen Fell, das von Stroh und Staub und Dreck befreit werden musste, er sich dem Versuch, von seinem Hass abzulassen.
Die Stuten und Fohlen und anderen Hengste im Stall waren unruhig. Pferde fürchten sich vor dem Zischen des Windes, weil sie Schlangen fürchten. Es steckt tief in ihnen, wird von Vater an Fohlen weitergegeben. So hatte es einmal ein Fremdländer Govran erklärt, der es mir erzählte. »Wenn du mich fragst, fürchten sie sich eher vor all den Geräuschen, die sie wegen des Windes nicht mehr hören können, zum Beispiel vor dem Wolfsrudel auf der Jagd«, hatte Govran hinzugefügt, was für einen kleinen Jungen wesentlich glaubhafter klang, einen Jungen, der davon überzeugt war, ein Fürst wie Malo würde auf keinen Fall die Strömungen und Gezeiten des Himmels mit einem Tier verwechseln, das auf dem Bauch herumkriecht.
Wenn ich nicht zu sehr trödelte, würde ich nach Malo noch drei oder vier andere Pferde striegeln. Aber ihn liebte ich am meisten, und solange ich bei ihm im Stall stand, war die Außenwelt für mich wie Rauch, der über dem Abzug verweht. Nur Malo und ich und die Bürste aus Schweineborsten. Vom Kopf über den Hals zur Brust, dann den Widerrist, die Vorderbeine bis hinunter zu den Knien und sogar den Hufen. Nur hin und wieder kurz die Bürste durch den Kamm aus Hirschhorn ziehen, um ihn vom gesammelten Schmutz zu befreien.
Dann den langen Rücken entlang, die Flanken, den Unterleib, die Kruppe und schließlich die Hinterbeine bis hinab zu den Hufen. Jeder Bürstenstrich lockte das hauteigene Öl an die Oberfläche, bis sein ganzer Leib wie poliertes Ebenholz glänzte. Und schließlich mit dem Kamm an Mähne und Schweif, sachte wie ein Gedanke, der Lauf des Halbmonds über den Himmel gänzlich vergessen, bis sein langes Haar in den Windstößen, die sich zwischen den Stämmen der Stallwände hindurchzwängten, wie Seide floss.
Selbst Malos Groll währte nicht lange. Nicht bei mir. Als ich mein Werk vollbracht hatte, war die Empörung in seinem Blick funkelndem Stolz gewichen. Da stand er, schnaubend und hochmütig, und machte seinem Namen alle Ehre, welcher glänzende Geisel bedeutete, denn einst hatte er einem Feind meines Vaters gehört. Als ich noch an der Mutterbrust hing, war er zusammen mit anderen Schätzen bei einem Raubzug erbeutet worden, und mein Vater hatte ihn zu sehr ins Herz geschlossen, um ihn hinterher mitsamt den anderen Schätzen zurückzuverkaufen.
»Pferde können genauso eitel sein wie jeder Krieger«, hatte Govran gesagt. Malo war eitler als sämtliche Männer meines Vaters. Trotzdem mochte ich ihn, und er mochte mich. Er hat mich nicht einmal gebissen. Nie.
Das erste Anzeichen des nächtlichen Überfalls, der mein Leben für immer verändern sollte, war ein Schrei.
* * *
Mit dem Pflegetuch in der Hand stand ich da, war schon fast fertig, strich nur noch Staubreste und die Rückstände der weichen Bürste aus seinem Fell, dann wischte ich vorsichtig um Malos Augen und Ohren herum, an die er keine Borsten ließ. Ich war ganz in die Arbeit vertieft und genoss das schillernd schwarze Fell genauso selbstvergessen, wie auch die Recken meines Vaters mit viel Sorgfalt neuen Glanz in ihre Helme und Klingen und Scheiden und das Leder ihrer Schwertgürtel polierten. Weshalb ich in der duftenden Oase des Stalls den schrillen Ton des Hornrufs im Wind zuerst nicht vernahm. Malo musste mich darauf aufmerksam machen. Er schnaubte, schlug mit den Ohren und hob den Kopf, siebte Schreie und das plärrende Kriegshorn aus dem Klagelied des Windes.
Im gleichen Augenblick roch ich den Qualm und wusste, dass unsere Feinde gekommen waren. Wieder erklang das Horn, und ich rannte hinaus in die Nacht, die jetzt wie Kupfer und Bronze leuchtete, denn sie hatten Kornspeicher und Schmiede bereits in Brand gesteckt. Die Kühe im Viehstall muhten angsterfüllt, schemenhaft rannten Gestalten durch den Schnee. Ich sah den Widerschein des Feuers in Klingen und Helmen und stand wie durch bösen Zauber gefroren da.
»Junge! Lauf, Junge! Zu deinem Vater!« Da war Gwenhael, der mit gezogenem Schwert durch den glühenden Mantel der Nacht herbeistürzte, die Augen wild von Bier, sein Atem eine Nebelfahne. »Los, Junge!«, brüllte er mich an und drehte seine fellbedeckte Masse einem Krieger zu, der mit einem Spieß nach ihm stieß. Gwenhael parierte den Angriff und versenkte sein Schwert im Bauch des Manns, aber schon kamen drei weitere Kämpfer näher, umringten ihn wie Wölfe den Bären, und Gwenhael reckte die dampfende Klinge in den Nachthimmel und grölte seinen Schlachtruf. Ich musste mitansehen, wie er in einer Flut von Schwertern und Verwünschungen unterging. Da erst rannte ich los.
Allerdings nicht in Richtung Haus und Vater. Ich rannte dicht am Stall entlang, auch wenn mich das Wiehern und Kreischen der Pferde fast genauso entsetzte wie Gwenhaels Tod, und überquerte direkt vor der Scheune den Platz, flink wie ein Hase über den vom Feuer gebräunten Schnee. Schon seit der Zeit, als König Peredurs Hintern noch den Eichenthron von Benoic gewärmt hatte, war die ehemalige Räucherkammer das Reich von Hoel und seinen Greifvögeln, und nie war seine Tür verschlossen gewesen. Sie war es auch jetzt nicht, und ich stürmte mit solchem Getöse hinein, dass alle Vögel kreischten, mit den Flügeln schlugen und in wilder Erregung an ihren Fesseln rissen.
»Wer ist gekommen, Junge?«, krächzte Hoel. Einzig seine Neugier hielt die Hand mit dem Lederriemen zurück, der mich sonst für das Erschrecken der Vögel gebissen hätte. Was der alte Falkner allerdings glaubte, mit dem Riemen gegen die Männer ausrichten zu können, die meines Vaters Krieger töteten? Ich weiß es nicht. »Na? Raus mit der Sprache, Bursche! Wer tötet da wen?«
»Es sind Claudas’ Männer«, sagte ich, denn ich wusste es, auch ohne das Hirschbanner des Königs des Ödlands oder gar Claudas selbst in der flammendurchzüngelten Nacht erspäht zu haben. »Sie haben Gwenhael getötet«, gab ich zu, was mich aus unerfindlichen Gründen beschämte.
Hoels Rachen entwich ein Geräusch, das ich trotz der kreischenden Greifvögel ringsum hören konnte. Der Gerfalke meines Vaters hinter ihm war ein Bündel weißer Wut, das versuchte, seiner Stange zu entkommen. Sein schrilles Kee-Errk, Kee-Errk durchbohrte das modrige Dämmerlicht, die Kerzen flackerten im Stoß seiner großen Schwingen.
»Was in Taranis’ Namen machst du dann hier, Bursche?«, fragte Hoel und legte den Kopf in Nachahmung seiner Schützlinge schief, um mich mit seinem einen Auge zu fixieren. Das andere ruhte wie geklumpte Sahne in einem Gefäß aus Falten und Narben, nachdem es vor langer Zeit den Krallen eines stürmischen Tieres erlegen war. Eine schreckliche Wunde für einen Jungen meines Alters, sie ansehen zu müssen, viel schrecklicher wohl für den Jungen, der er gewesen war, sie zu erleiden. Dennoch war der einäugige Lehrling zum Meister geworden und ich an den schlimmen Anblick längst gewöhnt.
Ich betrachtete Hoels Rücken, während mich die Windböen aus der halb geöffneten Tür, wo er stand und nach draußen spähte, in den vertrauten Geruch seines Schweißes hüllten. Tatsächlich mochte ich den alten Falkner lieber als meinen Vater, und Hoel wusste es und fühlte sich schuldig. Außerdem wusste er, dass meine Zuneigung zu ihm und seinen Vögeln meinen Tod bedeuten konnte.
Er wandte sich um und starrte mich an. Sein gutes Auge sagte mir, dass er draußen in der lodernden Dunkelheit etwas Entsetzliches erblickt hatte.
»Deine Mutter muss außer sich sein, Junge. Raus mit dir! Bevor es zu spät ist.«
»Wir gehen gemeinsam«, sagte ich und hörte einen Schrei, der vielleicht von einer Füchsin gestammt haben könnte, auch wenn ich wusste, dass dem nicht so war.
»Sei kein Narr«, sagte Hoel und machte einen Satz auf mich zu, als wollte er mich mit Lederriemen und Luder schlagen, die er noch immer in seinen knöchernen Fingern hielt. »Ich werde nicht wie alle anderen fliehen. Könnte ich auch nicht, selbst wenn ich es wollte.« Ich wusste, dass er recht hatte. Es war unvorstellbar, dass sich Hoel auf seinen dürren alten Beinen mit ausreichender Geschwindigkeit durch den Schnee kämpfte. Ich konnte mich nicht einmal entsinnen, ihn je zu Ross gesehen zu haben, auch begleitete er dieser Tage die Männer nicht mehr auf die Jagd, sondern verließ sich darauf, dass sich mein Vater mit den Falken gut genug auskannte, um sie nicht zugrunde zu richten.
»Na los, verschwinde!«, schrie er, und schlug mich dann doch mit dem Riemen. Zweimal, aber ich stand da und hielt es aus. Hoel hätte längst einen Lehrling haben sollen, hatte aber alle Bewerber abgelehnt – nicht dass es viele gewesen wären –, und ich glaube, er hatte die Stelle für mich freigehalten, auch wenn es noch ein paar Jahre dauern würde, bis ich so weit wäre. Ich verbrachte mein halbes Leben an diesem dunklen, streng riechenden Ort, und auch wenn das Wissen des Falknermeisters gewaltig war und ich von seiner Arbeit kaum etwas verstand, faszinierten mich die Vögel. Ich bewunderte sie. Liebte sie gar. Wollte die Welt auch, dass ich mehr würde, ein Prinz sein sollte, wäre ich doch mit Freude Hoels Lehrling geworden. Mein Bruder Hector würde den Königsstuhl von Benoic kriegen, ich die Habichte und Falken.
Nur würde es nie dazu kommen, das wusste ich in diesem Moment genauso sicher, wie ich wusste, dass Hoels milchiges Auge nie betrachten würde, wie der Wanderfalke in gedankenschnellem Sturz ein Birkhuhn im Flug schlägt. Und doch stand ich da. Wollte noch mehr von diesem alten Mann. Brauchte etwas.
»Die werden mich nicht töten«, sagte er. »König Claudas ist kein Barbar. Er liebt die Jagd bestimmt genauso sehr wie dein Vater und bringt mich nicht einfach um.« Sein Mund war an die Kunst der Lüge nicht gewöhnt, denn die Vögel muss man nicht täuschen, aber er deutete in einer ausladenden Geste auf die Mauserkäfige und ihre Bewohner, von denen einige noch immer aufgeregt mit den Flügeln schlugen. Sie witterten Feuer und Blut. »Außerdem kennt sein Falknermeister meine Vögel nicht. Er wird mich brauchen.« Sein Blick war auch mit einem Auge stechend wie ein schmales Messer. »Aber dich werden sie töten. Oder schlimmer.« Er wedelte mit den Armen, um mich zu verscheuchen. »Und jetzt los. Schnell!«
Hoel war zu alt und zu steif, um zu fliehen, das wussten wir beide. Auch würde er seine Greifvögel niemals in die Obhut von Fremden geben, also musste ich mich damit abfinden, ihn zurückzulassen und der dumpf duftenden Zuflucht den Rücken zu kehren, jenem Ort, an dem ich mich stets am wohlsten gefühlt hatte. Ich wandte mich ab und ging zur Tür, hinter der alles im Chaos versunken war.
»Warte, Junge!«
Ich fuhr auf dem Absatz herum, erfüllt von der unwirklichen Hoffnung, der alte Mann hätte doch noch seine Meinung geändert und würde mit mir durch die Nacht fliehen.
»Hier. Komm her. Los, schnell jetzt.« Er nestelte an der Klappe zum Käfig des Sperberweibchens, seine Finger durch Alter und wohl auch Angst sehr ungelenk. König Claudas war unbarmherzig wie der Winter. Noch grausamer als mein Vater, das hatte ich mehr als einmal gehört. Und Hoel zweifellos auch. Behutsam griff er hinein und nahm den Vogel heraus. »Nimm sie mit«, sagte er. »Sie gehört jetzt dir.«
Ich war verwirrt. Das Sperberweibchen steckte noch im Jugendkleid, die Brust braun gesprenkelt und die Augen matt gelb, auch wenn ihr Blick schon so wütend war, wie es allen Sperbern eigen ist. Ich war dabei gewesen, als Hoel sie kurz vor dem ersten Schnee im Wald nahe Gourin gefunden hatte. Uns war das Fehlen anderer Nester im Umkreis schnell aufgefallen, ein deutliches Indiz dafür, dass sich dort ein Sperberweibchen niedergelassen hatte, wie der Meister sagte. In solchen Dingen irrte er nie.
»Die Sperberin?« Ich verstand es nicht.
»Ja, das Sperberweibchen«, sagte Hoel, hob den Vogel vors Gesicht und musterte ihn, als wollte er sich ihren Anblick genau einprägen. »Gib gut auf sie acht. Zieh sie richtig auf. Lernt voneinander.«
Ich war nur ein Knabe und sah über die rechte Schulter den schneeweißen Gerfalken meines Vaters an, der dort auf seinem Hohen Reck saß und mich ebenso kritisch anstarrte, wie Hoel es vorhin getan hatte. »Ee-ack, Ee-ack!«, sagte er aufgebracht. Ich spürte seine Wut und konnte sie verstehen. Wenn ich in dieser schrecklichen Nacht einen Vogel vor unseren Feinden retten sollte, dann ihren König, und das war der Gerfalke. Der Terzel war vortrefflich für die Jagd abgetragen und mit Gold kaum aufzuwiegen. Oft hatte ich ihn hoch vor dem Dach der Welt gesehen, wo er wie eine Sternschnuppe durch den Himmel zuckte. Was für ein Anblick, wie er die Flügel anlegte und zum Sturzflug ansetzte, die Silhouette größer und größer, bis er schließlich von seiner Beute entdeckt wurde – aber zu spät. Der Terzel war eine tödliche Waffe. Aber die Sperberin? War nicht abgetragen. Ein Jungvogel, kaum dem Nest entwachsen, vor Kurzem noch ein Ball aus unordentlichen Federn mit klaffendem Schnabel, der laut nach Fütterung verlangte.
Auch jetzt schrie sie, aber Hoel war gütig genug, ihr selbst in solch einer Nacht noch liebevoll zuzuflüstern. »Tut mir leid, Prinzessin, du musst jetzt brav sein«, beschwichtigte er sie, während er mit der freien Hand einen Weidenkorb unter dem Tisch hervorzog und den Vogel in dessen ungewohnter Dunkelheit versenkte. »Du musst sie so bald wie möglich füttern«, sagte er und hielt mir seine Gabe hin. Ich nickte und nahm den Korb mit der aufgebrachten Insassin entgegen, obschon mein Blick noch immer heimlich auf dem Gerfalken lag. Hoel hob seinen Falknerhandschuh auf. Das Leder war abgewetzt und von Blut, Schweiß und Regen befleckt, ansonsten aber gesäubert. Ein magischer Gegenstand, dieser Handschuh, der nach den genauen Maßen von Hoels rechter Hand gefertigt war und, abgesehen von den Vögeln selbst, die von Rechts wegen sowieso meinem Vater gehörten, der kostbarste Besitz des alten Falkners. Trotzdem kam er jetzt ohne Zögern auf mich zu und steckte mir den Handschuh in den Gürtel.
»Und jetzt los. Geh zu deinen Eltern. Sie suchen sicher schon nach dir.«
Und so ging ich.
* * *
Neben dem Holzstoß unterm Gesims der Räucherkammer wartete Flamme auf mich, mein beinahe zahmer Fuchs, in dessen prächtigem Pelz sich das Feuer spiegelte, das wie ein mächtiges Segel über dem Dach der Scheune wehte und zahllose Funken in den schwarzen Himmel sandte. Er musste mir lautlos erst zu den Stallungen und dann zu Hoel gefolgt sein, mit fast katzenhafter Vorsicht und Schläue. Jetzt witterte er die Sperberin in meinem Korb, drückte sich dicht an den Schnee und sah mit seinen bernsteinfarbenen Augen zu mir auf, wie er es immer tat, wenn er um die Fleischreste bettelte, die ich oft für ihn vom Esstisch stibitzte.
»Na los, Junge«, sagte ich und folgte meinen eigenen Spuren zurück durch den Schnee, zu denen sich neue gemischt hatten. Hier und da lagen Leichen. Sechs oder sieben in der Nähe. Krieger, die ich mein ganzes Leben gekannt hatte, lagen jetzt wie Schlachtvieh auf dem Hof. Tapfer und pflichtschuldig waren sie aus ihren Betten hinaus in die Nacht gestolpert, um sich unseren Feinden entgegenzustellen, hatten für uns ihr Leben gelassen und waren wieder in tiefen Schlaf gefallen, von dem es kein Erwachen gab. Als ich an Gwenhael vorbeikam, der gebrochen dalag und den Schnee dunkel benetzte, wandte ich den Blick ab, denn ich wusste genau, er würde sich schämen, so einen Anblick zu bieten. Bis jetzt hatte ich weder Tewdr, den stärksten Recken meines Vaters, noch meinen Bruder oder Vater selbst gesehen, also wagte ich zu hoffen, dass sie noch lebten. Dann machte mein Herz einen Satz in der Brust, getrieben von einem plötzlichen, schrecklichen Gedanken. Vielleicht waren sie längst geflohen.
Ich blieb stehen und Flamme ebenso, denn eine Gruppe von König Claudas’ Kämpfern war um die Ecke des Kuhstalls gebogen, gehüllt in fahle Atemwolken und beladen mit Schätzen, die sie aus dem Heiligtum geraubt hatten: silberne Statuen, goldenes Essgeschirr, goldene Kerzenständer und sogar die Seidenvorhänge, hinter denen die Priester saßen und Worte der Götter sprachen. Selbst als ich starr vor Angst dastand, um nicht entdeckt zu werden, widerten diese Männer mich an, die sich bereicherten, bevor sie den Kampf gewonnen hatten. Bevor sie überhaupt gekämpft hatten, wie mir schien. Sie sahen aus wie ein Rudel räudiger Hunde, das nach Essensresten lechzte, und ich hasste sie. Leider kündete das laute Klirren von Stahl auf Stahl aus der großen Halle davon, dass der König des Ödlands auch würdigere Krieger in seinen Diensten hielt. Männer, die kämpften, bevor sie plünderten.
Eine Hand drückte sich auf meinen Mund, und ich wurde unsanft gegen einen Berg aus Muskeln und kalten Kettengliedern gerissen, der nach schalem Bier stank.
»Ruhig, Bursche«, knurrte mir Tewdr ins Ohr. Ich wehrte mich nicht weiter, sondern ließ mich von ihm rückwärts ziehen. Meine Fersen zogen kleine Furchen in den Schnee, bis wir im Schatten der Küferei verschwunden waren. Nur nicht schnell genug.
Einer von König Claudas’ Männern hatte uns entdeckt und seine Spießgesellen gewarnt. Kurz schienen sie abgeneigt, sich von ihren Beutestücken zu trennen, dann ließen sie die Schätze doch fallen, zogen die Schwerter, reckten die Speere in die Höhe und riefen Beschimpfungen, die vom eisigen Wind fortgetragen wurden. Tewdr brummte einen Fluch.
»Da ist er ja! Den Göttern sei Dank!« Ich wandte mich um und sah meine Mutter, meinen Bruder und mehrere Leibwächter meines Vaters, deren Augen vor Kampfeslust leuchteten. Viele von ihnen waren blutbefleckt. Hinter ihnen standen ein halbes Dutzend Hausdiener und mehrere Sklaven, alle fast erdrückt unter der Last der Besitztümer, die meine Mutter vor der Zerstörung dieser Nacht retten wollte. »Komm her, Junge«, zischte sie. »Wo in Cernunnos’ Namen hast du gesteckt?«
Auch mein Onkel Balsant war da und hielt den dicken Eschenstab, den ein silberner Eber krönte – das Feldzeichen meines Vaters. Balsant sah aus, als habe er dafür kämpfen müssen. Trotzdem zwinkerte er mir zu, ehe er das Feldzeichen in Hectors Obhut gab und sich zu Tewdr gesellte. Drohend zeigte er mit seinem großen Schwert auf unsere Feinde, die sich näherten und blutbeschmierte Verstärkung bekommen hatten.
»Geh mit ihnen, Bursche«, schnarrte Tewdr und schubste mich meiner Familie entgegen, und dann war auch mein Vater plötzlich da. Er ragte aus den brennenden Schatten auf, das Gesicht starr wie eine Klippe aus Granit, aber in seinem Blick lag Entsetzen. Seine Klinge glänzte blutrot. Bei ihm waren Govran, Budig, Salaun und drei weitere Krieger, deren heißer Atem um ihre Bärte strich, während sie sich für Kampf oder Flucht wappneten und aus dem Augenwinkel ihre Frauen und Kinder suchten, die sich gerade in östlicher Richtung dem Waldrand näherten. Sie waren in dicke Felle gehüllt und mit Säcken beladen, ein paar von ihnen führten Packpferde.
»Geht, mein König«, sagte Tewdr über die Schulter. »Ihr müsst gehen.«
»Ja, wir holen euch dann ein«, sagte mein Onkel zu meinem Vater, sah dabei aber meine Mutter an, und sie ihn. Dann entfernte er sich einen langen Schritt von Tewdr, damit beide genug Platz für ihr Schwerthandwerk haben würden. Drei weitere Krieger marschierten zu ihnen herüber, aber mein Vater befahl Govran und dem Rest, bei meiner Mutter zu bleiben, deren anklagendes Drängen an mir abperlte wie Wasser von den Schwingen einer Möwe. Haltlos stand ich da, ein Junge, der einen Korb mit einem verängstigten Vogel umklammerte und sich innig wünschte, stattdessen ein Schwert zu halten und über die Manneskraft zu gebieten, es auch benutzen zu können.
»Kommt schon, ihr Söhne Balors!«, brüllte Tewdr den Männern König Claudas’ zu und schritt ihnen entgegen. Tewdr Bärentöter. Held von Benoic.
Mein Onkel und die anderen folgten ihm. Keine Lieder oder Schlachtrufe. Nur tapfere Männer, die wussten, dass sie ihr Leben lassen würden.
»Los, Junge!« Beinahe hätte ich den Weidenkorb fallen lassen, denn eine große Hand legte sich um meine. Zähe Haut und ein eiserner Griff, dem nie ein Schwert entglitten war. Oder ein Trinkhorn. »Du hast den Gerfalken geholt«, stellte mein Vater fest. »Gut. Komm jetzt.« Er zog, und ich folgte. In großer Eile durch den Schnee. Den anderen hinterher, dem fernen Waldrand entgegen. Flüchtlinge im Angesicht der Sterne und der grell wirbelnden Funken unserer zerstörten Heimstatt und der zürnenden Götter.
Hinter mir ertönte das Klirren zweier Klingen. Schreie.
2
Der Marsch
Wir gaben eine bemitleidenswerte Gruppe ab. Eine Prozession der Enteigneten. Pilger, die nur noch ans Überleben denken konnten, denen außer dem Willen, sich vorwärts zu schleppen, alles genommen worden war. Von den Frauen und Kindern weinten viele, da ihre Männer und Väter nicht bei ihnen waren und auch nicht nachkommen würden. Die meisten froren bitterlich und waren vor Trauer ermattet. Mehrere Männer waren verwundet und hinterließen Blutstropfen im Schnee. Einer von ihnen, ein großer Mann namens Alor, hatte einen Speer in den Bauch bekommen und verschwand bald zwischen den Bäumen, um allein und in Ruhe zu sterben. Niemand hielt ihn auf. Wir konnten nicht rasten, unsere gebeutelten Leiber nicht am Feuer wärmen, denn die Feinde hätten uns eingeholt und ihr Werk vollendet. Längst mussten sie bemerkt haben, dass Ban, König von Benoic, noch am Leben war.
Falls man das Leben nennen konnte. Ich hätte den tobenden, zornerfüllten König vorgezogen, denn ihn kannte ich besser als den Mann, der jetzt an seiner statt bei uns war. Ich hätte es bevorzugt, meinen Vater die Götter verfluchen und blutige Rache schwören zu hören. Ich hätte seine Wut, ja selbst seine Knöchel auf meiner Wange bevorzugt. Alles besser als das, was jetzt von ihm übrig war: ein geschrumpfter Mann, gebeugt von der Bürde seiner Scham, das Feuer in den Augen erloschen, ertränkt in der Schmach seines Niedergangs. Selbst im fahlen Sternenlicht konnte ich all das mit meinen Kinderaugen erkennen und fürchtete mich schrecklich. Also mied ich ihn, und auch meine Mutter, denn sie war mit wichtigeren Dingen befasst, wie etwa dafür zu sorgen, dass wir nicht noch tiefer fielen – auch wenn das kaum möglich schien.
Die Rauchschwaden hatten sich erhoben, die Sterne waren gefallen. Alles in dieser einen schändlichen, unheilvollen Nacht.
Hector hatte ein wenig Brot und Käse mit mir geteilt, und von dem Brot hatte ich eine Ecke für Flamme aufgehoben, denn ich wusste, dass er mir im Schutz der Bäume gefolgt war. Gerade hielt ich Ausschau nach dem Fuchs, als ich sah, wie Mutter Hector bestürmte. Sie hatte außer Sichtweite meines Vaters lange mit Govran gesprochen, und nun zerrte sie meinen Bruder in den dunklen Schatten einer schneebedeckten Pinie, während Govran abseits stand und sich in die kalten Hände blies. Mutter zischte Hector an, er solle sich aufrichten, die Schultern gerade halten und ein Mann sein, da unser Vater in Selbstmitleid ersoff.
»Onkel Balsant ist tot und das Königreich verloren«, begehrte Hector auf, der noch immer das Feldzeichen der Familie hielt. Der silberne Eber schimmerte matt in der Dunkelheit.
Meine Mutter hielt einen Moment den Atem an. Irgendwo über uns im Blätterdach schlug ein Vogel mit den Flügeln, eine kleine Schneewolke fiel herab, und der Blick meiner Mutter wurde hart und scharf wie ihre Wangenknochen, die sich zweier Klingen gleich unter der blassen Haut abzeichneten.
»Balsant hat seine Pflicht erfüllt, und wir werden ihn ehren, falls wir überleben«, sagte sie und ergriff Hectors Schultern, der unter ihrer Berührung zusammenzuckte. »Aber wenn du dich jetzt nicht wie ein Mann verhältst, werden sie wie Wölfe über uns herfallen«, krächzte sie und hob das atemumwölkte Kinn in Richtung eines Grüppchens dreier Krieger, die soeben vorbeigingen. Sie hatten die Schilde über den Rücken geschlungen und nutzten ihre Speere als Wanderstöcke. »Sie werden unsere Schwäche spüren und sich gegen uns wenden. Uns ausrauben und im Stich lassen. Vielleicht beratschlagen sie schon, ob sie uns nicht an unsere Feinde verkaufen sollten. Verstehst du, was ich sage, mein Sohn? Willst du deine Mutter vergewaltigt sehen? Den Schädel deines Bruders eingeschlagen?«
Ich dachte an Gwenhael, der weit hinter uns lag, tot und zerfetzt.
Hector schob entschlossen den Kiefer vor und schüttelte den Kopf. »Niemals.«
Meine Mutter nickte und streichelte seine Wange. Ich spürte es auch auf die Entfernung noch. »Da ist mein Hector. Dein Vater hat uns fast alles gekostet. Wir werden nicht zulassen, dass sein Versagen uns auch noch umbringt.«
Ich stand nah genug bei ihnen, verborgen zwischen den Stämmen der Pinien, um das Gift in meiner Mutter Stimme in der Nachtluft schmecken zu können. Mein tyrannischer Vater hatte ihre eigenen Ambitionen genährt. Sie weit über ihren Geburtsstand erhoben. Aber der König ohne Königreich? Dieser Mann riss sie mit hinab in den Ruin, und das konnte sie nicht zulassen. Schon verabscheute sie ihn, obwohl der Rauch seiner Niederlage noch in der Luft lag.
»Mein Sohn, wie werden überleben. Und wieder erstarken«, schärfte sie Hector ein. »Nur musst du dafür den verhätschelten Prinzen hinter dir lassen und zum Mann werden, und zwar noch in dieser Nacht. Govran wird dich unterstützen, sollte jemand Ärger machen.«
Hector bedachte meines Vaters Stallmeister mit einem knappen Blick. »Mutter«, sagte er dann, nickte und sah hinauf zu dem silbernen Eber, als wollte er Mut aus dem Idol ziehen, das über viele Schlachtfelder geblickt hatte und gleichsam Zeuge und gleißender Ansporn der Siege meines Vaters gewesen war. Mein Bruder trat aus dem Schatten und überquerte den sternhellen Schnee, das Feldzeichen fest im Griff und die Hoffnungen meiner Mutter auf seinen Schultern.
Er wies fünf Männer an, innezuhalten und den Rest der Gruppe passieren zu lassen, denn diese fünf sollten nun eine Nachhut bilden für den Fall, dass König Claudas’ Männer uns weiter durch den Wald verfolgten. Sie waren darüber nicht erfreut, diese fünf, und tuschelten und stöhnten, aber meines Vaters finstere Präsenz und langer Schatten waren nah genug, um die Männer daran zu hindern, die Autorität des Jungen infrage zu stellen, dessen Wangen noch keine Bartstoppeln zierten. Dann befahl Hector Derrien und Olier, die beide Pferde führten, vorauszureiten und sicherzustellen, dass uns kein Überfall erwartete. Außerdem sollten sie die Bewohner aller umliegenden Höfe davon in Kenntnis setzen, dass wir bei Ankunft Vorräte erwarteten: Essen und Trinken und sogar Kleidung für all jene in unseren Reihen, die sich dank der übereilten Flucht nicht auf die Strapazen einer langen Wanderung durch den Schnee hatten vorbereiten können.
Und da hätte ich stolz auf Hector sein sollen, wie er erwachsene Männer und erfahrene Mörder befehligte. Wie er uns durch die Trümmer dieser Nacht zu leiten versuchte, auf dass wir überleben würden. Aber ich war ein Knabe mit der engen Weltsicht eines Knaben und hatte eigene Probleme. Die Sperberin würde am Morgen frisches Fleisch brauchen, ich aber hatte ihr keines zu geben. Hinzu kam, dass Hoel gerade erst begonnen hatte, den Vogel abzutragen, und diese Arbeit keinen Tag unterbrochen werden durfte, sonst würde das Tier schnell wieder auswildern, und daher war auch diese Verantwortung die meine, so wenig ich sie auch tragen wollte.
Wie gern hätte ich den Gerfalken genommen. Natürlich hätte ich das. Der prächtige Terzel hätte uns dringend benötigte Nahrung jagen können, hätte Tauben, Wasservögel und Hasen geschlagen und wäre verlässlich auf meines Vaters Arm zurückgekehrt. Hätte ich aber den Weidenkorb geöffnet und ihr die Fesseln gelöst, wäre die Sperberin wohl eher wie ein flüchtiger Traum gen Morgenröte entschwunden und nie mehr gesehen worden. Also musste ich sie füttern und lehren und am Leben halten, obwohl mir in dieser Welt keine Besitztümer blieben außer den Kleidern, die ich am Leib trug, einem Umhang, der die Kälte nicht fernhalten konnte, und dem Falknerhandschuh eines alten Manns.
Aber niemals hätte ich Hoel dafür hassen können. Ich wähnte ihn tot, erschlagen in seiner stickigen Hütte zwischen Mauserkäfigen und ihren kreischenden Insassen. Niedergestreckt von gedankenlosen Männern, die weder seinen weißen Bart respektierten noch den glanzlosen Wert seines Wissens ermessen konnten. Die Sperberin aber, mit ihrem wilden hochmütigen Blick und ihrem Jagdinstinkt, der für uns Menschen ohne Ausbildung noch keinen Nutzen brachte, war nichts als eine Last. Eine ungewollte Bürde. Und so hasste ich sie.
Wir schleppten uns weiter, mehr als hundert Leute, eine Prozession von Flüchtlingen durch den Wald, verlorenen Seelen gleich, welche die Geisterwelt durchwandern in der Hoffnung, wieder in ihre Leiber gerufen zu werden. Mit dem Morgengrauen erreichten wir Calangor, wo wir Rast machten. Niemand hatte den Befehl gegeben, die Lasten abzulegen, Totholz fürs Feuer zu sammeln und die Wunden zu versorgen, jetzt, da es wieder hell genug war. Weder mein Vater noch Hector, nicht einmal meine Mutter hatte das Zeichen zum Anhalten gegeben. Eher war es die gemeinschaftliche Erschöpfung gewesen, ein übermächtiges Gefühl, innehalten zu müssen. Vielleicht nicht nur der Rast wegen, sondern auch, um sich endlich damit zu befassen, was eigentlich geschehen war. Denn die Morgendämmerung erhellt nicht nur die Welt, sondern ebenso den Kopf, und sie kann die Teufel und Geister fortjagen, die danach trachten, uns zu verwirren und zu täuschen und der Dunkelheit anheimfallen zu lassen.
Frauen und Kinder griffen die Helme der Männer und holten Wasser vom Bach. Feuer wurden entfacht, Tannenzweige geschlagen und zum Sitzen auf dem nassen Boden ausgelegt. Die Leute schmolzen Schnee und löschten ihren Durst, teilten die wenigen Vorräte, die sie noch schnell in Säcke hatten stopfen können, ehe sie aus ihren Häusern geflohen waren. Auch Geschichten wurden ausgetauscht, zumindest von denen, die ihrer Stimmen noch Herr waren. Die Geschichten der vergangenen Nacht über Mut, Unglück und Entkommen, und mit den Worten kamen Erkenntnis – wenn auch keine Akzeptanz – und Tränen. Tränen, die den gemächlichen Bach neidvoll gluckern ließen.
Viele fanden im Licht des neuen Tages ihre Liebsten wieder: Ehemänner oder Ehefrauen, Väter oder Töchter, die man schon verloren geglaubt hatte. Freunde begrüßten einander, umarmten sich, weinten, trösteten die Hinterbliebenen und die Verzweifelten, so gut sie konnten. Die Kämpfer prahlten mit ihren Taten, schworen, sich an unseren Feinden zu rächen, behaupteten gar, noch an diesem Tag zurückkehren zu wollen. Sie sprachen davon, König Claudas’ bier- und bluttrunkene Bande zu überraschen, so viele wie möglich zu erschlagen und all unsere Leute zu befreien, denen sonst ein Leben der Sklaverei in einem anderen Königreich bevorstand. Aber ihre Prahlerei war kaum mehr als heiße Luft an einem kalten Tag.
Die Nachhut eingeschlossen waren dreiunddreißig Krieger unter uns, dazu kamen weitere zwölf Männer, junge und alte, die zur Not eine Waffe halten konnten. Nicht genug, um König Claudas zu schlagen. Nicht ohne meinen Vater und Onkel Balsant und unseren Recken Tewdr, die sie ins Feld führten. Wir alle wussten es. Aber Krieger brauchen die Prahlerei wie Könige den Wein, und an diesem Morgen legten sich die Drohungen und Schwüre der Männer wie Wundsalbe auf ihren verletzten Stolz. Denn während die Freunde tot im Schnee lagen und von Claudas’ Männern beraubt wurden, während ihre Waffenbrüder die Schilde gehoben, die Stellung gehalten und bis zum letzten Atemzug gekämpft hatten, waren diese Männer in die Nacht geflohen.
Wie mein Vater und mein Bruder. Wie ich.
Während ich Stöcke für das Feuer sammelte, das Meven, meines Vaters Majordomus, mit aufgefächertem Zunderholz und Reisig erweckt hatte, sah ich sie noch immer vor mir, meinen Onkel und Tewdr, Budig und Salaun und die anderen. Wie Helden aus einer der alten Geschichten hatten sie sich den Feinden entgegengestellt, diese tapferen Männer, damit wir jetzt an diesem Bach liegen konnten – benommen und ausgelaugt und niedergeschlagen, aber am Leben. Eines Tages würden wir sie besingen. Ich war mir ganz sicher. Nachdem mein Vater wieder er selbst geworden war, eine Heerschar ausgehoben und unseren Feinden alles in Stahl und Blut heimgezahlt hatte.
Stahl und Blut. So würde es sein, das schwor ich mir, während ich mit einem Arm voller Zweige und zitternd vor Kälte zurück zu Meven marschierte. Dann sah ich über mein Bündel hinweg, dass ein Junge, vier oder fünf Jahre älter als ich, den Weidenkorb der Sperberin hielt, den ich neben einem silbrigen Birkenstamm abgestellt hatte. Er trug ihn auf eins der anderen Feuer zu, an dem drei Männer kauerten, in die Flammen bliesen und sie nacheinander mit weiteren Holzstücken nährten.
Ich ließ die Stöcke fallen und rannte los.
»Das hier sollte besser brennen als …«, rief der Junge den Männern zu, konnte aber seinen Satz nicht vollenden, denn ich warf mich auf ihn, sprang ihn von der Seite an, sodass wir einen Herzschlag lang flogen und uns dann durch den Schnee wälzten. Die Fäuste flogen, seine größer als meine, und er schrie mich wütend an. Männerflüche aus dem Mund eines Burschen. Bis Hände, die viel größer waren als unsere, seinen Umhang packten und ihn hochrissen. Wieder flog er, riss diesmal aber allein ein Loch in den Schnee.
»Bist du verrückt geworden, Junge?«, brüllte ihn der Mann an. Es war Reunan der Töpfer, und sein Sohn, der meinen Weidenkorb hatte verbrennen wollen, hieß Tudi. »Das ist der Sohn des Königs!«, rief Reunan. »Wegen dir enden wir noch am Strick, oder Schlimmeres. Bei allen Göttern, bitte ihn sofort um Verzeihung!«
»Ich wusste nicht, dass es sein Korb ist, Vater!«, protestierte Tudi, dessen Gesicht aschfahl geworden war, abgesehen von einer geröteten Schramme über dem rechten Auge, wo ihn einer meiner blinden Faustschläge erwischt hatte. »Er hat mich einfach angefallen. Wie ein junger Eber. Was hätte ich denn tun sollen?«
Ich kannte Tudi nur deshalb beim Namen, weil er sich als Hoels Lehrling angeboten hatte, was ich ihm nicht vorhalten konnte, denn die Falken waren unendlich viel interessanter als die Töpfe, die sein Vater fertigte. Reunan sah das anders und hätte seinem Sohn wohl niemals erlaubt, die Kunst der Falkner zu erlernen, selbst wenn Hoel ihn angenommen hätte. Was er natürlich nicht getan hatte.
Der Töpfer packte seinen Jungen am Arm und versetzte ihm mit der anderen Hand eine Ohrfeige. »Du bittest ihn um Verzeihung, Bürschchen, oder ich werde dich halb tot prügeln.«
»Reunan!« Hinter ihm stand seine Frau Briaca, die abgewetzten roten Hände vor den Mund geschlagen. Aber Reunan schlug Tudi ein weiteres Mal, und ein paar Blutspritzer von seiner Lippe landeten im Schnee.
»Es tut mir leid«, fauchte Tudi mich an. Ich hob den schiefen Weidenkorb auf, wischte den Schnee ab und fürchtete, das kleine Tier im Innern könnte sich bei dem Sturz verletzt haben.
»Das ist meiner«, sagte ich.
»Um Vergebung, das wusste ich nicht. Er war so leicht«, beteuerte Tudi. »Ich hab nur nach trockenem Holz fürs Feuer gesucht.«
»Er ist ein Narr, mein Prinz. Das ist mir wohl bewusst. Aber er hat sich nichts Böses gedacht«, sagte Reunan und biss sich auf die Zähne, weil er sich mehrere Finger an Tudis Kiefer verletzt hatte. Ganz schlecht fürs Geschäft. Nicht dass er noch eine Werkstatt gehabt hätte, geschweige denn Kunden, die sich um seine Waren rissen.
»Ja. Trotzdem ist das meiner«, wiederholte ich und hob den Korb vors Gesicht, um durch ein kleines Loch im Flechtwerk zu spähen.
»Nein, Junge. Er gehört mir.« Ich drehte mich um und sah meinen Vater, der an Mevens Feuer auf einer Eichentruhe saß, die einer der Sklaven durch die Nacht geschleppt hatte. Die meisten Sklaven hatten ihre Gelegenheit erkannt und waren im Schutz von Chaos und Dunkelheit geflohen, aber dieser hier, der meines Vaters persönliche Truhe hatte tragen müssen, war streng bewacht worden. »Bring ihn her, Junge«, sagte mein Vater und hob den Kopf ein Stück aus der in Felle gehüllten Masse seines Körpers.
Es waren die ersten Worte, die er gesprochen hatte, seit wir Balsant und Tewdr den Rücken gekehrt hatten, und alle Augen ruhten auf ihm. Jede Zunge rings um das halbe Dutzend Feuerstellen hielt inne. Meine Mutter nickte und zischte mich an, zügig zu gehorchen, denn sie sah den König aus seiner finsteren Teilnahmslosigkeit erwachen und wollte, dass ich ihn weiter hervorlockte.
Der Korb pulsierte in meinen Händen. Ich spürte das Leben darin, er schlug wie ein eifriges Herz. Ich nickte und ging auf meinen Vater zu.
»Als diese ranzigen Schweine schon brandschatzten und schlachteten, hat mein Sohn hier den Mut gehabt, meinen Vogel zu retten«, teilte er der Menge mit und winkte mich mit seiner großen Hand zu sich. »Eine Schande, dass er nicht auch noch den alten Hoel tragen konnte, was?« Seine Stimme war unbewegt wie ein Teich, und die Leute wussten nicht, ob sie in seinen Worten Humor gespürt hatten, verzogen also klugerweise keine Miene.
Ich hätte in diesem Moment etwas sagen sollen, ehe es zu spät war. Hätte erklären sollen, was passiert war. Ihm sagen sollen, dass ich nur getan hatte, was Hoel mir befahl. Aber die Last all dieser Augen drückte mich wie ein Kettenpanzer in den Schnee. Und es war bereits zu spät.
»Vater«, sagte ich und blieb fünf Fuß vor ihm in dem kleinen Kreis stehen, den seine Gefolgsleute um uns gebildet hatten.
»Hol ihn heraus. Ich will ihn ansehen«, sagte der König. Vor Erwartung setzte er sich ein wenig aufrechter. Alle wussten, wie sehr er den Gerfalken liebte. Sein Volk hoffte, der Anblick würde ihrem Herrn die Würde zurückgeben.
Ich stellte den Korb ab, zog Hoels Handschuh aus dem Gürtel und versenkte meine linke Hand in seinem weichen, geräumigen Innern, das nach Schweiß und Schaffett stank. Es fühlte sich an, als würde ich durch diese bloße Handlung Hoels Andenken verraten. Dann streckte ich die andere Hand nach dem Verschluss aus, nestelte mit ungelenken Fingern an der Holzklammer herum, wie Hoel mit seinen alten Krallen am Verschluss der Mauserkäfige, bis ich die kleine Tür geöffnet hatte.
»Claudas, dieser Sohn einer Sau, hat mir doch nicht alles genommen«, murmelte mein Vater in seinen schwarzen Bart, und ich spähte in den Weidenkorb, als könnte ich die Sperberin durch pure Willenskraft in seinen Terzel verwandeln. Mit einem Schrei hieß sie mich einen Feigling. Aus dem Augenwinkel sah ich meinen Vater noch aufrechter sitzen, die dunklen Augenbrauen zusammengezogen. Ich flüsterte auf die Sperberin ein, schob den Handschuh behutsam in ihr schmelzbesudeltes Verlies und hoffte, sie würde mich nicht anfallen, denn sie kannte mich kaum. Langsam bugsierte ich sie aus dem Korb in die rot betupfte Dämmerung. Das Keuchen der Menge ließ sie wütend mit den Schwingen schlagen, aber sie konnte nicht fliehen, denn ich hielt ihre Fessel und ließ sie nicht los.
Ich wandte mein Gesicht ab, nahm mich vor ihrer Schwinge in Acht und wusste, sie hasste die gaffenden Blicke so sehr wie ich. Außerdem verwirrte sie der vertraute Handschuh mit der fremden Hand darin, die ihn nicht ansatzweise ausfüllte.
»Was soll das?«, fragte meine Mutter. Andere murmelten und flüsterten, aber die meisten beäugten weiter meinen Vater und fürchteten seine Reaktion.
»Sie hat sich die Schwanzfedern gebrochen, seht ihr?«, tat Derrien kund, und zu meiner Bestürzung sah ich, dass er recht hatte. Es musste passiert sein, als ich Tudi den Korb abgejagt hatte. Aber die Federn der Sperberin zu brechen war meine kleinste Verfehlung in dieser Stunde, und alle wussten es.
»Junge?« Mehr sagte mein Vater nicht. Seine Augen sagten mehr. Er erhob sich und kam auf mich zu, ich drehte mich ein Stück zur Seite und verdeckte meinen linken Arm, denn ich glaubte, er wolle die Sperberin vom Handschuh nehmen und ihr das Genick brechen. Oder mich schlagen.
Keins von beidem tat er. Ragte nur über mir auf, der Gestank seines Bärenfells schwer in meiner Nase, und starrte böse den Vogel an, der böse zurückstarrte. Tatsächlich erwiderte der Vogel meines Vaters Herausforderung mit einem Blick von solch wütendem Trotz, dass er sie bestimmt bewundern musste. Oder beneiden.
Nur war sie nicht sein schneeweißer Gerfalke und würde es niemals sein.
Der Blick meines Vaters wanderte wieder zu mir, und ich erzitterte. Seine Hände öffneten und schlossen sich unablässig. Er biss sich auf die Unterlippe, dann drehte er mir den Rücken zu. Und dem Vogel. Trottete durch den Schnee zum Feuer zurück.
Und als die Leute gerade ihre Stimmen wiedergefunden hatten und sich weiter den Feuern und dem Aufwärmen widmeten, kehrte mein Onkel Balsant von den Toten zurück.
•
Als die Menschen sahen, wer gekommen war, erhob sich großer Jubel. Alle kamen auf die müden Beine und riefen seinen Namen und hoben die Tassen mit Schmelzwasser, als seien es Bierkrüge bei einer Hochzeitsfeier. Balsant schien zu wissen, dass sie diesen Augenblick brauchten, diesen kleinen Sieg inmitten des Elends, und saß hoch aufgerichtet im Sattel wie ein siegreicher Held, wenn er auch das Schwert in der Scheide stecken ließ und nicht seine Klinge gen Himmel richtete.
Auch mein Herz hüpfte beim Anblick meines Onkels und des Hengstes, der ihn trug, wild in der Brust. Malo. Noch immer glänzte er von meiner Pflege, und seine Muskeln hoben und senkten sich in einem wunderbar fließenden Rhythmus, der den Krieger im Sattel sachte hin und her wiegte. Das größte und beste Pferd meines Vaters. Poliertes Ebenholz. Er war fleischgewordene Nacht, die aus dem Wald ins Morgengrauen trat, und sich seiner großen Bühne ebenso bewusst wie der Mann auf seinem Rücken, der hätte tot sein sollen und es doch nicht war.
Auch wenn man dem Anschein nach durchaus versucht hatte, ihn zu töten. Ein blutgetränkter Stofffetzen umhüllte den rechten Oberschenkel, ein weiterer den rechten Unterarm, beide dürftig gebunden und längst durchnässt. Im Bart und am Hals klebte geronnenes Blut, und die Haut um sein linkes Auge war blau und derart geschwollen, dass er damit sicher kaum etwas sah. Ich versuchte mir den Kampf vorzustellen, aus dem er gekommen war, der einzige Mann von Benoic, der nicht aufgegeben hatte. In meinem Kopf sah ich es vor mir, wie Balsant mit seinem großen Schwert Gegner um Gegner niederstreckte. Ihnen trotzte, bis alles verloren war, und sich dann beinahe widerstrebend zurückzog, um den Kampf an einem neuen Tag fortsetzen zu können.
»Es tut gut, dich zu sehen, Balsant«, grüßte Govran ihn und tätschelte Malos Hals, an dem sich prächtig gezackte Adern unter der Haut wölbten.
»Sind das alle?«, fragte Balsant und sah über die versammelte Gruppe, deren Atem ihm in Wölkchen entgegenstieg. Er hatte mehr Leute erwartet. War vielleicht gar enttäuscht, dass Tewdr, Budig, Salaun und die anderen ihr Leben für so wenige geopfert hatten. Er hatte sich ein besseres Bild versprochen als dieses menschliche Treibgut, das mit der steigenden Morgenröte um die Beine seines Pferds schwappte. Wir hatten wahrhaftig zu viele zurückgelassen.
»Ja«, gab Govran beschämt zu. Mein Onkel stieß einen tiefen, kehligen Laut aus, Malo hob den Kopf in Richtung Lagerfeuer und wieherte leise. Ich wusste, das stolze Tier wunderte sich darüber, dass sein Herr und Meister noch nicht herübergekommen war und sich um ihn kümmerte. Wenn mein Vater das nächste Mal auf den Rücken seines Hengstes stieg, würde er dafür bezahlen.
»Meven, Balsant ist sicher durstig«, rief meine Mutter über die Schulter. Als mein Onkel vom Pferd stieg, ruhte ihr Blick auf seinem Rücken. Govran nahm Malos Zügel. Meine Mutter kam näher und nahm Balsants Hand. Ich sah, wie sich seine großen Finger um ihre legten. Stechender Hass bohrte sich in meine Eingeweide. »Komm. Wärm dich auf«, sagte meine Mutter und führte ihn zum Feuer, an dem mein Vater saß, einer der wenigen aus unserer Schar, die sich nicht erhoben hatten, um Balsant zu begrüßen. Dafür betrachtete er ihn und war sicherlich auch erleichtert, ihn am Leben zu sehen, selbst wenn er es nicht zeigen wollte. Selbst wenn ich ihn endgültig gebrochen hatte, als ich ihm statt des Gerfalken die Sperberin brachte. Selbst wenn ich ihn so maßlos enttäuscht hatte.
»Tewdr?«, fragte Derrien. Natürlich wussten wir alle, dass er tot war, aber selbst in unserem Jammertal waren die Männer nicht über morbide Neugier erhaben. Derrien war nicht der Einzige, der wissen wollte, was unserem Recken am Ende widerfahren war.
»Er hat gekämpft. Er ist gefallen«, sagte Balsant. Mehr wollte er nicht preisgeben. Mein Onkel war kein Barde.
»Hast du König Claudas gesehen?«, fragte Hector. Nach dem Nicken ringsum zu urteilen, war auch das eine gute Frage. Und vielleicht wichtiger als die blutrünstige Erzählung von Tewdrs Untergang.
»Ich habe ihn gesehen«, sagte Balsant und verzog das Gesicht, als er die Hände zum wärmenden Feuer ausstreckte. Die Wunde in seinem Arm musste gesäubert und genäht werden. Aber er hatte schon schlimmere überlebt. »Hätte ihn gern gebührend willkommen geheißen«, sagte er mit zusammengebissenen Zähnen, »aber ich hatte gerade zwei Männer erledigt, als ich sah, wie einer dieser Hurensöhne mit Malo gerungen hat.« Ein Grinsen stahl sich auf seine Lippen. »Hat versucht, das Biest am Halfter zu ziehen, der verdammte Narr, und Malo hielt da natürlich gar nichts von. Also hab ich mich von den Sterbenden verabschiedet, bin zum Pferd gerannt, hab den Idioten niedergestreckt, der ihn stehlen wollte, und bin aufgestiegen, solange die Gelegenheit günstig war. Ich wusste, sobald wir das Chaos hinter uns lassen, kann uns keiner dieser Bastarde mehr einfangen.« Er zuckte mit den Schultern. »Und hier bin ich.«
Hector sah Vater an, aber der König, eingehüllt in Felle und finstere Blicke, hatte offensichtlich nichts zu sagen. Er starrte ins Feuer und hörte lieber den flüsternden Feuerzungen zu, als seinen Bruder anzusehen. »Gut. Wir werden den Göttern für deine Rettung danken, Onkel«, sagte Hector und wurde dafür von meiner Mutter mit einem wohlwollenden Nicken bedacht.
»Zoll nicht den Göttern Dank, Junge. Sondern dem hier«, erwiderte Balsant und ergriff das ziselierte Silberheft des Schwerts an seiner Hüfte. »Und den übrigen Männern, die Schulter an Schulter an meiner Seite gekämpft haben.« Auch wenn es nicht als Beleidigung der Männer gemeint gewesen war, die mit uns geflohen waren, konnten viele von ihnen es kaum als etwas anderes auffassen. Nicht dass Balsant sich darum geschert hätte, was sie dachten. Er hatte es für die Frauen unter uns gesagt, die in Trauer gehüllt dasaßen und ihre Tränen herunterschluckten. Tewdrs Ehefrau Annaig. Budigs Ehefrau Madenn. Salauns Frau Enora. Und all die anderen.
»Wohin gehen wir?«, fragte mein Onkel und sah nacheinander den König, meine Mutter und sogar Hector an. Aber Hector war noch immer mehr Knabe als Mann und konnte sich unter der Last einer solchen Frage nur winden.
»Nach Westen«, sagte meine Mutter. »In König Ronans Land. Er ist kein Freund von Claudas und wird uns helfen. Wenn auch nicht umsonst.«
»Und wir haben das nötige Silber, uns seine Hilfe zu erkaufen?«, wollte mein Onkel wissen. Getuschel.
Meine Mutter legte die Stirn in Falten. Wir hatten das nötige Silber nicht. Und falls wir es doch hatten, wollte sie nicht, dass alle Umstehenden davon wussten. Selbst jetzt, da Balsant bei uns war, fürchtete sie, meines Vaters Männer könnten sich gegen uns wenden. Fürchtete, sie würden uns berauben und töten und sich einem anderen König andienen, vielleicht sogar Claudas selbst.
»Nein, wir sollten nach Norden weiterziehen«, sagte mein Onkel und richtete seinen Blick vorbei an den nahen Kiefern auf das weiße Heidekraut und die Eichen und noch weiter in die Ferne. Die Morgensonne tauchte seine rechte Gesichtshälfte in einen kränklichen Glanz, und im Schatten daneben sah ich Flüssigkeit aus dem geschwollenen linken Auge sickern. »Nach Norden zu Bro-Dreger«, schloss er.
»Zum Bettlerkönig?« Die Stimme des Königs war ein tiefes Grollen wie Felsen, die einen fernen Berghang hinabstürzen.