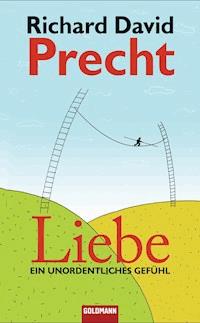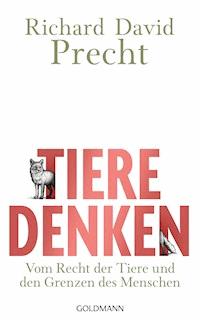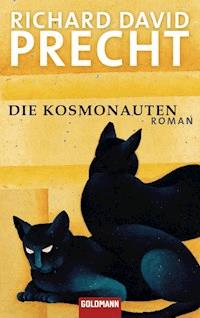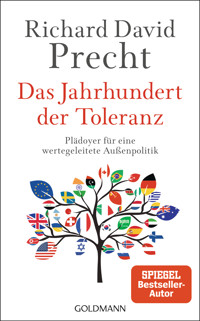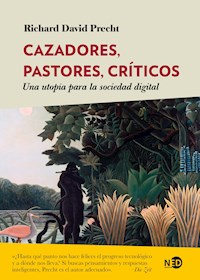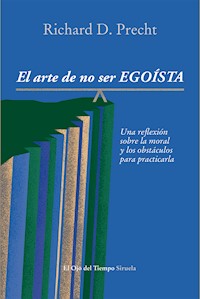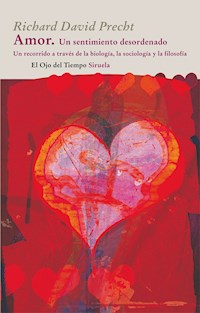8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Kind westdeutscher Linker im provinziellen Solingen lernt Richard David Precht schon früh zwischen Gut und Böse zu unterscheiden: Sozialismus und Kapitalismus. Er wächst mit einem klaren Feindbild, den USA, auf, und natürlich ist Coca-Cola ebenso verpönt wie Ketchup, „Flipper“ oder „Raumschiff Enterprise“. Dafür gibt es das GRIPS-Theater und Lieder von Degenhardt und Süverküp ... Prechts Kindheits- und Jugenderinnerungen sind eine liebevolle Rückschau auf ein politisches Elternhaus – amüsant, nachdenklich und mit großem Gespür für die prägenden Details.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
In Lüdenscheid, einige Kilometer östlich von seiner Heimatstadt Solingen, schien die Weltrevolution in den frühen siebziger Jahren bereits geglückt. Liedermacher sangen dort von der großen Solidarität zwischen Kindern und Erwachsenen, man feierte den »Internationalen Tag des Kindes«, und die Schauspieler des Berliner Kinder- und Jugendtheaters »Rote Grütze« trugen Unterhemden mit aufgemalten Brüsten und redeten über Pipi und Kacka. Die Kindheits- und Jugenderinnerungen von Richard David Precht sind eine liebevolle Rückschau auf ein politisch linkes Elternhaus in der westdeutschen Provinz. Bei Altersgenossen rufen sie vertraute Erinnerungen an die Leidenschaften eines vergangenen Jahrhunderts wach. Amüsant, nachdenklich und mit dem Gespür für die prägenden Details erzählt Richard David Precht das Gegenstück zur bürgerlichen Jugend der »Generation Golf«.
Autor
RICHARD DAVID PRECHT, geboren 1964, ist Philosoph, Publizist und Autor und einer der profiliertesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Er ist Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Von 2011 bis 2023 war er zudem Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana Universität Lüneburg. Seit seinem sensationellen Erfolg mit »Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?« waren alle seine Bücher zu philosophischen oder gesellschaftspolitischen Themen große Bestseller und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Seit 2012 moderiert er die Philosophiesendung »Precht« im ZDF und diskutiert zusammen mit Markus Lanz im Nr.1-Podcast »LANZ & PRECHT« im wöchentlichen Rhythmus gesellschaftliche, politische und philosophische Entwicklungen.
Von Richard David Precht ist im Goldmann Verlag außerdem erschienen:
Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? Eine philosophische Reise
Liebe. Ein unordentliches Gefühl
Warum gibt es alles und nicht nichts? Ein Ausflug in die Philosophie
Die Kunst, kein Egoist zu sein. Warum wir gerne gut sein wollen und was uns davon abhält
Anna, die Schule und der liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern
Die Kosmonauten. Roman
Die Instrumente des Herrn Jørgensen. Roman
Tiere denken. Vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen
Erkenne die Welt. Geschichte der Philosophie I
Erkenne die Welt. Geschichte der Philosophie II
Immer mehr ist immer weniger. Gedanken zur Zeit
RICHARD DAVID PRECHT
Lenin kam nur bis Lüdenscheid
Meine kleine deutsche Revolution
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © dieser Ausgabe 2016 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotiv: © privat; FinePic®, München
KF · Herstellung: Str.
ISBN 978-3-641-16870-4V005
www.goldmann-verlag.de
Heute war gestern – morgen auch
Allen, die auf ihre Weise zu diesem Buch beigetragen haben, und sei es auch nur in einer Geste oder einer Redensart
Vorwort
Lenin kam nur bis Lüdenscheid. Bis Solingen ist er nicht gekommen. Aber fünfundzwanzig Kilometer weiter östlich, im Zeltlager in Lüdenscheid, schien die Weltrevolution bereits geglückt. Die große Bühne glänzte im Sonnenlicht des jungen Morgens. Zu beiden Seiten wehten die roten Fahnen. Von der Wiese her klimperten schon die Gitarren von Christiane und Fredrik Vahle, eine kleine Schar Kinder hatte einen Kreis um sie gebildet, die anderen schliefen noch in den Zelten. Wieder und wieder hatten wir gestern Abend ihre Lieder gesungen: das Lied von der Rübe, die der kleine Paul nur mit Hilfe der »Italiener-Kinder« aus der Erde ziehen kann, vom Hasen Augustin, der den dicken Jäger verarscht, und vom Fisch Fasch, dem faulen Nutznießer, dem die erbosten Arbeiter den weißen Hintern versohlen. Wir kannten sie alle von der Kinderplatte.
Die Lager fanden jedes Jahr statt, aber für Hanna und mich war es 1974 das erste Mal. Überall prangten die Embleme der DKP und der Naturfreunde, hier im Bergischen Land war beides nahezu identisch. Zu Tausenden waren die Parteimitglieder der KPD nach dem Verbot in den Fünfzigern der Naturfreundebewegung beigetreten und hatten sie fest in der Hand.
Ich setzte mich zu Christiane und Fredrik und sang mit. Es roch nach feuchtem Gras und nach dem Feuer der letzten Nacht. Allmählich wurde es wärmer. Die roten Fahnen hingen ruhig herab, es war jetzt windstill. Ich streckte mich auf die Wiese und gab mich der Stimmung hin, und immer wieder kam es mir unglaublich vor, so mittendrin zu sein unter Gleichgesinnten. Wie selten hatte ich dieses Gefühl, einer größeren Gruppe zuzugehören als meiner Familie. Hanna schien es genauso zu gehen, den gestrigen Tag über hatten wir uns kaum gesehen, ein jeder war seine eigenen Wege gegangen in dem unübersichtlichen Wust von Angeboten.
Auch heute gab es viel zu tun. Ich feilte eine ziemlich klobige Eule aus einem Ytong-Stein, las das erste Tim-und-Struppi-Heft meines Lebens und motivierte ein paar Kinder zu einem improvisierten Theaterstück auf der großen Bühne. Dann kam der Auftritt der Roten Grütze, eines Kindertheaters aus Berlin. Wir ärgerten uns, dass wir den Platz räumen mussten. Das Stück war doof. Es ging ziemlich viel um Kacka und Pipi. Warum die Linken das so toll fanden, wollte mir nicht in den Kopf. Auf der Bühne hatten alle Darsteller Unterhemden an, und auf den Hemden der Frauen waren mit gelber Farbe Brüste aufgemalt; sehr ansprechend war das nicht.
Die Erinnerung ist wie ein Autoscheinwerfer, der mal ein Haus, mal ein Gesicht der Dunkelheit entreißt. Denke ich an Lüdenscheid, sind es die Käfer, die vielen Junikäfer, die am frühen Abend aus der Erde krochen. Maikäfer kannte ich, hatte ich schon gesehen, aber die kleineren Junikäfer noch nie. Überall auf der Wiese brummte es. Aus den Büschen am Rand kam das Gekicher der Gruppenleiter und ihrer Freundinnen.
Im Zelt zeigte Hanna mir ein T-Shirt, das sie nachmittags unter Anleitung mit dem Händedruck bemalt hatte, dem Zeichen der Naturfreunde und der Kommunisten. Sie sagte, dass sie von nun an bei den »Jungen Pionieren« mitmachen wollte und dass sie sich dann wohl ihre langen Haare abschneiden müsste, weil sie nicht zeltlagertauglich wären. Tatsächlich waren sie verfilzt und hingen voller Kletten. Hinter ihr sah ich ein älteres Mädchen, das ihr T-Shirt auszog. Ihre Brüste waren nicht aufgemalt, sie machten ein kribbeliges Gefühl. Ich hätte sie länger angeguckt, hätten nicht die Junikäfer draußen auf mich gewartet.
Hanna und ich traten zusammen ins Freie. In der Dämmerung glühten die Fackeln, und überall zwischen den Bäumen gingen jetzt rote Lampions an. Die Junikäfer schwärmten noch immer, es waren Tausende. In der Mitte des Lagers brannte ein riesiges Feuer, die Kinder hatten sich im Schneidersitz darum versammelt, um zu singen. Christiane und Fredrik spielten wieder auf der Gitarre und mit ihnen die Gruppenleiter und einige der Jugendlichen: Spanien-Lieder, die »Moorsoldaten« und »Die Internationale«.
Der Wind wehte die kleinen Rauchwölkchen auseinander. Glühende Pünktchen. Die Kinder sangen jetzt »Bella Ciao« und das todtraurige Lied vom »Kleinen Trompeter«. Mehrere Scheite im Feuer zersprangen, und Funken sprühten in die kälter werdende Luft.
»Was ist los?«, wollte Hanna wissen. »Du weinst ja.«
»Es ist nur der Rauch«, murmelte ich und blickte zur Seite, obwohl das Feuer fast rauchlos brannte.
*
»Erinnerst du dich an das Pfingstlager in Lüdenscheid 1974?«
Wir sitzen in der weiten Essecke, meine Mutter auf dem Stuhl, ich auf der langen Bank. Schon zum Frühstück vor Stunden bin ich hier reingerutscht, wie ein Kind, das man ja immer bleibt. Nur dass man das Kindsein hier merkt; wenn man bei seinen Eltern ist, denkt man unausgesetzt daran, es zu vergessen.
Draußen liegt Schnee. Ein Schweizer Architektenteam hat dieses Haus aus Würfeln und Quadern vor dreißig Jahren erschaffen, ein kubistischer Traum im Geiste von Le Corbusier, Beton im Wald. Hinter den Hügeln liegt Bern. Manchmal kommen architekturinteressierte Touristen und schauen.
Wir trinken Kaffee aus bunten Tassen. Meine Mutter raucht, rauchen darf sie noch, Wein trinken nicht mehr, wegen der Gichtanfälle. Die Wintersonne im Gesicht, die teilnahmslose Zigarette in der ruhigen Hand. Wir schweigen, um uns zu erinnern.
Ihrer wahren Natur nach sind Utopien Amphibien. Der kurzen Zeit ihres feuchtfröhlichen Laichvergnügens folgt eine lange Zeit der Ruhe. Träume und Hoffnungen überwintern in den Falten der Mundwinkel, den schmalen Kerben der Lachfalten. Augenringe und Krähenfüße sind ihre Lebensräume in der Trockenzeit; Signaturen eines versteckten Daseins. Meine Mutter stellt keine Fragen. Warum ich dies wissen will und jenes, und wofür das Ganze. Sie fragt selten. Sie wartet ab, lauert auf das, was kommt. Lauert leise. Da ist nichts Gesetztes, nichts Bequemes, nichts, das die Routinen des Lebens immer wieder in die gleichen Bahnen gelenkt hätten, sodass es bedächtig, geruhsam, stumpf und weise, mit anderen Worten: alt geworden wäre. Nicht Schönheit, nichts Damenhaftes, keine Attitüde des Geschlechts hat meine Mutter, inzwischen fünffache Großmutter, vom Altwerden abgehalten. Sie war eine schöne Frau mit schlankem Hals und einem großen Mund, dünn und kapriziös, aber schon mit Mitte dreißig hatte es ihr wohl nichts mehr bedeutet. Vielleicht fand sie sich selbst nie schön und ihren Hals stets zu lang; sie trug das Haar kurz, schminkte sich nicht und kleidete sich weit über das linke Soll hinaus unvorteilhaft. Nein, nichts Äußerliches hat meine Mutter jung bleiben lassen. Kein Ziel hat ihr den Weg ins Alter gewiesen, keine Ruhe, kaum innerer Frieden. Wahrscheinlich ist es erstrebenswert, Ruhe zu finden. Es bereitet auf den Tod vor und macht Menschen angenehm, gelassen, freundlich, einfältig und etwas langweilig. Ruhe ist die tägliche Nahrung des Alterns. Meine Mutter ist nicht gelassen, sie zeigt, was sie zeigen will.
Was bleibt, ist ein dritter, ein letzter Lebensabschnitt, in einer Wohnung in Bern zu ebener Erde. Oder woanders? Sie hat nie richtig Fuß gefasst in der Schweiz, in ihrem zweiten Leben. Vielleicht nur in ihrem Sommerhaus in Dänemark; Meerwind, Kirschbäume, spatzenhaftes Kindergezwitscher, die Enkel im Garten, wenn nur diese leeren feuchten Winter nicht wären, ohne Farben, ohne Menschen, ohne Schnee. Und eine Sprache, die sie sich selbst nach dreißig Jahren kaum traut, zu sprechen.
Im Regal stehen Bücher über Wüsten. Sie ist mit John in die Sahara gefahren, wieder und wieder in den letzten Jahren. Sie liebt die Wüste; Wind und Sterne und Unendlichkeit. Die Zeit ist der Sand, der sich bewegt. Nomadenglück. Nomadisch leben wollte sie schon immer, in Zelten statt in Häusern, ohne etwas zurückzulassen, woran das Herz hängt. Man macht sich nicht abhängig von toten Gegenständen. Das hat sie oft gesagt; sie lebt so.
Heute Nachmittag kommt der Makler, der das Haus verkaufen soll.
»Ich denke eigentlich nicht gern an die Vergangenheit«, sagt sie jetzt, das sei die Beschäftigung von alten Leuten. »Ich denke lieber an das bisschen Zukunft, das mir noch bleibt.«
Auch für mich geht etwas zu Ende mit diesem Abschnitt. Die Achtziger, die Neunziger, das Würfelhaus im Wald. Wenn ich die Augen schließe, ist es gestern, dass ich das erste Mal hier war und so beeindruckt davon, wie meine Mutter jetzt lebt.
Auf dem Weg gestern von Innsbruck durch das Inntal nach Bern war alles eingeschneit. Winter in den Alpen. Der Zug fuhr langsam auf schmaler Schneise durch die Landschaft. Das zerfledderte Manuskript in dem alten Schnellhefter. Der war mit jedem neuen Buch unterwegs, in Dänemark, in Berlin und jetzt hier im Februargrau.
Es war einer jener stillen zugefrorenen Wintertage. Trübgraue Scheibe. Es gibt nichts, das den Blick festhält, meine Gedanken sind mit sich selbst allein. Die letzten Tage kommen wieder, der Ski-Urlaub in Alpbach in Österreich, Freundin, Schwiegereltern, mein kleiner Sohn, der das erste Mal Schnee sieht, richtigen Schnee. Eiszapfen anfassen und abknicken, das winzige Schneeflöckchen von der weichen Wange fingern und aufessen, jedermanns Kindheit.
Einer jener Tage ohne Licht und Nuancen, wenn alles, was man sieht, immer schon da war. Die Tannen voll geschneit, ausgeschnitten aus alten Weihnachtspostkarten, die braunen Hütten, eine wie die andere, sorgsam an den Schienen verteilt, die nebelnassen Wände der viel zu nahen Berge, die gleichförmige scheppernde Ruhe des Zuges, das angetrocknete Schmelzwasser auf dem Boden des Abteils.
Ein neuer Aufbruch also, ein dritter. Wäre er eigentlich ein anderer, wenn tatsächlich eine andere Gesellschaft gekommen wäre? Und was für eine hätte das sein sollen? Irgendsoeinsozialismus? Der Gedanke, dass alles auch hätte anders kommen können, erscheint mir von Jahr zu Jahr seltsamer. Vielleicht denke ich deshalb gern an die Vergangenheit. Für mich ist es keine Reise in die Geschichte, sondern in die Gegenwart meines Erinnerns. Jeder Augenblick ist ein solcher des Gerichts über all die Augenblicke, die ihm vorangegangen sind. Biografie ist mitgeschleppte Gegenwart, tagtägliche Identität. Ein Felsen, auf dem man steht, oder einer, den man auf dem Rücken herumschleppt.
Die Degenhardt-CDs, die neuen aus den letzten Jahren, die ich ihr geschickt habe, hat sie mir zurückgegeben, sie hat sie nicht gehört. Sie hört kaum Musik. Zuletzt noch einmal Elvis Presley, er erinnerte sie an ihre Jugend. Dass sie früher Elvis gehört hat, hat sie mir nie erzählt. Wann ist das gewesen? In Buchholz oder in Hünfeld? Oder erst später in Hannover?
Wir reden wieder und reden. Man merkt, dass man sich erinnert, wenn das Erzählen keine geistige Anstrengung kostet, wenn es einfach da ist und einen Raum spinnt. Der französische Dichter Valéry meinte einmal, dass jemand kaum in der Lage sei, die Fenster eines Hauses zu zählen, an das er sich erinnert. Der Sicherheit der Erinnerung entspricht die Unsicherheit ihrer Details, ohne dass die Gefühle einander widersprechen. Das eine und das andere können nicht sein. Meine Mutter erinnert sich gut, aber auch sie vergisst, verwechselt, erfindet. Und ich vergesse, verwechsle, erfinde auch. Welches ist meine Wahrheit, die Wahrheit der Erinnerung oder die Wahrheit meines späteren Wissens?
Das Radio spielt leise vor sich hin, nur die Wetteransagen erreichen ihr Ziel. Das Barometer an der unverputzten Betonwand ist hundertfünfzig Jahre alt, Admiral Fitzroy soll so eines benutzt haben, als er die Welt umsegelte, einen jungen Herrn Darwin mit an Bord seines Schiffes. Es ist hübsch, schon oft hat John mir erklärt, wie es funktioniert. Manchmal habe ich es fast verstanden; behalten habe ich es nicht. Jetzt zeigt es auf Tief, ein ganz tiefes Tief.
Sie hat Ja gesagt, nicht Nein. Eigentlich hat sie gar nichts gesagt, sie hat nur genickt und die Alben aufgeschlagen.
Bilder.
Erinnerungen.
Sie belasten – vielleicht. Ein anderes Mal tun sie gut, helfen beim Blick auf sich selbst, nicht Bürokrat seiner eigenen Meinung zu sein, die ekstatische Mitgift des Lebens und der Umstände wieder zu spüren, die Gefühle und Stimmungen, Zufälle und Gelegenheiten, die verpassten und unverpassten.
Gegenwart, Geschichte, Vorgeschichte, beim Blättern überflogen. Richard 1968 mit verwuschelten Haaren, die Wolldecke aufgeschlagen, kurz nach dem Mittagsschlaf.
Meine Mutter blättert weiter. Zum Lesen benutzt sie eine schmale Brille, sie ist mir nie aufgefallen. Wie viele Jahre benutzt sie die Brille schon? Wir sehen uns so selten. Sie sieht auf und sieht mich an.
»Alles in Ordnung?«
»Hm.«
»Hast du schon mit Hanna darüber geredet?«
»Nein.«
»Willst du noch mit Hanna reden?«
»Weiß nicht. – Doch, ja, bestimmt.«
Minuten später ist meine Mutter in die Küche gegangen, im Dunkel verschwunden, und ich sehe mir selbst zu, wie meine blätternde Hand Erinnerungen aus dem Album herausholt in diese ihnen so fremde Umgebung. Ich sitze noch immer in der Essecke und habe die leere Tasse vor mir auf dem Tisch abgestellt. Ab und zu verweile ich auf einer der Seiten, erinnere mich an manches, erinnere meine Erinnerungen vom letzten und vorletzten Mal, als ich das Album in der Hand hielt, weil sich Bild um Bild nun wieder mal über das andere legt.
Wenn ich jetzt aufstehe und in den Garten blicke, ins kalte Winterlicht, auf den hellen Beton zu beiden Seiten, über die Ausschläge von Rost auf der Haut der verschneiten Gartenstühle hinweg ins kahle Gestrüpp, das zeitlos gealterte Gartengerät daneben und das teilnahmslose allzu wirkliche Weiß des Schnees, der seit Jahrmillionen wohl nichts anders tut, als auf das Verschwinden der Menschen zu warten, erscheint mir die eigene Kindheit als etwas, das nur ein Traum sein könnte, ein Erinnerungsfilm, begonnen in Schwarzweiß, weiter gedreht in den rotstichigen Farben der frühen siebziger Jahre, dann bunt und bunter und noch immer unfertig.
Ich höre meine Mutter im Haus. Ich warte auf die vertrauten Geräusche ihres Gangs, den unmerklichen Rhythmus ihrer Schritte, den stillen Ton ihrer Anwesenheit, schließe die Augen dabei und höre den vertrauten Klang einer Kindheit und einer Jugend in Erwartung einer Gesellschaft, die in meinem Kopf schon blühte, in Wirklichkeit dagegen nur kurz als Keimblatt sichtbar durch den Asphalt brach.
Ho-Ho-Ho-Chi-Minh
Muss man das Bewusstsein der Menschen verändern, um Revolution zu machen, oder muss man Revolution machen, um das Bewusstsein der Menschen zu verändern?
John von Düffel: Solingen
Ich wurde am 8. Dezember 1964 in Solingen geboren. Der Spiegel druckte an diesem Tag den vierten Teil seiner Serie über den zehnten Jahrestag der Niederlage der Franzosen im vietnamesischen Dien Bien Phu gegen die Befreiungsarmee der Viethminh. Der oberste US-amerikanische Bundesgerichtshof entschied, dass außereheliche Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen nicht mehr durch Landesgesetze verboten werden durften, und erklärte damit die Rechtspraxis von Florida, wonach Angehörige verschiedener Rassen die Nacht nicht gemeinsam in einem Zimmer verbringen durften, für ungültig. In Deutschland sprachen sich 23 Prozent der Erwachsenen gegen das Händeschütteln bei der Begrüßung aus, 67 Prozent waren dafür, 10 Prozent gaben an, es wäre ihnen gleich. Der Karl-May-Film »Unter Geiern« feierte seine Kino-Premiere.
1964 ist das Jahr, in dem die letzte gesamtdeutsche Olympiamannschaft bei Olympischen Spielen antrat. Bundeskanzler Ludwig Erhard bekräftigte die Ablehnung der Oder-Neiße-Grenze zwischen Deutschland und Polen. Die DDR und die UdSSR einigten sich auf eine »Dreistaatentheorie«, die neben den beiden deutschen Staaten auch Berlin als eine selbständige politische Einheit betrachtete. Anti-Atomkriegsdemonstrationen brachten mehr als 100 000 Menschen auf deutsche Straßen. In Hannover formierten sich alte und neue Nazis zur NPD. Willy Brandt wurde Vorsitzender und Kanzlerkandidat der SPD; Heinrich Lübke zum zweiten Mal Bundespräsident. Die PLO wurde gegründet, der sowjetische Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow verlor seine Ämter, die Volksrepublik China zündete ihre erste Atombombe. Der US-Bürgerrechtler Martin Luther King erhielt den Friedensnobelpreis, Jean-Paul Sartre den Nobelpreis für Literatur, den er ablehnte.
Im August feuerten nordvietnamesische Torpedoboote im Golf von Tonkin versehentlich auf den amerikanischen Zerstörer »Maddox«. Die USA fingierten daraufhin noch einen zweiten Angriff und verabschiedeten die »Golf-von-Tonkin-Resolution« – einen Freifahrtschein zum Angriff auf Nordvietnam. Im November gewann der amtierende amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson die Wahlen. Anders als sein republikanischer Gegner Barry Goldwater versprach Johnson: »Wir werden keine amerikanischen Jungs neun- oder zehntausend Meilen weit von zu Hause wegschicken, um zu tun, was asiatische Jungs selbst erledigen sollten.« Drei Monate später begann die Operation »Flaming Dart« und mit ihr der Luftkrieg der USA gegen Nordvietnam.
*
Ich bin gesund zur Welt gekommen; ganz selbstverständlich war das für meine Eltern nicht. Ein älterer Bruder war nach wenigen Monaten im Mutterleib gestorben. Meine Schwester Johanna Maria wurde fast genau ein Jahr vor mir geboren, mit einem gespaltenen Rückenwirbel und offenen Nervensträngen, aber als einem vergleichsweise undramatischen Fall von Spina bifida verzichteten meine Eltern auf eine Operation.
Meine Mutter hatte von Anfang an mindestens fünf Kinder gewollt, und ihre Sehnsucht nach einer großen und intakten Familie saß tief. Sie ist am 1. August 1938 in Neuhof bei Berlin geboren, aber das Dorf war nicht mehr als eine kurze Station im rastlosen Leben ihres Vaters. Aufbrausend, mit viel Sinn für Alkohol, Frauen und Skandale war er, wo immer er hinkam, nach einiger Zeit nicht mehr tragbar und bescherte meiner Mutter eine weitgehend nomadische Kindheit und Jugend. Als gelernter Zimmermann und späterer Fachmann für Hochbau entstammte Opa Herbert dem politisch konservativen Handwerkermilieu. Seine Frau Hanna hatte den gefragtesten Schwerenöter ihrer Heimatstadt Buxtehude geheiratet, und er die begehrteste Bürgertochter des Viertels. Obwohl ihr Vater Klempner war, zierte sie sich mit einem bürgerlichen Dünkel. Ein paar weitläufigere Verwandte waren »Vorwerksbesitzer« in Niederschlesien gewesen, aber es war schon notwendig, nicht zu wissen, was ein »Vorwerk« war, um Stolz und Ehre daraus abzuleiten. Immerhin bewahrten ihre Allüren Opa Herbert davor, eine Nazi-Karriere anzustreben, deren Voraussetzungen er – groß, blond und laut – weitgehend erfüllte. Der Nationalsozialismus war Oma Hanna zu dumm und zu primitiv, und der »Führer« eben nur ein emporgekommener Gefreiter. Genau diesen untersten aller Dienstgrade erreichte Opa Herbert in Norwegen als Soldat. Ein Leben lang sollte er von diesem Land schwärmen, von der Landschaft und, wie sollte es anders sein, von den blonden Frauen. Nach dem Krieg lebte die Familie in Köthen in Sachsen-Anhalt, in Buxtehude, in Buchholz in der Nordheide und im hessischen Hünfeld. Ein jüngerer Bruder wurde geboren, doch das Verhältnis zwischen meiner Mutter und ihm blieb zeit ihres Lebens blass. Sehr oft fühlte sie sich einsam, die vielen kinderreichen Familien in der Nachbarschaft dagegen erschienen ihr als sehr paradiesisch, und schon als Mädchen stellte sie sich ein späteres Leben vor mit vielen Kindern.
Meinem Vater hingegen war der Gedanke an viele Kinder unheimlich. Er war am 30. April 1933 in Hannover zur Welt gekommen. Die Krankenschwestern äußerten sich hocherfreut über die himmlische Ruhe, die am nächsten Tag auf der Entbindungsstation des Mütter- und Säuglingsheims einzog; es kamen keine Väter zu Besuch. Sie fanden sich ein zu den erstmals veranstalteten Nazi-Kundgebungen und Aufmärschen zum 1. Mai, der nun »Tag der nationalen Arbeit« hieß. Meine Oma nannte meinen Vater Hans-Jürgen, inspiriert von dem gleichnamigen Helden eines Groschenromans. Ihr Mann arbeitete beim Fernmeldedienst der Post; als guter Beamter freute er sich darüber, dass es ein Sohn war und kein Mädchen, der Name Christel nach der »Christel von der Post« aus der Operette »Der Vogelhändler« lag schon für den Notfall bereit. Als Fünfjähriger stand mein Vater in Göttingen am Rande des Waageplatzes und sah zu, wie ein Trecker mit einem daran befestigten Seil Teile einer Brandruine abriss: die Göttinger Synagoge, zerstört am 9. November 1938. Die Zuschauer standen schweigend herum. Alles das hatte etwas mit diesem Adolfittler zu tun gehabt. Dass der Mann Hitler und nicht Fittler hieß, erfuhr mein Vater erst später. Die Kriegsjahre hinterließen ihre Spuren in einem Heft mit Zeitungsausschnitten, insbesondere mit Fotos von Flugzeugen und Kriegshelden, meist U-Bootkommandanten oder Jagdfliegern. Hinter den Gartenkolonien, zwischen Stadtfelddamm und Roderbruchstraße lagen die Flakstellungen. Mein Vater verbrachte glückliche Tage unter den Soldaten; die Kinder schauten neugierig durch riesige Ferngläser mit Fadenkreuz oder nahmen Platz auf den blechernen Sitzschalen der Richtkanoniere an den Geschützen und Scheinwerfern. Abends bastelte er mit seinem Vater Kampfflugzeugmodelle aus vorgefertigten Ausschneidebögen, und mit den Jungen aus der Nachbarschaft sammelte er Granatsplitter. Ein vier Zentimeter langer Splitter galt lange Zeit noch als echte Rarität, aber als nach den großen Angriffen die Splitter zu Tausenden herumlagen, verlor das Spiel seinen Reiz. Auch das »Jungvolk« war zunächst spannend, erst später lernte er seine Anführer hassen, die ihn und seine Kameraden den ganzen Tag in der Sonnenhitze marschieren üben ließen. Schreie, gebellte Befehle, lautes Blöken für das Begräbnis von Viktor Lutze, dem Stabschef der SA, der 1943 in Hannover beerdigt wurde. Die Trauerfeier bereitete meinem Vater noch ganz andere Sorgen. Die »Pimpfenhose«, die seine Mutter aus Stoffresten von Eisenbahnermänteln genäht hatte, war viel zu kurz geraten. Mein Vater hatte darauf bestanden, dass sie nicht länger sein durfte als drei Handbreit über dem Knie, hatte aber sichtlich Hand und Finger verwechselt. Die letzten beiden Kriegsjahre verbrachte mein Vater bei den Großeltern in Göttingen, das Gymnasium, auf das er in Hannover gegangen war, lag in Trümmern. Er lernte den Göttinger Kreisleiter Thomas Gengler hassen, die schnauzbärtige Visage, die herunterhängenden Mundwinkel unter dem tief gezogenen Mützenschirm. Sein sozialdemokratischer Großvater hielt die Nazis schlicht für »borniert« – ein Ausdruck, den mein Vater später bei Marx wieder fand. Da das Schulgebäude zerstört war, wurde der Unterricht nach dem Krieg im Freien erteilt und bestand überwiegend aus Sport. Vergleichbar ertüchtigend waren die Aufräumarbeiten, zum Beispiel das Zuschaufeln der von den Bomben aufgeworfenen Gräber der Friedhöfe. Erst vom elften Schuljahr an stand wieder ein fest gemauertes Gymnasium zur Verfügung. Mein Vater lernte Zigaretten auf dem Schwarzmarkt einzutauschen und die Kniffe des Geräteturnens im Turnverein. Die erste der beiden Künste verlor rasch an Bedeutung, im Turnen dagegen brachte er es bis zu den bundesdeutschen Jugendwettkämpfen im rheinland-pfälzischen Ingelheim.
Auch mein Vater hatte als Einzelkind die Häuser von Kameraden mit vielen Geschwistern geliebt und sich dort wohler gefühlt als zu Hause; als Vater einer kinderreichen Familie sah er sich gleichwohl nicht. Er hatte überhaupt keine genauen Vorstellungen von seiner Zukunft. Nach seinem Abitur 1952 war er durch die Aufnahmeprüfung für den gehobenen Dienst bei der Post gefallen. Mein Vater studierte Schiffsmaschinenbau an der Technischen Hochschule und lernte nun auch auf diesem Gebiet etwas über seine Grenzen. 1956, nach sechs Semestern, verlor er endgültig die Lust und mein Opa in den Sohn jegliches Vertrauen. Als mein Vater sich bald darauf in die Werkkunstschule einschrieb, um etwas zu werden, das sich »Formgestalter« nannte, tat er es noch immer ohne jede Überzeugung. Die Klasse hatte nur eine Hand voll Schüler, und der Begriff »Design« war außerhalb dieser Räume in Hannover ein Fremdwort, nicht einmal was eine Werkkunstschule war, ließ sich ohne größeren Aufwand vermitteln. Die Firma Max Braun hatte soeben die erste deutsche Stereoanlage auf den Markt gebracht, die die Ideen des Bauhaus konsequent auch auf Musikmöbel anwendete. Die neuen Geräte waren hell, fast schmucklos und vergleichsweise technisch, und die Zauberformel der Zeit hieß form follows function. Braun-Radios gewannen zwar von nun an im Ausland Preise für Design, aber einen größeren Markt für die kargen und teuren Geräte gab es in Deutschland nicht. In der Werkkunstschule dagegen waren sie Kultobjekte, und das »ehrliche« form-follows-function-Design als klare Abfuhr an den Barock des kleinbürgerlichen Wohnzimmers überzeugte auch meinen Vater. Wie viele seiner Generation schwärmte er für französische Filme von Jean Cocteau und Marcel Carné und rauchte Gauloises. Er fuhr mehrmals nach Paris, und über seine Kollegen an der Werkkunstschule bekam er Zugang zu einem Kreis von Intellektuellen, die sich im ehemaligen Sitzungssaal des alten Rathauses im Hannoveraner Stadtteil Linden trafen, der zu einer Galerie umfunktioniert war. Mein Vater war Mitte zwanzig, als er dem etwas älteren Adam Seide begegnete, einem gelernten Setzer, der die Galerie betrieb. Der Name war ein Pseudonym, und Seide ein bekennender Existenzialist, der nur schwarze Klamotten trug und sein Leben lang auch dabei bleiben sollte. Er hatte ein großes Talent, Menschen anzuziehen, die ein wenig anders waren als der Durchschnitt. Einige davon interessierten sich sehr ernsthaft für die Kunst in der Galerie, für die Bilder einiger noch nahezu unbekannter Künstler wie Günter Uecker, Otto Piene, Ernst Mack, Arnulf Rainer, Piero Dorazio oder Igael Tumarkin. Der honorablen Kestner-Gesellschaft, die mit dem Geld des Sprengel-Konzerns zu jener Zeit Expressionisten und andere verfemte Künstler der zwanziger und dreißiger Jahre ausstellte, waren sie nicht gut genug. Die kleine Galerie abseits des etablierten Kulturbetriebs aber wurde zum Treffpunkt einer jungen Garde, die im kulturellen Leben der Bundesrepublik später ihre Fingerabdrücke hinterlassen sollte: Henning Rischbieter, gerade dreißig und Geschäftsführer der Volksbühne, gründete hier die Zeitschrift Theater Heute; Peter Merseburger, Redakteur bei der Hannoverschen Neuen Presse, begann gerade seine journalistische Karriere; Eberhard Fechner, ein Schauspieler vom Ballhof-Theater, wurde später Intendant und als Dokumentarfilmer einer der Großen seines Fachs; Dieter Helms, als Kunstlehrer am Gymnasium tätig, schaffte es über eine Kunst-Professur in Hamburg in den Beirat der Documenta, und die Karriere des Soziologiestudenten Ernst Wendt endete auf dem Posten des Intendanten der Münchner Kammerspiele.
Es fällt nicht schwer, sich meinen Vater in diesem Kreis vorzustellen; ein guter Zuhörer unter Geltungsbedürftigen, ein Stiller unter Lauten; ein ernsthafter junger Mann unter Ausgelassenen; ein Realist ohne Absichten unter Phantasten mit Ambitionen. Und doch saugte er auf, was ihn hier an Neuem und anderem umgab, atmete ein, was ihn ein Leben lang prägen sollte. Er würde nie wie Adam Seide werden, er würde niemals so leben können: mit Schulden, abhängig von der Gunst anderer Menschen, von einem Moment in den nächsten. Aber er verinnerlichte ein Lebensgefühl, dessen Glück aus einem Nichts bestand; einem Nichts an Mehr. Er stellte sich vor, in einem einzigen Raum mit hohen weißen Wänden zu wohnen. Er würde in seinem Beruf Gegenstände gestalten, an denen nur das Wichtigste dran war, und er würde sich auch sonst nicht mit überflüssigen toten Gegenständen umgeben. Eine Kochgelegenheit, ein Bett, kaum Kleidung, nur das Nötigste; eine Flasche Wein, Nudeln mit Butter. Die einzige Ausnahme von der Regel würden Bücher sein: leben, essen, wohnen, arbeiten in einer kleinen Bibliothek.
Zwei Jahre zuvor war meine Mutter nach Hünfeld in die Nähe von Fulda gezogen. Eine Realschule wie in Buchholz gab es hier nicht, und für das Gymnasium fehlten meiner Mutter die Lateinkenntnisse. Das Einzige, was blieb, war die Handelsschule in Fulda. Die Aussichten auf ein langweiliges Leben waren günstig. Opa Herbert bemühte sich, meine Mutter nach ihrem Abschluss bei einer ortsansässigen Kosmetikfirma unterzubringen. Diese hatte an besser qualifiziertes Personal gedacht. Meine Mutter hörte den Satz »Der Mensch fängt erst beim Abitur an«. Auf den Schachteln mit Haarfärbemittel, die das Unternehmen deutschlandweit vertrieb, hatte dieser Spruch nicht gestanden. Die Lage war aussichtslos, aber nicht ungewöhnlich; es gab keine Arbeit. Dafür war das Au-pair-Wesen stark in Mode gekommen. Im Frühsommer 1954 durchquerte meine Mutter nach ihrer ersten langen Zugfahrt die Entlausungsschleuse in Basel. Abgesprüht mit Desinfektionsmitteln, die ihr Selbstbild als ein vermeintlich ungewaschenes Kriegskind nachhaltig prägten, fand sie sich als 15-jähriges Mädchen im Haus einer Zürcher Friseuse wieder. Mit Jeanette aus der Nachbarschaft ging sie im schwarzen Konfirmationsrock und weißen Blüschen in die Hinterzimmer der Gasthöfe, in denen flotte Jazz-Bands spielten. Ein anderes Tanzvergnügen fand in einem großen Fünf-Sterne-Hotel statt, in einer Glitzerwelt mit einer festlich gedeckten Terrasse. Die Musiker trugen Anzüge und traten in einer Musikmuschel auf. Sie fühlte sich wie im Film. Überall saßen feine Leute, Damen mit Ballkleidern und aufwändigen Hüten. Es gab Schlager und Tanzmusik, und meine Mutter ahnte nicht, welch große Rolle der schüchterne junge Schweizer, der sie hier zum Tanzen aufforderte, in ihrem Leben einmal spielen würde. John Spinner war Elektroniker und reparierte Radios. Eigentlich stammte er aus einer sehr wohlhabenden und illustren Familie, die, nomen est omen, glänzende Baumwollgeschäfte mit dem kolonialen Indien gemacht hatte.
Meine Mutter war nicht schlank, sie war mager, aber John Spinner fand sie wunderschön. Gemeinsam gingen sie ins Kino, John war nett und hatte eine sehr gewinnende Art, der Wildwestfilm blieb meiner Mutter kaum in Erinnerung. Die Zürcher Verlobung freilich fand nicht statt. Meine Mutter verlor ihre Stelle, und kurz darauf fuhr sie zurück nach Hünfeld. Eine eilig beschaffte Arbeit als »Anlernling« bei einem Rechtsanwalt endete schon nach einem halben Jahr. Meine Mutter fand eine neue Arbeit bei der Magdeburger Versicherung, deren Umzug von Fulda nach Hannover kurz bevorstand. Auch ihre Eltern zogen weg, nach Neustadt am Rübenberge, das war Hannover sehr nah. So oft Opa Herbert seine Stelle verloren hatte, so regelmäßig hatte er sich jedes Mal anschließend beruflich verbessert. Nun wurde er Leiter der Neustädter Baubehörde. In eine Großstadt wie Hannover hatte meine Mutter schon immer gewollt, sie bezog ihre erste eigene Wohnung, und sie hatte Ziele: Sie wollte ein Mensch werden und Abitur machen. Sie meldete sich auf dem Abendgymnasium an, und in ihren Träumen sah sie sich schon im Studium, Jura oder Medizin.
Mein Vater mochte sein Studium. Lieber aber noch beschäftigte er sich mit Literatur. Er las deutschsprachige Autoren wie den gerade wiederentdeckten Robert Musil und den fast unbekannten Arno Schmidt. Zugleich verschlang er das wenige, was es Mitte der fünfziger Jahre über den Nationalsozialismus zu lesen gab, und im Oktober 1958 kaufte er Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Ein junger Historiker von der FU hatte ihm das Buch beim Autostopp nach Berlin empfohlen. Es war das erste Mal, dass mein Vater die DDR besuchte, ein freundlicher Volkspolizist hatte ihn trotz seines abgelaufenen Personalausweises großzügig über die Grenze gelassen. Mein Vater staunte über die vielen Westberliner Studenten, die hier überall herumliefen, um billige Lebensmittel einzukaufen, und es wunderte ihn sehr, dass sich die DDR nicht dagegen schützte. Zugleich sah er, dass hier alles genauso kaputt und marode war wie im Westen der Stadt. Ganz Berlin erinnerte ihn sehr an die verfallenen Arrondissements in Paris. Zweimal reiste er per Autostopp nach Spanien, das dritte Mal 1959 fuhr er mit einem aus zweiter Hand erworbenen Kleinmotorrad. Die Reisen beeindruckten ihn tief. Einmal kam er bis nach Marokko, ein anderes Mal setzte er über nach Ibiza, eine kleine Schar Lebens- und sonstiger Künstler verbrachte hier ihren Sommer. Auf der zweiten Reise verlor er seinen Pass, landete wegen Landstreicherei im Polizeihauptquartier von Madrid an der Puerta de Sol und saß einige Tage in Untersuchungshaft. So fasziniert er von Spanien war, so wenig entgingen meinem Vater die Schattenseiten des Franco-Regimes. Ein Rundgang durch den Alcazar von Toledo – die zerschossenen Matratzen und herausgerissenen Telefonkabel lagen noch wie 1936 in den Ruinen – brachte ihn dazu, sich mit dem Spanischen Bürgerkrieg zu beschäftigen. Er las die Memoiren der Spanienkämpfer, Ein spanisches Testament von Arthur Koestler, die Hommage to Catalonia von George Orwell und Hammer oder Amboss sein von Arturo Barea. Seine letzte Reise dauerte den halben Sommer. Nach mehr als zwei Monaten kehrte er zurück ins verregnete Deutschland. Einmal rutschte das Motorrad auf der nassen Fahrbahn weg, es blieben ein paar Schürfwunden und Schrammen. Ende September 1959 war mein Vater wieder in Hannover.
Eine zerschlissene französische Militärjacke; ausgelatschte Strohschuhe im September; die Haut tief braun gebrannt.
Meine Mutter kam seit knapp zwei Wochen regelmäßig in die Galerie, ein neuer Bekannter hatte sie hierhin mitgenommen. In dieser kurzen Zeit hatte sie mehr auffällige Menschen getroffen als je zuvor. Die Abende hatten sich zu einer Aufeinanderfolge von immer neuen Gesichtern vermischt, von ungewöhnlichen Ansichten und kühnen Behauptungen, von fremden Blicken, von seltsamen Bildern und klirrenden Rotweingläsern und immer neuen Herausforderungen an ihre Steno- und Tippfertigkeiten. Mal wurden Matrizen für Kataloge geschrieben, mal Einladungen, mal Briefumschläge beschriftet zum Versand einer hauseigenen Literaturzeitschrift mit Künstlergrafiken. Sie fühlte sich so wach und ruhelos wie selten in ihrem Leben. Sie hatte viele interessante Männer kennen gelernt, Künstler, Dichter und Kritiker, doch von all diesen war der Mann mit den hellblauen Augen in dem braun gebrannten Gesicht, den Strohschuhen und der Militärjacke zweifellos der schönste.
Er saß mit einem Buch in der Hand auf dem Galeriesofa und las. Irgendwann bemerkte auch er, dass sie ihn bemerkt hatte, eine blonde schlanke Frau, gerade 21 Jahre alt und neu in der Galerie. Meinem Vater gefiel ihr neugieriger aufgeschlossener Ausdruck. Er hatte einige besondere Frauen kennen gelernt, an der Werkkunstschule und auch in Adam Seides Galerie, aber eine solch wache Aufmerksamkeit hatte er noch nicht erlebt. Die Kenntnisse, die sich meine Mutter in ihrem jungen Leben angeeignet hatte, waren überschaubar, gewiss hatte sie im Vergleich zu meinem Vater wenig gelesen, und doch hatte alles, was sie sich im Leben oder aus Büchern angeeignet hatte, etwas durch sie und ihre Eigenart Selbstbestimmtes. Sie verlieh allen Dingen einen Wert, und selbst ihre vorsichtigsten Urteile teilten die Welt auf eine sehr originelle und oft humorvolle Art in Wichtiges und Unwichtiges, Richtiges und Falsches.
Weihnachten 1959 verlobten sich meine Eltern in der Atelierwohnung des Bühnenbildners Karl-Heinz Hofmann, einem Studienfreund meines Vaters. Die halbe Galerie Seide war da, die Künstlerfreunde sorgten für einen ausgelassenen Abend. Mein Vater beendete sein Studium, eine Abschlussprüfung oder einen Titel für seinen Beruf gab es nicht. Ein Jahr später wurde geheiratet. Die Hochzeit war Chefsache, das ließ sich Opa Herbert nicht nehmen. Mein Vater und er hatten sich inzwischen mehrfach artig die Hand gegeben. In Wahrheit freilich hatten sie sich so wenig zu sagen wie ein Falke und ein Pinguin, die versehentlich auf einer gemeinsamen Zooanlage vergesellschaftet wurden.
Die Hochzeit war feucht und fröhlich für den, der in Opa Herberts Fahrwasser schwamm: Neustädter Honoratioren, Leute vom Bau, Saufkumpane. Oma Hanna hatte das aufwändige Hochzeitskleid genäht, danach ab zum Fotografentermin – das Hochzeitsfoto: das Brautpaar in Pose, Rudolf Prack und Sonja Ziemann, nur echt. Meine Mutter hat sichtlich Gefallen, Pose und Filmlächeln sitzen wie hundertmal geübt. Daneben mein Vater im schwarzen Wormland-Anzug ernst und steif; ein Gesicht im Anzug, der aussieht, als hätte er auch ohne meinen Vater so dagestanden.
Mein Vater hatte sich nie vorgestellt, etwas zu werden, nun musste er etwas sein. Opa Herbert hatte Ideen und Visionen, er unternahm einen Versuch, meinen Vater auf sein Terrain zu ziehen, und drängte auf ein zusätzliches Studium der Baustatik; »Formgestalter« hielt er kaum für einen Beruf. Mein Vater schwieg; der okkulte Charme der Bourgeoisie beim Vermehren von Geld berührte ihn nicht. Gleichwohl fand er schnell Arbeit. Die Firma Telefunken war ein konservatives Unternehmen mit einem großen Markt. Es sollte nicht schaden, durch einen Mann mit jungen Ideen sich nun auch das zeitgemäße und modische Segment zu erschließen. Es gibt großformatige Fotos jener Radios, die mein Vater entwarf: weiße Tonkörper in strengem Design mit einigen kleineren Konzessionen an den Allerweltsgeschmack. Sie gingen nie in Serie. Von seinen Chefs hörte er, dass Radios keine technischen Geräte wären, sondern Tonmöbel und gefälligst auch wie Möbel auszusehen hätten: Nussbaum hochglanzpoliert, Gardinen-Brokat-Bespannung und Goldleisten. Mein Vater war eingestellt worden, um etwas Neues zu machen. Jetzt lernte er, das Alte beizubehalten und alles zu vergessen, was seine Vorstellungen von gutem Design ausmachte.
Er wurde sehr unsicher: Gab es überhaupt einen passenden Platz in der Welt für jenes »ehrliche« Design, dieses kleine Stück besserer Welt? Einmal baute er einen Musikschrank für ein Mitglied des Telefunken-Aufsichtsrats, Otto Ambros. Er fuhr zu der Villa des Wirtschaftsführers, und dieses Mal hatte er Erfolg. Der Musikschrank fand das Lob und die Anerkennung des Auftraggebers, die Stimmung war bestens, Ambros öffnete eine Flasche guten Wein. Sie tranken und lachten, und die sympathische liebenswürdige Art seines hohen Chefs machte auf meinen Vater tiefen Eindruck.
Tatsächlich hatte mein Vater von dem Mann ihm gegenüber kaum eine Vorstellung. Otto Ambros blickte zurück auf eine erstaunliche Karriere. Im Dritten Reich war er Vorstandsmitglied der IG-Farben, Geschäftsführer des Werkes Buna IV in Auschwitz und verantwortlich für die Ermordung ungezählter KZ-Häftlinge, die hier den »Tod durch Arbeit« fanden. Nach dem Krieg zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt, wurde er im Jahr 1952 vorzeitig entlassen. Rasant stieg der ehemalige »Wehrwirtschaftsführer« zum persönlichen Berater von Friedrich Flick auf und wurde Aufsichtsrat bei Chemie Grünenthal, Pintsch Bamag, Feldmühle, Knoll und Telefunken.
Die feste Arbeitsstelle hatte meinen Eltern eine schöne Altbauwohnung in der Innenstadt von Hannover ermöglicht. Ein paar erste Möbel bildeten die spärliche Einrichtung. Nicht lange nach dem Auszug meiner Mutter nahm sich Oma Hanna das Leben; sie war 47 Jahre alt. Ich sollte sie nicht kennen lernen, sie bleibt mir ein Gesicht auf Fotografien und eine Sammlung widersprüchlicher Erzählungen.
Im Mai 1962 wurde meinem Vater bei Telefunken gekündigt. Das erste Arbeitsverhältnis endete klanglos nach anderthalb Jahren unfruchtbarer Zusammenarbeit. Er arbeitete jetzt in Düsseldorf und entwarf ein stapelbares Set an Kisten und Wasserspiele für eine Bundesgartenschau. Für meine Eltern bedeutete die neue Anstellung eine Wochenendbeziehung, denn für einen Umzug nach Düsseldorf war sie nicht sicher genug. Im Sommer 1963 schließlich fand mein Vater bessere Arbeit bei einem mittelständischen Unternehmen in Solingen. Ein Studienfreund aus Hannover, der eigentlich Autodesigner hatte werden wollen, hatte ihn empfohlen, und nun hockten »die beiden Picassos« in einer Baubaracke in Solingen-Wald und entwarfen Haushaltsgeräte.
Die neue Stadt bot überhaupt nichts. Hannover mochte gewiss nicht der Nabel der Welt gewesen sein, aber hier gab es immerhin Seides Galerie; Solingen dagegen war traurige Provinz; ein viel zu großes Theater ohne eigenes Ensemble, ein Stadtorchester, drei oder vier Kinos, keine Galerien und keine literarischen Zirkel oder sonst etwas Vergleichbares. Der »Verein Solinger Künstler«, dem mein Vater später beitrat, manifestierte das Fiasko.
Der Solinger an sich, seiner Zugehörigkeit nach eher Westfale denn Rheinländer, gilt zu Recht als nicht besonders kontaktfreudig. Das Wetter ist überdurchschnittlich feucht, die sanften Hügel des Bergischen Landes lassen die Wolken über Solingen abregnen, und wo man hinspuckt, wächst Moos. Von der ehemals pittoresken Stadt der schmucken Fachwerkhäuschen mit grünen Fensterläden sind nur ein paar verstreute Hofschaften und Kotten geblieben, und die Innenstadt ist so austauschbar wie jede andere neue Innenstadt aus den fünfziger und sechziger Jahren: Fußgängerzone, Neonpassage, Schuhgeschäfte, erst Asphalt, später Verbundpflaster und Blumenkübel aus Waschbeton, garniert mit dekorativen Skulpturen heimischer Künstler.
Immerhin, die Altbauwohnung in der Klemens-Horn-Straße, die die Firma vermittelt hatte, war groß und hell. Meine Mutter brauchte nur wenige Dinge, um die Zimmer wohnlich wirken zu lassen, einen geerbten Gründerzeitschrank ihrer Großmutter und zwei passende Sessel. Eine Liege aus ihrer ersten Wohnung diente als Sofa. Das Einzige, worauf meine Mutter bestand, war ein ordentlich eingerichtetes Schlafzimmer. Mein Vater zögerte eine Weile, bis er sich davon überzeugen ließ. Sie erstanden eine siebenteilige Ausstattung aus schlichten eckigen Möbeln in hellem Holz. In einem nächsten Schritt überredete meine Mutter meinen Vater dazu, dass man Lampen brauchte und nicht nur Glühbirnen an der Decke.
Nach einem halben Jahr in Solingen lebten meine Eltern in einer Welt, die sich mein Vater freiwillig so nie gewählt hätte. Sie hatten sich eine Wohnung eingerichtet, und mein Vater verließ morgens das Haus, um mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. Meine Mutter besorgte den Haushalt. Abgesehen von dem Studienkameraden meines Vaters und dessen Frau hatten sie keine Freunde und waren nun völlig auf sich gestellt.
Ein Streit um etwas ganz anderes beendete eines Tages die Diskussion um die Anzahl ihrer zukünftigen Kinder. Auf dem Höhepunkt des Gefechts fragte mein Vater meine Mutter erneut, wie viele Kinder sie eigentlich mit ihm haben wollte. Fünf? Meine Mutter nickte, und mein Vater bestätigte: »Na gut, ich auch.« Kurz nach Weihnachten wurde ihre Tochter Johanna Maria geboren. Sie konnten kaum glauben, wie erwachsen sie geworden waren.
Ein Jahr später folgte ich. Meine Mutter sagt, dass sie sich an mich in den ersten beiden Lebensjahren wenig erinnert. Ein Säugling, der sehr viel schlief und eigentlich nur zum Essen aufwachte; ein Kind, von dem man kaum bemerkte, dass es überhaupt da war. Anstelle von Zusammenhängen stehen Fotos: nachträglich gefühlte Erinnerungen in Schwarzweiß, durchlöcherte Matrizen: meine Mutter mit burschikosem Rundschnitt, jungenhaft im geringelten Rollkragenpullover, mein Vater im weißen Hemd, er geht im Anzug in die Firma und trägt ihn auch zu Hause; Urlaub an der deutschen Ostseeküste in Kronsgaard mit den Großeltern. Hanna und Richard streicheln Kühe und Schafe auf dem Bauernhof; Hanna mit Katze; Richard fürchtet sich vor dem dunklen Wald. Dann ein ganzer Film – acht Bilder: die perfekte Sechziger-Jahre-Familienidylle an der Ostsee. Strandkörbe, modische Badeanzüge, meine Mutter, drapiert wie ein Model, die Kinder, hübsch, blond, im Frotteehemd, zermatschen Quallen. Alles ist gut.
Dann die ersten farbigen Bilder 1966/67 – auch sie kaum als Erinnerungen beschreibbar. Artige Kleinkinder in schönen bunten Farben auf einem tristen Hinterhof, der aussieht, als wäre der Krieg gerade eben erst vorbei.
Meine Eltern hatten sich in der Klemens-Horn-Straße eingelebt und über Hanna und mich einen kleinen Bekanntenkreis aufgebaut. Die Familie unter uns hieß Christians und hatte drei Kinder. Sabine ist die Älteste, Eva ein Jahr älter als Hanna und Holger etwas älter als ich. Die Mütter begegneten sich tagtäglich im Treppenhaus oder auf dem Hof und lernten sich auf diese Weise kennen. Die Väter bauten einen Sandkasten und säten Rasen auf dem Hof. Vor dem Kellereingang legten sie einen Weg aus Bruchsteinplatten an, und an den Häuserwänden entstanden abgesteckte Beete. Zu Weihnachten 1967/68 glich Hanna unter dem Tannenbaum das alte Liedgut mit ihrer Erfahrungswelt ab: »Alle Jahre wieder kommt ein Christians-Kind«.
Die meisten Familien in den Häusern kamen aus Solingen oder aus der Umgebung. Und meine Eltern waren wohl die einzigen mit akademischen Interessen. Die spärliche Einrichtung ihrer Wohnung, vor allem aber die große Bücherwand sprach Bände. Mein Vater kaufte auch weiterhin Bücher, über die er sich nur noch mit meiner Mutter unterhalten konnte und mit sonst niemandem mehr, und beschäftigte sich von nun an immer mehr mit Politik. In Adam Seides Galerie hatte es viele Gewerkschafter gegeben, die dem linken Flügel der SPD nahe standen, andere sahen sich als Anarchisten, jeder von ihnen ein eigenes parteiloses Politbüro. In einem von Seides Freunden lernte mein Vater auch den ersten engagierten Kommunisten kennen, ein Parteimitglied der damals gerade verbotenen KPD.
Nun, wo er in seinen politischen Gedanken weitgehend auf sich selbst gestellt war, griff mein Vater die Anregungen auf, die er in Hannover erhalten hatte. Er presste seine Erinnerungen aus wie einen Schwamm, und unter reger Lektüre bildete sich zum ersten Mal in seinem Leben so etwas heraus wie ein Weltbild. Wie viele, denen der Adenauer-Staat nicht geheuer war, war mein Vater gegen die Wiederbewaffnung und den Aufbau der Bundeswehr. Dass Verteidigungsminister Franz Josef Strauß von Deutschland als einer Atommacht geträumt hatte, verriet nichts Gutes. Unter solchen Vorzeichen hatte die Integration der Bundesrepublik in den Westen von Anfang an etwas sehr Aggressives, etwas, das das verlautbarte Schutzbedürfnis gefährlich überlagerte. Immerhin hatte bislang nur ein einziges Land tatsächlich Atombomben abgeworfen, und zwar nicht die verteufelten Sowjets, sondern die USA. Das grausamste Morden nach dem Holocaust war in seinen Augen von den vermeintlich Guten getan worden. Vertrauen erweckend war das nicht.
*
»Vietnam ist der Eckpfeiler der Freien Welt in Südostasien, der Schlussstein im Bogen, der Stopfen im Deich. Es ist unser Kind, wir dürfen es nicht verlassen, und wir können seine Bedürfnisse nicht ignorieren.« Im Jahr 1956 hatte der junge Senator John F. Kennedy in poetische Worte gefasst, was die Machtelite in Washington prosaisch dachte.
Die entscheidende Rolle Kennedys bei der Eskalation dieses Albtraums ist auch unter Konservativen nicht umstritten. Gerade im Amt, schickte der Präsident der New Frontier die ersten Bodentruppen nach Vietnam; er hatte etwas gutzumachen: die gescheiterte Invasion Kubas in der Schweinebucht. 1963, in Kennedys Todesjahr, waren 18 000 amerikanische Soldaten in dem südostasiatischen Land.
Begonnen hatte der Krieg in Vietnam als ein Befreiungskampf gegen die französische Kolonialmacht. Das Ergebnis war eine provisorische Teilung des Landes im Jahr 1954 in einen kommunistischen Norden unter der Führung Ho Chi Minhs und seiner Vietminh und in einen antikommunistischen Süden unter dem katholischen Sektenführer Ngo Dinh Diem, einem Strohmann amerikanischer Interessen. Die anstehenden Wahlen mit dem Ziel der Wiedervereinigung, die unweigerlich den Sieg der Kommunisten in ganz Vietnam zur Folge gehabt hätten, wurden von den USA vereitelt. Doch der Versuch, ein stabiles amerikatreues Regime in Südvietnam aufzubauen, scheiterte. Von Anfang an tobte im Süden ein Bürgerkrieg zwischen Großgrundbesitzern und verarmten Kleinbauern, ein Krieg um Landbesitz. Die »Volksbefreiungsarmee«, von ihren Gegnern »Vietcong« – vietnamesische Kommunisten – genannt, bekämpfte das von den Vereinigten Staaten gestützte Diem-Regime. Der von den USA geforderte Sieg gegen den Vietcong wurde zum Präzedenzfall der amerikanischen Phantasmagorie als einer universellen militärischen Schutzmacht der »freien Welt«.
In der Zeit redete Theo Sommer im zweiten offiziellen Kriegsjahr 1965 getreu der deutschen Regierungspolitik und der allseits veröffentlichten Mehrheitsmeinung das Morden in Vietnam schön. Für ihn war es »Der notwendige Krieg«: Als Staat zwischen zwei Ozeanen hätten die USA ihre Freiheit in Europa verteidigt und müssten es nun ebenso in Asien tun, wo der chinesische Kommunismus sich gefährlich ausbreite: »Bei aller Kritik an seinen Modalitäten halte ich dieses Engagement im Grundsatz für richtig und unvermeidlich.«
Das »Engagement« bedeutete bereits 1965 die systematische Zerstörung von weiten Teilen des Landes. US-amerikanische Flugzeuge hatten im ersten Kriegsjahr 63 000 Tonnen Bomben auf Nordvietnam geworfen – die zwanzigfache Menge des britischen Luftangriffs auf Dresden 1945. Die »Modalitäten« waren schon 1965 der Einsatz von Dioxin und Napalm. Die amerikanische Reporterin Martha Gellhorn besuchte 1966 von Napalm verletzte Kinder in einem Krankenhaus in Südvietnam: »Bevor ich nach Saigon ging, hatte ich gehört und gelesen, dass Napalm das Fleisch schmilzt, und ich dachte, das sei Unsinn, weil ich einen Braten in den Backofen schieben kann und das Fett wird schmelzen, aber das Fleisch bleibt. Nun, ich kam dahin und sah diese Kinder mit Napalmverbrennungen, und es war absolut wahr: Die chemische Reaktion des Napalms lässt das Fleisch schmelzen, und das Fleisch schmilzt ihre Gesichter hinunter auf ihren Brustkorb und hängt dort und wächst dort … Diese Kinder können ihre Köpfe nicht wenden, weil sie so dickfleischig sind … Und wenn der Brand einsetzt, schneiden sie ihre Hände oder Finger oder ihre Füße ab; das Einzige, das sie nicht abschneiden können, ist ihr Kopf.«
Das folgenschwerste aller im Vietnamkrieg eingesetzten Gifte aber war das dioxinhaltige Entlaubungsmittel agent orange. Der Kontakt mit Dioxin verursacht schwere Hauterkrankungen, die Chlorakne, sowie Entzündungen im Nervensystem, wie Gefühllosigkeit, Erblindung, das Zittern von Händen und Füßen, und langfristig auch Krebs. In der Folge des Dioxineinsatzes in Vietnam kommt es zu einer horrenden Zahl an Fehlgeburten und missgebildeten Kindern.
Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete 1997 von über 3 Millionen Menschen, die nach amtlichen vietnamesischen Zahlen unmittelbar durch agent orange