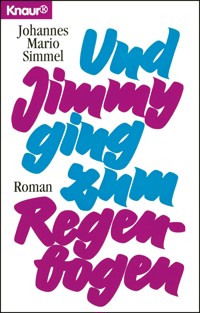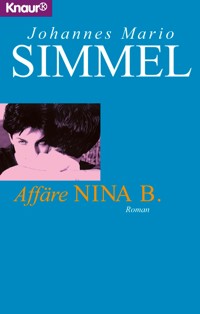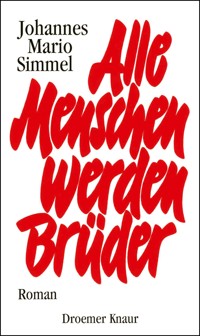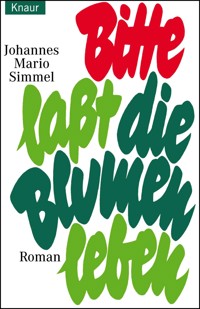4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Die erregend abenteuerliche Geschichte eines Mannes mit dunkler Vergangenheit, hineingestoßen in die infernalische Weit des Geheimdienstes von Ost und West; ein buntes Panorama Berlins im Jahre 1964, diesseits und jenseits der Mauer; eine Darstellung der Minner, die Fluchttunnels von Ost nach West planten, finanzierten und bauten - all das bringt dieser Roman mit seinem vielschichtigen, dramatischen Geschehen. Johannes Mario Simmel hat dieses Buch geschrieben, um uns wachzurütteln, um uns zu zeigen, daß die Schaffung universeller Menschlichkeit das höchste Ziel ist, dem alles Planen und Wirken dienen sollte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1026
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Lieb Vaterland magst ruhig sein
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Dem Arzt und Freund
Dr. Kornelius Kryspin-Exner
zugeeignet
Nun wachet! Uns geht auf der Tag,
an dem wohl Angst ergreifen mag
jeglichen Christen, Juden oder Heiden.
Wir haben der Zeichen viel gesehen,
dran wir sein Kommen wohl erspähen,
wie uns die Schrift mit Wahrheit läßt bescheiden.
Die Sonne hat ihren Schein verkehret,
Untreue ihren Samen ausgeleeret
allenthalben auf den Wegen:
Der Vater bei dem Kind Untreue findet,
der Bruder seinen Bruder belüget,
geistlich Leben in Kutten trüget,
das uns führen sollte zu Himmelssegen:
Gewalt geht auf, Recht vor Gerichte schwindet.
Wohlauf! Hier ist zu viel gelegen.
Walther von der Vogelweide
Um 1200
Prolog
Die Helfer
1
Die Frau ist zu dick. Sie kommt nicht durch das Einsteigloch des Tunnels, so sehr sie sich auch bemüht. Bei den einunddreißig Leuten vor ihr ging alles glatt. Nun stockt der Transport. Das ganze Unternehmen ist durch die Dicke gefährdet. Sie weiß es. Darum beginnt sie zu weinen. Lautlos. Wenn sie laut weinte, wäre überhaupt gleich alles aus – nicht nur für sie, sondern auch für die neununddreißig Männer, Frauen und Kinder, die im Hinterhof des Hauses Mottlstraße 35 stehen und warten, ratlos, angstvoll, wütend. Diese dicke 011e, die hat uns gerade noch gefehlt!
Der dicken Ollen rinnen Tränen der Verzweiflung über das breite, fleischige Gesicht, das vor Aufregung, Anstrengung und Schmerz violett angelaufen ist. Ja, auch vor Schmerz! Denn die im Tunnel unten zerren an ihren Füßen, und die im Hof stemmen sich auf ihre Schultern. Vergeblich. Da steckt die Arme, halb drin, halb draußen. Es ist 23 Uhr 17 am Donnerstag, dem 13. August 1964. Eine warme Nacht, eine schöne Nacht mit klarem Himmel, vielen Sternen und einem leuchtenden, honigfarbenen Mond.
»Mutti, schau doch! Schon wieder!« flüstert ein kleines Mädchen mit riesigen Augen in dem schmalen Gesicht. Das kleine Mädchen, das einen Teddybären an sich gepreßt hält, hebt die freie Hand nach oben. Eine Sternschnuppe fällt. August und September sind die Sternschnuppenmonate. Man darf sich etwas wünschen, wenn man eine sieht, aber man darf nicht sagen, was man sich wünscht, sonst geht es nicht in Erfüllung. Das kleine Mädchen, seine Mutter und alle anderen im Hof, auch die Unglückliche im Loch, sehen die Schnuppe, die aus den Höhen des unendlichen Firmaments stürzt, und sie alle wünschen sich etwas, keiner sagt, was, alle wünschen sich das gleiche: Die Dicke soll durch das Loch kommen, endlich!
Am innigsten wünscht sich das die Dicke. Aber umsonst, umsonst. Die Schnuppe ist verschwunden, verglüht, und die Dicke flüstert: »Also, ich kann nicht in den Westen, weil ich zu fett bin?«
Und die Kinder, die Frauen, die Männer um sie herum blicken sie an und sagen kein einziges Wort. Da weiß die Dicke, daß es Christenpflicht ist, wieder aus dem Loch zu kriechen, damit wenigstens die anderen in den Westen flüchten können. Sie versucht sich hochzustemmen. Ein paar Männer helfen ihr dabei, von unten wird sie gestoßen, bis alle entsetzt merken: Das geht ja auch nicht! Kleid und Hüfthalter der Frau zerreißen. Durch das Stoßen von oben und das Ziehen von unten und nun wieder das Stoßen von unten und das Ziehen von oben hat sich das breite Becken der Dicken verklemmt. Sie keucht. Auf ihrer Stirn steht der Schweiß in dicken Tropfen. Sie stöhnt, sehr vorsichtig. Und sehr vorsichtig stöhnen die Neununddreißig mit ihr. Da haben wir die Katastrophe! Das unselige Geschöpf kann aus dem Loch nicht einmal wieder heraus. Fängt eine bleiche Frau laut zu beten an: »Lieber Vater im Himmel, hilf uns, mach …«
»Schnauze!« zischt ein alter Mann.
Schweigt die bleiche Frau sofort und hält sich erschrocken eine Hand vor den Mund.
Im Hausflur stehen ein junger Arbeiter und ein Student an dem versperrten Tor. Das sind die Wachen. Wenn draußen auf der Mottlstraße einer kommt und gegen das harte Holz klopft, lang, lang, lang, kurz, lang, kurz, und wenn er »Zarah Leander!« sagt, dann öffnen die Wachen das Eingangstor mit einem Dietrich, denn dann sind sie sicher, daß das auch einer ist, der flüchten will. So sicher sind sie, wie man in derartigen Situationen eben sicher ist. Die Wachen haben Pistolen. Volkspolizei kann von dem Klopfzeichen wissen und von dem Kennwort auch.
Bisher ging alles gut. Wenn es schiefgehen sollte, kommt es darauf an, wer schneller schießt und ob man das Tor wieder zubekommt, bevor Vopos in den Hof stürmen. Oder Männer vom Staatssicherheitsdienst. Man hat alles ganz genau überlegt und geplant.
Alles?
Eben nicht! Mit einer so dicken Frau, zum Beispiel, hat niemand gerechnet. Sonst hätte man das Einsteigloch größer gemacht. Dazu ist es nun zu spät. In der todstillen Nacht kann hier keiner mit Spitzhacke und Spaten zu arbeiten beginnen.
»Scheiße«, sagt der Student der Philosophie Horst Lutter. »Dafür haben wir nun sechs Monate geschuftet!«
Es waren sogar sechseinhalb Monate.
Am 28. Januar haben sie mit der Arbeit begonnen, drüben in der Hasenauerstraße 67, im Keller der stillgelegten Dampfwäscherei Friedrich Czibilsky. Drüben: 140 Meter entfernt von dem Loch, in dem nun die Dicke steckt. Drüben: Im Französischen Sektor von Berlin. Der Hof hier, der gehört schon zum Demokratischen Sektor. Zum Russischen Sektor. Zum Sowjetsektor. Zum Hoheitsgebiet der DDR. Zum – es gibt eine Menge Namen für das Gebiet, auf dem dieser Hof liegt. Man kann kurz sagen: Er liegt im Osten. Die Hasenauerstraße liegt, kurz gesagt, im Westen. Zwischen dem Loch im Hof und dem Keller der aufgelassenen Dampfwäscherei verläuft eine Grenze.
Die Welt kennt diese Grenze unter der Bezeichnung ›Die Mauer‹. Heute hat die Mauer ihren dritten Geburtstag. Darum wurde der 13. August 1964 als Fluchttag gewählt: Weil da die Volkspolizei und die Volksarmee und der SSD alle Hände voll zu tun haben am Brandenburger Tor und in der Bernauer Straße und am Checkpoint Charley und am Kontrollpunkt Chausseestraße, überall. Es demonstrieren nämlich ein paar hunderttausend Westberliner. Sie schmeißen Steine gegen die Mauer und schwingen Transparente und tragen Fackeln und brüllen in Sprechchören.
Westberliner Polizei muß verhindern, daß die Menge irgendwo versucht, die Mauer zu stürmen. Denn das könnte unabsehbare Folgen haben. Deshalb treiben Westberliner Polizisten die Westberliner Demonstranten immer wieder zurück, und Männer vom Westberliner Senat stehen auf Kombiwagen und halten beschwörende Ansprachen durch Megaphone.
»Bewahrt Ruhe! Bewahrt Besonnenheit, Freunde!«
»Ihr schadet doch nur euern Brüdern drüben!«
»Ihr gefährdet den Frieden!«
Und aus den Lautsprechern der Polizeiwagen tönt es: »Zurückgehen, bitte!«
Wasserwerfer schwenken drohend ihre Rohre, wo die Menge nicht zurückgeht.
Und amerikanische und französische und englische Panzer und Schützenpanzerwagen und Jeeps und schwerbewaffnete Soldaten stehen vor der langen Mauer, als wollten sie sie beschützen.
Auf den Wachtturmplattformen hinter dem Bauwerk stehen Volkspolizisten neben Scheinwerfern, deren gleißende Lichtbahnen über das Durcheinander jenseits der Grenze streichen. Neben den Vopos stehen Zivilisten. Alle schauen hinüber in den Westen. Keiner schaut den anderen an.
Und auch im Osten sind Panzer und Jeeps aufgefahren, und Soldaten, deutsche und sowjetische, riegeln einen breiten Streifen hinter der Mauer hermetisch ab. Auch kein Ostberliner darf heran.
Ein richtiges internationales Rendezvous gibt man sich heute. So etwas ist selten! Wo immer es geht, bleiben sonst die Angehörigen der Besatzungsmächte unsichtbar und überlassen den Deutschen aus dem einen Deutschland und den Deutschen aus dem andern Deutschland die Verantwortung für Ruhe und Ordnung längs der Mauer. An diesem 13. August 1964 ist das unmöglich. Wäre viel zu riskant! Vor drei Tagen bereits haben in Westberlin Protestkundgebungen und Krawalle begonnen. Auch in Ostberlin sind die Menschen unruhig. Verdammte Berliner! Ost und West haben sich übel hineingeritten in diesen Schlamassel um die ehemalige Reichshauptstadt. Nicht die einen die anderen. Jeder sich selber. Mit Garantien und Faustpfand im Kalten Krieg und so weiter. Keiner von den Mächtigen unserer Welt in Ost und West darf nachgeben. Damit sie ihr Gesicht wahren können, brauchen sie die Kleinen, Namenlosen, die keiner gefragt hat, die keiner kennt, jene, die jetzt also diese Mauer bewachen.
Der Mensch kann denken. Das unterscheidet ihn vom Vieh.
Unteroffizier Wassili Gorokin denkt: 5. August 1941. Unser Dorf hinter Gomel. Vater, Mutter, Tante Ljuba, Onkel Pjotr, meine Schwester Jelisaweta – sie haben auf dem Feld gearbeitet an diesem Tag. Schöner Tag. Blauer Himmel. Sonnenschein. Heiß. Mich haben sie unter einen Baum gelegt, in den Schatten. Ich war drei Jahre alt. Dann ist dieses Sausen gekommen, lauter und lauter, furchtbar laut. Deutsche Flieger. Sie haben Vater und Mutter erschossen, Tante Ljuba, Onkel Pjotr, meine Schwester Jelisaweta. Das Heu und unser kleines Haus haben sie in Brand geschossen. Ich blieb unverletzt. Kam in ein Waisenhaus. Kam in ein Staatsinternat. Kam zur Roten Armee. Jetzt stehe ich in Berlin und passe auf, daß die einen Deutschen den anderen Deutschen nichts tun. Es wächst wieder Korn auf unserem Feld. Das Haus ist aufgebaut. Ich habe eine Frau. Mein Sohn Mischa ist drei Jahre alt. Ich habe Angst, daß alles noch einmal geschieht.
Volksarmist Günther Polzin, neben ihm, denkt: Tobt nur, ihr Faschistenschweine da drüben, ja, tobt nur! Endlich haben wir uns geschützt vor euch durch die Mauer. Habt ihr vielleicht geglaubt, wir sehen ewig zu, wie ihr Agenten und Saboteure rüberschickt, die das Volk aufhetzen, Kartoffelkäfer einschleppen und in den Betrieben spionieren? Habt ihr geglaubt, wir warten, bis uns die letzten Ärzte, Lehrer und Anwälte weglaufen, dieses feige Intellektuellengesindel, das sein Volk auf Anhieb im Stich läßt, zu allen Zeiten, unter allen Regimen?
Jetzt werden sie schön die Schnauze halten, sie und die Ewig-Gestrigen. Dazu gehören auch meine Alten. Denen habe ich aber Zunder gegeben! Wenn ich sie noch einmal dabei erwische, daß sie RIAS hören, zeige ich sie an. Was denn? Ich habe schon viele angezeigt. Das ist meine Pflicht!
Auf der anderen Seite der Mauer, der amerikanische Soldat Jack Ebony Clark, der denkt: Im Juni 1963 war unser Präsident Kennedy in Berlin. Da hatte ich auch Dienst. Vor dem Schöneberger Rathaus rief der Präsident damals: »Ich bin ein Berliner!« Er wollte den armen Menschen hier Mut machen und ihnen die Furcht nehmen. Im November 1963 wurde Kennedy ermordet. Ich möchte auch ›ein Berliner‹ sein, so einer wie John Fitzgerald Kennedy. Vielleicht setzt sich die Anständigkeit und die Ehrlichkeit und die Freundlichkeit doch noch durch in der Welt, wenn wir uns sehr bemühen. Dann werden meine Kinder mit allen anderen Kindern zur Schule gehen dürfen, bei mir daheim in Birmingham, Alabama. In ein und dieselbe Schule. Obwohl sie schwarz sind.
Der französische Caporal Louis Tilmant denkt: 1871 ist mein Urgroßvater gefallen im Krieg gegen die Deutschen. Ein netter Kerl, erzählte man mir, ich habe ihn natürlich nie gesehen. 1916 ist mein Großvater gefallen im Krieg gegen die Deutschen. Soll auch ein netter Kerl gewesen sein. Habe ihn auch nie gesehen. 1940 ist mein Vater gefallen im Krieg gegen die Deutschen. Den habe ich gesehen. Fünf Jahre war ich alt, als er fortging. Soll ein besonders netter Kerl gewesen sein, höre ich. Heute sind Frankreich und Deutschland Freunde. Aber doch nur das halbe Deutschland! Wenn die Mauer einmal verschwindet, und die ganze Zonengrenze, und das andere halbe Deutschland kommt dazu – was wird dann sein? Es ist bisher immer das ganze Deutschland gewesen, mit dem wir Krieg geführt haben. Darum bin ich so gegen die Wiedervereinigung. Die Menschen hier und drüben können einem leid tun, sicherlich. Aber ich bin noch so jung, und ich bin auch ein netter Kerl, sagen die Mädchen. Ich möchte noch eine Weile leben. Wiedervereinigung? Viel zu gefährlich! Die Mauer muß bleiben!
Volkspolizist Herbert Wagner, auf einem Wachtturm, denkt: Ach, hört doch auf zu schreien, ihr da drüben! Glaubt ihr, unsere Leute haben die Mauer freiwillig gebaut? Mit Gewehren mußten wir die Arbeiter bewachen. Und uns bewachten Kerle vom SSD, solche wie der da neben mir! Der hat mich übrigens auf dem Kieker. Er behauptet, ich hätte schon zweimal in die Luft geschossen, als welche von uns geflüchtet sind. Stimmt auch. Aber wie oft werde ich noch in die Luft schießen können? Tut doch nicht so erhaben da drüben! Euch haben die Amis hochgepäppelt! Uns keiner. Haben wir den Krieg ganz alleine verloren?
SSD-Mann Karl Zschinschke, der neben ihm steht, denkt: Noch hat das Gesocks hier Angst, noch kuscht es. Aber was, wenn Chruschtschow Ulbricht fallenläßt und der gestürzt wird? Oder wenn Chruschtschow selber gestürzt wird? Man hat schon Pferde kotzen sehen. Wird dieser Hund, der Wagner, in die Luft schießen, wenn ich türme?
Drüben, der englische Sergeant Tommy Payne, der denkt: Coventry. Ich bin in Coventry geboren. In Coventry. In Coventry. Verflucht, kann ich nichts anderes denken? Nein, kann ich nicht.
Solches denkt Polizeimeister Josef Schulz von der Westberliner Bereitschaftspolizei: Hier ging es schon mittags los. Aber ich hatte frei bis 17 Uhr. Vorher habe ich noch meinen Bruder in Frankfurt angerufen. Da hat der einen netten kleinen Laden. Sagt mein Bruder: »Unsere ganze Stadt hält den Atem an!« – »Nu, nu«, sage ich, »habt doch nicht immer gleich die Hosen voll. Das bißchen Rummel! Passiert schon nichts!« – »Wovon redest du eigentlich?« fragt er. – »Wovon redest du?« frage ich. – »Na, Mensch«, sagt er, »Josef«, sagt er, »ich sitze doch am Radio und höre alles! Ganz schlecht ist mir! Zweite Spielzeithälfte Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Sechsundachtzigste Minute! Und noch immer null zu null!« Habe ich eingehängt …
Einer vom Senat, der auf einem Kombiwagen steht und zur Menge spricht, denkt: Ja, ich rede hier, ich, ein kleiner Beamter! Warum ist der Kanzler nicht hier? Oder der Bundespräsident? Und all die tapferen Minister? Die haben ihr Plansoll erfüllt. Auf Kundgebungen. Mit flammenden Reden. Besonders flammend haben jene geredet, die unseren Regierenden Bürgermeister immer weiter dafür beschimpfen, daß er während des Dritten Reichs in Schweden war und nicht hergekommen ist, um in einem KZ zu verrecken als Antifaschist. »Was hat Herr Brandt in diesen Jahren draußen gemacht?« hat so ein feiner Politiker auf einer Kundgebung vor den letzten Wahlen gerufen. »Wir wissen, was wir in diesen Jahren hier drin gemacht haben!« Ja? Viele wissen das aber auch nicht mehr! Egal: Heute lassen sie den Regierenden in Ruhe, heute ist sogar er ein feiner Mann, heute sind wir alle feine Leute, lauter Helden – und das ganze übrige Jahr durch wären sie froh, wenn es Berlin nicht gäbe, alle miteinander! Aber das darf ich den Leuten natürlich nicht sagen, die da vor mir stehen und schreien und protestieren, die armen, dummen, längst verratenen Leutchen. Nein, ich muß weiter rufen: »Bitte, provoziert nicht! Denkt an unsere Brüder und Schwestern im Osten! Wir sind ihre letzte Hoffnung! Wir müssen Geduld beweisen, verhandeln, Ruhe bewahren! Nur so können wir helfen …«
Die Brüder und Schwestern drüben im Osten sehen aus den Fenstern ihrer Wohnungen dem Schauspiel an der Mauer zu. Das Licht in den Zimmern haben sie abgedreht, sie neigen sich kaum aus den Fenstern.
Nur eine Frau …
Frieda! Um Himmels willen, winke nicht! Hast du den Verstand verloren? Die sehen es ja doch nicht, wegen der Scheinwerfer. Aber Bergers über uns können es sehen. Und die Kornmannsche unter uns. Weißt du, warum der Kornmann drei Monate lang weg war und sein Frauchen allein gelassen hat? Weil er auf Spezialausbildung war in einer SSD-Schule. Sei ruhig, der junge Kornmann ist beim SSD – in einer Sonderabteilung! Kannst du mir glauben. Ich hab’ es von Jantzen. Jantzen wußte schon immer alles. Komm endlich vom Fenster weg. Was können wir denn tun? Überhaupt nichts … Nein, hier, in der Wöhlertstraße 1, Ecke Chausseestraße, kann heute keiner etwas tun. Auch nicht beim Übergang Invalidenstraße oder am Brandenburger Tor oder hinter dem Reichstag.
Aber in der Hasenauerstraße …
Da sieht es anders aus. Da gibt es keine Demonstranten, keine Polizei, keine Soldaten, keine Panzer. Da ist es ruhig. Kaum ein Mensch läßt sich blicken.
Hier kann man etwas tun heute nacht.
Flüchten zum Beispiel.
Leichter als sonst!
Wenn man nicht eben das Unglück hat, so dick zu sein wie jene arme Frau, die im Einsteigloch eines Tunnels steckengeblieben ist und damit vielen anderen Unglück zu bringen droht in dieser herrlichen Augustnacht, durch die immer neue glückbringende Sternschnuppen fallen.
2
Das Haus Hasenauerstraße 67 ist sehr groß. Es gibt Geschäfte und Büros und Wohnungen. Gott sei Dank! Im Keller eines Hauses, in dem nicht viele Menschen arbeiten, leben, aus und ein gehen, hätte man nie einen Tunnelbau beginnen können.
Auf der vierten Etage wohnen Heisterbergs. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der ›Weltpresse‹ und sieht mit seinen achtundvierzig Jahren noch sehr gut aus, die Frauen schauen ihm nach. Seiner Frau schaut kein Mann nach. Eine abgearbeitete, farblose Person ist die siebenundvierzigjährige Margot. Am Vormittag geht sie als Sprechstundenhilfe zu einem Gynäkologen. Wirtschaftsredakteure verdienen nicht viel. Und der Egon, der schmeißt mit dem bißchen auch noch um sich, als wäre es Dreck. Margot weiß, daß die Weiber hinter ihm her sind, und sie weiß auch, was der Egon für einer ist. Der läßt nichts aus. Torschlußpanik!
Voriges Jahr ging es ihm richtig elend im Winter, schwere Thrombose. Er dachte, er müsse sterben. Da hat er den Schwestern in der Klinik dauernd vorgejammert: »Viel zu wenig Frauen habe ich gehabt in meinem Leben, jetzt ist es aus, jetzt kann ich nichts mehr nachholen …« Eine Schwester hat das der Margot erzählt.
Kaum war der Egon wieder auf den Beinen, da hat er angefangen mit Nachholen, aber wie!
Es ist schon zum Lachen, wenn Margot die Redaktion (da halten sie natürlich alle zu ihm) anruft, und er ist gerade wieder bei einer, und es heißt dann »Den Moment weggegangen!«, »Eben noch dagewesen!«, »Muß gleich wiederkommen, ist nur zum Umbruch!«
Umbruch!
Kann sich seine Zeit hübsch einteilen, der Egon. Selbst die ungeheuerliche Geschmacklosigkeit besitzt er, bereits ein Weib in die Wohnung zu bringen, am Vormittag, wenn Ulli, der vierzehnjährige Sohn, in der Schule ist und Margot unabkömmlich bei Dr. Vlies. In die Wohnung, jawohl! Und seit Monaten geht das! Nachbarinnen haben das Mädchen zuerst gesehen. Dann haben sie es Frau Heisterberg beigebracht. Schonend natürlich. Und Frau Heisterberg hat die Person einmal – durch einen glücklichen Zufall! – in Fleisch und Blut erblickt, als sie gerade das Haus verließ. Allein natürlich. Wird nicht Arm in Arm mit Egon losziehen. Ganz nahe ist diese junge, hübsche Rothaarige an Margot vorübergegangen!
Natürlich streitet Egon alles ab. Aber was Margot gesehen hat, das hat sie gesehen. Und wenn sie sich noch nicht scheiden ließ, so nicht etwa Ullis wegen, der ist schon mächtig selbständig und frühreif, nein, nur wegen der letzten fehlenden Beweise! Margot wird sie bald haben. Sie muß wissen, wie die Rothaarige heißt und wo sie wohnt. Dicht auf den Fersen ist Margot dem Luder. Ein paar Wochen noch, dann klappt die Falle zu. Dann soll Egon was erleben! Schuldig geschieden wird er werden, aber so! Die Wohnung wird er räumen müssen, und Alimente zahlen, jawohl! Dauert nicht mehr lange, die Herrlichkeit. Zu Weihnachten soll er längst ganz klein und arm und häßlich dastehen. Nur noch ein Weilchen muß man es aushalten mit ihm, gereizt natürlich, böse natürlich, ewig zankend. Was verdient so ein Hurenbock denn anderes? Vor dem Ulli nimmt Margot sich zusammen. Das Kind ist unschuldig. Ihr ein und alles. Ullichen darf nicht leiden.
So sitzen die Heisterbergs, falls der Egon zu Hause ist und nicht ›Dienst‹ hat, haha!, so sitzen sie dann abends am Fernsehapparat, denn Ulli sieht gerne fern. Die Eltern auch. Sie wüßten nicht, was sie sonst – außer streiten – tun sollten.
Ist es elf Uhr, manchmal zum Wochenende auch zwölf Uhr, stehen alle drei sofort auf, wenn der Apparat abgeschaltet wird. Ganz schnell! Vater und Sohn räumen weg, was herumsteht, Gläser, Flaschen, Aschenbecher. Mutter klopft die Kissen zurecht und lüftet, Ulli wäscht sich blitzartig und verschwindet, dann marschiert Vater ins Badezimmer, während Mutter noch in der Küche rumort. Kommt sie ins Badezimmer, ist Egon schon im Schlafzimmer. Und kommt sie ins Schlafzimmer, schläft er schon. Oder er tut so, als ob. Und sie legt sich neben ihn (könnte man auf der Couch im Wohnzimmer schlafen, wäre sie längst übersiedelt!) und tut auch so, als ob. Da liegen sie oft stundenlang wach. Und um ein, zwei Uhr morgens beginnen sie dann wieder zu streiten im Finstern, und sind fest davon überzeugt, daß Ulli nichts hört; der Junge hat einen so festen Schlaf. Gehabt! Jetzt schläft er nervös und wacht leicht auf, und dann hört er alles durch die Wand …
»Geld rausschmeißen für diese Mistweiber, und die eigene Frau kann arbeiten!«
»Zwinge ich dich? Machst es ja freiwillig!«
»Freiwillig! Ich mach’s, weil es sonst immer noch nicht reichen würde! Aber treib’s nur so weiter! Deine blauen Wunder wirst du erleben! Die Rothaarige, die hat das Faß zum Überlaufen gebracht!«
»Geht das wieder los!«
»Ist dir peinlich, was? Schlampe, gemeine! In die Wohnung von einem verheirateten Mann!«
»Ich sage es dir jetzt zum hundertsten Mal, ich kenne keine Rothaarige, habe nie eine gekannt! Du bist ja hysterisch!«
»Hysterisch, ja, das möchtest du wohl! Erzählst es ja auch überall herum! Aber ich arbeite bei einem Frauenarzt, und der weiß, ich bin die ruhigste und normalste Person von der Welt!«
»Ha! Hahaha!«
»Schriftlich gibt der mir das! Laß mich in Ruhe! Rühr mich nicht an! Du stinkst ja nach der Roten! Alle Roten stinken! Du genauso! Dein Haar am meisten! Übel kann einem werden, ähhh!«
»Ja, ähhh! Da hast du recht! Rackert man sich ab den lieben, langen Tag, und nachts darf man sich anklaften lassen!«
»Ach, du mein Armer! Hast dich wieder schwer abrackern müssen heute? Bist eben doch nicht mehr der Jüngste. Und so eine Rothaarige, so ein geiles, junges …«
»Halt jetzt den Mund, verflucht!«
»Schrei nicht! Du weckst den Ulli!«
Ja, den Ulli, den sie bereits vor einer Stunde geweckt haben und der sich alles anhört …
So also geht es zu bei Heisterbergs in mancher Nacht, und am Abend danach sitzt man wieder vor dem Flimmerkasten – wie heute, wie jetzt.
Ein langweiliger Abend ist das, ein schiet-feierlicher mit einem ganz miesen Programm. Der Ulli brummt und raunzt.
»Wollen wir nur noch den Mann zu Ende hören, dann drehen wir ab«, sagt Vater.
Der Mann ist der Professor Golo Mann, und er spricht zum Jahrestag der Errichtung der Berliner Mauer. Er warnt davor, alle Sowjetzonenpolitiker rundweg zu verteufeln und zu glauben, daß der Kommunismus mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden kann und muß.
»Mensch, das ist ja selber ’n Kommunist!« sagt Ulli und trinkt Apfelsaft.
»Halt den Mund! Was verstehst du schon davon!« sagt Vater und trinkt Kognak.
»Ganz recht hat er«, sagt Mutter.
»Wollt ihr vielleicht ruhig sein?« knurrt Vater drohend und verschüttet etwas aus seinem Glas, als er es hinsetzt.
Und der Professor auf der Mattscheibe fordert dazu auf, jenen Menschen in der Zone zu helfen, die freiere, anständigere und produktivere Formen des Sozialismus erstreben, anstatt sämtliche Menschen, die dort irgend etwas mit Politik zu tun haben, in Bausch und Bogen zu verdammen.
»Die Mauer«, sagt der Professor, »ist eine Schmach für alle: Für das Deutschland von 1933 bis 1945, das dieses Elend vorbereitet hat, für die alliierten Politiker, die den Mauerbau nicht verhindern konnten und sich auch nicht gerade leidenschaftliche Mühe darum gegeben haben, und für die Bundesrepublik selber.«
»Bravo!« ruft Vater, der 1936 in die NSDAP eingetreten war, damit er Redakteur werden konnte, was zu sein ihm dann von 1945 bis 1949 verboten wurde. »Endlich einer, der die Wahrheit sagt! Was haben die Amis denn getan vor drei Jahren? Und die Franzosen? Und die Engländer? Und die braunen Brüder in Bonn?«
»Egon!« ruft Mutter empört. »Vielleicht reißt du dich wenigstens vor dem Kind zusammen! Du bist ja schon wieder blau! Wenn der Ulli alles in der Schule erzählt, was du im Suff daherredest …«
»Im Suff? Sag mal, was fällt dir …«
»Ich erzähle nie was!« mault der Ulli, unterbrechend.
»Du?« fährt Vater ihn an. »Jeden Piep erzählst du! Machst du doch am liebsten!«
»Laß den Jungen in Ruhe!« ruft Mutter. Sie trinkt in letzter Zeit abends auch ein wenig (die Nerven), und so fällt die pädagogische Wendung um 180 Grad ganz leicht: »Der Ulli weiß, was er aus dem Haus tragen darf und was nicht!«
»Das will ich meinen«, sagt Ulli. »Würdet schön dastehen, alle beide, wenn ich es nicht wüßte!«
»Was soll denn das heißen?«
»Na, wäre es dir vielleicht angenehm, wenn ich erzähle, daß du Mutter sechsundvierzig nur geheiratet hast, weil du damals nicht arbeiten durftest und Mutter eine heile Wohnung hatte und die Stelle bei Doktor Vlies?«
»Noch ein Wort und …«
»Und? Und? Was denn und?« Der Ulli ärgert sich gräßlich über diesen sabbelnden Professor, er hat gehofft, es würde eine schicke Show geben mit hübschen Mädchen oder wenigstens einen Krimi, und wenn es ›77 Sunset Strip‹ gewesen wäre, und weil er sich so ärgert, wird er nun frech, aber mächtig: »Und dann klebst du mir eine, Vater, ja? Dafür, daß ich nie was von den Babys erzähle, die Mutter bei Doktor Vlies hat wegmachen lassen …«
»Also, das ist doch …«
»Deine Erziehung, Margot!«
»… bis du nach der Währungsreform endlich wieder in einer Redaktion rumkriechen durftest und ein bißchen mehr Geld da war und ihr gedacht habt, jetzt könnt ihr euch mich leisten?«
»Du bist ja verrückt! Von wem hast du diesen Quatsch?«
»Von euch! Nicht mal mehr schlafen kann man in dieser Bude, weil ihr euch ausgerechnet in der Nacht anschreien müßt mit all dem! Und mit deinem Saufen, Vater, und mit deinem Keifen, Mutter, und mit deinen Weibern, Vater, und mit deiner Hysterie, Mutter, und mit dieser dämlichen Rothaarigen, die herkommt, wenn ich in der Schule bin und du bei dem ollen Kratzer, und mit der Vater dann in die Betten …«
Da hat er eine weg, daß ihm der Bonbon aus dem Mund fliegt, an dem er gelutscht hat. Er heult los.
Die Mutter schreit: »Mein Sohn wird nicht geschlagen, verstanden, Egon? Von dir nicht! Nicht von so einem wie dir!«
»Ach, Margot, weißt du, was du kannst? Du kannst …«
»Egon!!«
»Ich hab den Kanal voll!« brüllt der Ulli plötzlich los. »Mir reicht es jetzt mit unserer Ehe! Ich gehe zum Jugendamt! Ich will in ein Heim, aber sofort! Da habe ich wenigstens meine Ruhe!«
»… zwar«, sagt Professor Golo Mann, »vermochte die Bundesrepublik nach Westen hin schöne, konstruktive Erfolge zu erringen, doch diese waren nur möglich auf Kosten der Menschen in der Zone …«
3
Auf dem Dachboden des Eckhauses Hasenauerstraße 67 gibt es viele Lattenverschläge, in denen Möbel, Koffer, Geschirr und tausenderlei Krimskrams der Mieter lagern. Jeder Verschlag hat eine Tür, und an jeder Tür hängt ein Schloß. An einer Tür hängt keines. Jedenfalls nicht außen. Innen schon. Versperrt.
Der Verschlag hat dem Chef der stillgelegten Dampfwäscherei, Herrn Czibilsky, gehört. Eine feste Wand besitzt dieser Verschlag: Das ist die Dachschräge. In ihr gibt es eine kleine Luke. Durch sie kann man über die Mauer hinweg in jenen Teil der Mottlstraße sehen, der im Osten liegt. Sie ist hell erleuchtet, die Ost-Mottlstraße. Weit hinten steht ein Wachtturm. Steht aber zur Zeit kein Vopo da oben, und die Scheinwerfer sind nicht eingeschaltet.
Haben wir völlig richtig überlegt, denkt der vierundzwanzigjährige Kurt Mittenzwey, der an der Luke sitzt und mit einem starken Feldstecher alles beobachtet, was drüben vorgeht. Zuviel Wirbel die ganze Mauer entlang. Zu wenig Mannschaften. Hier ist es still. Also passen sie hier nicht einmal so auf wie sonst …
Der ruhige, besonnene Kurt Mittenzwey hat noch 1961 in Ostberlin Jus studiert. Er wollte lernen, er wollte in Frieden gelassen werden. Er tat, was man ihm zu tun befahl. Er tat nichts, was verboten war. Ein Musterbürger der DDR. Kein Feigling oder Dummkopf! Nur ein Realist. Wenn die Sowjets es wollten, dann wurde Deutschland wiedervereinigt. Wenn die Sowjets es nicht wollten, half keine Verschwörung, keine Agitation, war jeder Widerstand von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Mittenzweys Eltern lebten nicht mehr, er besaß keine Verwandten. Er lernte Barbara Tomkin kennen, eine Medizinstudentin. Sie verliebten sich ineinander, die schöne, einundzwanzigjährige Barbara mit dem flammend roten Haar und der sehr hellen Haut und der große, schlanke Kurt mit dem braunen Haar und den braunen, skeptischen Augen. Dann begannen sie einander zu lieben. Barbara war wundervoll, fand Mittenzwey. Alle seine Ansichten teilte sie, nur lernen wollte auch sie, etwas werden, nichts wissen von Politik, sich nicht engagieren, sich heraushalten aus allem.
So schien es. Aber es schien nur so.
Am 13. August 1961 stand plötzlich die Mauer da. Und am 14. August in aller Frühe stürzte Barbara, völlig aufgelöst, in Mittenzweys Zimmer.
»Was ist geschehen?« rief Mittenzwey.
Schlimmes, sehr Schlimmes war geschehen in der vergangenen Nacht. Man hatte einen Professor verhaftet und eine Studentengruppe. Unter Leitung dieses Professors waren von der Gruppe Flugzettel zu Tausenden produziert worden. Ausgezeichnete, wirksame Zettel, auf denen gegen den Ulbricht-Staat polemisiert wurde. Polemisiert, nicht gehetzt! Da gab es nur nüchterne Zahlen, Fakten, Daten, die niemand bezweifeln, niemand abstreiten konnte. Kurz und klar war jeder Satz. Jeder mußte ihn begreifen, jeder mußte glauben, was da stand. Die Zettel waren nicht nur in Ostberlin, sondern auch in der Zone verbreitet worden.
»Jetzt sind wir aufgeflogen«, berichtet Barbara atemlos.
»Wir?« Mittenzwey springt entsetzt hoch. »Was heißt das? Warst du denn auch …«
»Von Anfang an … Als einzige bin ich noch in Freiheit …«
»Warum hast du mir nie etwas davon erzählt? Warum hast du mir die Unpolitische vorgespielt?«
»Ich wollte dich nicht belasten … nicht verlieren … Ich hatte solche Angst vor dem Verlieren … Du bist doch alles, was ich habe … Nun muß ich flüchten. Nicht mal mehr heim kann ich, ein paar Sachen holen … Und ich weiß nicht, wie ich rüber komme …«
»Aber ich«, sagt er und fährt in seine Kleider.
»Was?«
»Ich weiß es. Ich komme mit dir.«
»Du …«
»Hast du gedacht, ich bleibe? Ach Barbara …«
Da hat man nun also jahrelang stur nach bestimmten Regeln gelebt, vorsichtig, allein, nur für sich. Und von einer Minute zur andern ist all das vorbei. Menschen ändern sich nicht? Oh, sie tun es! Es gibt nichts, was Menschen nicht tun – unter Zwang. ›People under pressure‹ – jemand schrieb einmal ein Buch, das hieß so …
Eine Stunde nachdem Barbara bei Mittenzwey erschienen war, hat der aus dem Fuhrpark eines Städtischen Großküchenbetriebes einen Fünftonner geklaut und rast – seine rothaarige Geliebte liegt auf dem Boden der Fahrerkabine – durch den Osten, wird wüst beschossen – und durchbricht die Mauer auf dem Wilhelmsburger Damm. Beide Flüchtlinge sind unverletzt. Der Laster ist schrottreif. Steht viel in den Zeitungen über diese tollkühne Flucht. Mittenzwey, der Held des Tages. Ausgerechnet Mittenzwey! Zuerst ist er wütend, dann ärgert er sich nur noch, zuletzt lacht er.
Nach seiner Heirat, da lacht er nicht. Am 5. September 1961 ist das. Die Behörden haben rasch gearbeitet. Nur ganz kurz mußten Barbara und Kurt ins Lager Marienfelde, zur Vernehmung durch amerikanische CIC-Beamte und britische 20MI-5-Agenten. Kleidung erhielten sie da und jeder hundert Mark Friedland-Hilfe. Auf dem Wohnungsamt erklärten sie, sofort heiraten zu wollen. Wurden also bevorzugt behandelt, bekamen Flüchtlingsausweis C. Neue Personalausweise hatten sie schon nach den Vernehmungen bekommen. Eine kleine Wohnung in einem Neubau der Bleibtreustraße, dicht beim S-Bahnhof Savignyplatz, findet sich. Und auf dem Standesamt Charlottenburg werden sie getraut. Danach fahren sie zur Bernauer Straße, denn da leben Barbaras Eltern. Das Haustor ist nun zugemauert, sieht Mittenzwey, der Unpolitische, Mittenzwey, der Ohne-Mich-Mann, Mittenzwey, der Realist. Denn Barbaras Elternhaus liegt schon hinter der Mauer. Oben, im dritten Stock, blicken die alten Leutchen aus einem Fenster. Barbara hält ihren Hochzeits-Blumenstrauß im Arm und sieht zu Vater und Mutter empor und weint, ganz schrecklich weint sie. Und auch den Eltern stehen Tränen in den Augen. Der Vater hat einen Arm um die Mutter gelegt, weißhaarig ist er, Mutter trägt eine Brille, die immer rutscht, und Vater versucht, sie zu trösten, so wie Mittenzwey versucht, Barbara zu trösten. An einem Bindfaden lassen die Eltern ein Päckchen auf die Straße herab. In dem Päckchen liegt das Hochzeitsgeschenk. Barbara knüpft ihren Hochzeitsstrauß an den Bindfaden, und die Eltern ziehen die Blumen empor. Das ist das Geschenk für sie.
4
Barbara Mittenzwey nimmt ihr Studium der Medizin an der Freien Universität Berlin wieder auf, ihr Mann das der Jurisprudenz. Aber er kommt nur zu zwei Vorlesungen. Dann hat er etwas Wichtigeres zu tun.
Barbaras Eltern sind noch drüben. Sie lieben ihr Kind. Und Barbara liebt ihre Eltern. Sie kann nicht schlafen vor Angst und Sorge. Und Mittenzwey liebt seine Frau. Gibt es da überhaupt noch die Frage, was er zu tun hat?
Ach, Mittenzwey, ruhiger, skeptischer Mittenzwey, jetzt reißt dich das Leben doch in den unheimlichen, finsteren Strudel aller Gefahren, denen du so lange und so geschickt ausgewichen bist!
Es reißt dich?
Du wirfst dich ja hinein in den Mahlstrom, zu allem entschlossen, bedenkenlos! Du machst es dem Leben leicht, dich zu zerstören. Natürlich zerstört das Leben uns alle, früher, später, ob wir uns nun bewahren wollen oder nicht. Aber du, Mittenzwey, du wolltest es einmal, und nun willst du es nicht mehr. Wir werden sehen, was solchen geschieht wie dir, wir werden es sehen …
Mittenzwey hört herum. Er erfährt, daß es in Westberlin Gruppen gibt, die Tunnel unter der Mauer durchgraben und Menschen her- überholen. Immer mehr Gruppen entstehen. Einer von ihnen schließt Mittenzwey sich an und baut an einem solchen Tunnel mit, im Oktober 1961. Eine schwere und langwierige Arbeit ist das. Mit ihm buddeln Studenten, die selber geflohen sind, Studenten aus Westberlin, junge Arbeiter, ein paar Spezialisten. Es gibt einen Boß, der leitet alles, der schafft das Geld ran, das man braucht.
Woher kommt das Geld?
Mittenzwey interessiert sich nicht dafür. Noch nicht. Er will Barbaras Eltern in den Westen holen, das ist alles, was er zunächst will. Er holt sie. Zweiundfünfzig Flüchtlinge kommen insgesamt durch den Tunnel, bevor er drüben entdeckt wird. Barbaras Eltern werden als politische Flüchtlinge anerkannt wie Mittenzwey und seine Frau, sie bekommen Aufenthaltserlaubnis und Rente. Sie wohnen bei den Kindern in der Bleibtreustraße. Nur vorübergehend, denn die Wohnung ist zu klein für vier Personen. Die Eltern werden bald ein eigenes Heim zugewiesen erhalten. Es dauert alles seine Zeit. Sie sind im Westen – das ist die Hauptsache! Auch in einer zu kleinen Wohnung können vier Menschen leben, wenn sie aufeinander Rücksicht nehmen. Und eigentlich sind es meistens ja überhaupt nur drei Menschen. Denn seltener und seltener ist Kurt Mittenzwey daheim. Seit er bei der Flucht der Zweiundfünfzig half, seit er die Gesichter der Flüchtlinge sah, seit er das alles erlebte, die furchtbare Angst zuerst, das fassungslose Glück dann später, hat ihn eine fixe Idee ergriffen: Mehr Menschen muß man zur Flucht verhelfen! Zweiundfünfzig – das ist lächerlich!
Es hat keinen Sinn, in einer gesetzesfeindlichen, alle Gesetze brechenden und mißachtenden Welt noch Gesetze zu studieren und zu versuchen, mit ihrer Hilfe Recht zu sprechen. Recht sprechen – das ist gar nichts! Recht tun muß man!
Mittenzwey gibt seine Juristerei auf. Er besucht keine Vorlesungen mehr. Bei einer anderen Gruppe baut er einen zweiten Tunnel. Diesmal interessiert er sich schon für die finanziellen Hintergründe. Immerhin, das weiß er nun, kostet der Bau eines Stollens zwischen 30000 und 50000 Mark.
Woher kommt das Geld? fragt Mittenzwey eines Abends den Tunnelboß. Das ist ein geflüchteter Mechaniker, zweiunddreißig Jahre alt, ein knochiger Mann mit eingeschlagener Nase und Totalglatze. Ein paar Zähne fehlen ihm auch. Lamprecht heißt er. Einen Arm haben sie ihm kaputtgeschossen, als er durch die Spree geschwommen ist. Mußte amputiert werden. Mit Mechaniker hat es sich also. Nichts mehr zu machen.
Lamprecht ist ganz offen zu Mittenzwey, er sagt, wie das zugeht, und Mittenzwey kennt sich nun bei Menschen schon genug aus, um zu wissen, der Lamprecht, der lügt nicht.
Das Geld also kommt von Otto Fanzelau, dem Inhaber der bekannten gleichnamigen Privatbank, Bankhaus Fanzelau. Das ist ein Begriff! Nicht nur in ganz Deutschland, nein, in der ganzen Welt. Otto Fanzelau, glaubt Lamprecht, finanziert überhaupt alle Tunnel. »Ich kriege die Baukosten auf Raten«, erzählt der einarmige Ex-Mechaniker. Er geht mit Mittenzwey auf dem Kurfürstendamm spazieren bei diesem Gespräch, es ist sehr kalt, aber die Luft, die frische Luft an diesem Februartag 1962, tut gut. Der Schnee knirscht unter ihren Schuhen. »Immer, wenn eine Rate alle ist, rufe ich Fanzelau an und sage, wieviel ich weiter brauche. Dann läßt er mich am nächsten Tag kommen und gibt mir das Geld. Hat es daheim. In einem Tresor. Ich muß abrechnen, genau, weißt du, mit allen Belegen, und die Beträge, die ich erhalte, muß ich quittieren.«
»Finanziert der das alles aus eigener Tasche?«
»Möglich. Aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht zahlt auch der Senat, und er gibt die Penunse nur weiter. Vielleicht zahlt irgendeine Organisation.«
»Eine Westberliner?«
»Ja. Oder eine westdeutsche. Oder eine ausländische. Können auch politische Parteien dahinterstecken. Ist uns doch egal! Fanzelau sagte mir gleich beim erstenmal, ich darf keine Fragen stellen. Also stelle ich keine. Er gibt die Penunse, wir bauen. Wenn wir bestimmte Leute rüberholen wollen, melde ich es ihm rechtzeitig, und er verständigt sie.«
»Wie macht er das?«
»Weiß ich nicht. Jedenfalls sind die Leute immer da, wenn wir durchbrechen. Gibt doch noch so viele Möglichkeiten! Schau mal: Jeder Ausländer, ja jeder aus Westdeutschland darf bei den Übergangsstellen rüber. Wenn er mal drüben ist, kann er reden, mit wem er will. Auch Briefe kann man schreiben oder schreiben lassen. Sogar telefonieren.«
»Ach, von Westberlin nach Ostberlin?«
»Sei nicht so dämlich, Kurt. Das natürlich nicht! Aber von Westberlin mit der ganzen Bundesrepublik! Und aus der ganzen Bundesrepublik mit Ostberlin und der Zone!«
Stimmt. über den kleinen Umweg von fünfhundert oder achthundert oder tausend Kilometern Telefonkabel kann jeder Mensch aus Westberlin einem Menschen aus Ostberlin in dringenden Fällen und kürzester Zeit eine telefonische Nachricht zukommen lassen. Die beiden Menschen sind vielleicht nur einen Kilometer voneinander entfernt. Triumph der Technik!
»Außer den Leuten, die wir rüber haben wollen, Angehörige von denen, die mit uns buddeln, oder Gefährdete vor der Verhaftung und so«, erzählt Lamprecht, »kommen immer welche, die keiner von uns kennt. Das sind dem Fanzelau seine. Wichtige Leute.«
»Wichtig für wen?«
»Für ihn oder für die, die hinter ihm stehen. Wer immer die sind. Hat keinen Sinn zu fragen. Kriegst doch keine Antwort. Aber Geld kriegst du. Und kannst buddeln. Wenn Fanzelau dich fest anstellt – so wie mich –, hast du ein regelmäßiges Einkommen. Wer verlangt mehr mit einem Arm? Ich habe eben einen neuen Beruf. Reich will ich ja schließlich nicht werden an der Sache!«
Hatte Mittenzweys zweiter Boß gesagt.
Der dritte schien reich werden zu wollen. Der ließ sich den Tunnelbau zweimal finanzieren. Einmal von diesem Privatbankier Fanzelau und dann noch einmal von einer westdeutschen Illustrierten. Der bot er exklusiv das Recht an, das ganze Unternehmen Stufe um Stufe zu fotografieren und die Geschichten abzudrucken, welche die Flüchtlinge erzählen würden.
Als dies herauskam, nämlich durch das Erscheinen von Fotografen und Reportern der Illustrierten, kriegte Mittenzwey Krach mit seinem dritten Boß. »Das ist eine Sauerei«, sagte Mittenzwey. »Du machst aus einer guten Sache ein dreckiges Geschäft.«
Der dritte Boß des ehemaligen Jus-Studenten war ein bleicher, schwindsüchtig wirkender Mann von etwa dreißig Jahren namens Rucker. Woher er kam, das wußte keiner.
»Nun laß es dir nicht gleich in die Hosen gehen«, sagte Rucker. »Was heißt dreckiges Geschäft? Okay, ich nehme Geld von der Illustrierten. Die hat Millionen, Mensch! Was sind da Fünfzigtausend? Für die Reklame? Können sie dann doch schreiben: Soundso viele Menschen verdanken unserer Illustrierten die Freiheit!«
»Ja, und wenn das ordentlich knallig serviert wird, dann steigt die Auflage, und mit der Auflage steigen die Inseratenpreise, und die Illustrierte verdient an ihrem Edelmut, und du verdienst an deinem Edelmut, und alles ist in Butter!«
Den Streit haben die beiden im September 1962, an einem milden, windstillen Tag. Sie sitzen neben der Avus und sehen amerikanischen Soldaten zu, die in den Wäldern Manöver abhalten. Hinter ihnen jagen Wagen über die Autobahn. Pneus singen. Vier bis sechs Monate dauert ein Stollenbau. Bis August war Mittenzwey noch bei Lamprecht beschäftigt gewesen. Da hatten sie den Tunnel fertig gebaut. Aber durch den kam kein Flüchtling rüber …
Als sie drüben durchstießen, kletterte Lamprecht zuerst aus dem Loch. Ein ungeschriebenes Gebot: Als erster geht immer der Boß. Dies war nämlich der gefährlichste Moment. Mittenzwey und drei andere Kameraden kauerten im Tunnel. Sie warteten und wagten nicht, sich zu rühren, bevor sie Lamprechts Stimme hörten. Sie mußten lange warten, mindestens fünf Minuten. Dann erklangen Schritte. Und dann hörten sie Lamprecht schreien: »Ich soll rufen: Kommt alle raus, da liegt ein Angeschossener! Aber da liegt gar keiner! Die Vopos haben mich erwischt, sie warteten schon! Haut ab! Haut …« Das zweite ›ab‹ konnte Lamprecht nicht mehr brüllen. Zwei Schüsse knallten, trocken, kurz.
Röcheln. Stöhnen. Stille.
Sie waren zurückgestürzt durch den Stollen, Mittenzwey und die drei anderen. Sechs Monate Arbeit umsonst. Lamprecht zweifellos tot. Aber jeder der Gruppe suchte sich sofort Arbeit unter einem anderen Tunnelboß. Damals gab es schon zwei Dutzend in Westberlin. Mittenzwey landete bei dem bleichen, ewig hustenden, ewig rauchenden Rucker. Und mit dem hat er jetzt Streit …
»Junge, Junge«, sagt Rucker und spuckt ins Gras und zündet eine Zigarette am Stummel einer anderen an, »nun mach aber ’n Punkt. Na schön, ich verdiene! Ich muß verdienen! Wenn ich nämlich nicht spätestens in einem halben Jahr in der Schweiz bin, in irgendeinem Sanatorium hoch oben, dann ist Feierabend bei mir. Sagt der Doktor. Und das, weißt du, möchte ich nun gerade nicht. Pointe: Lungensanatorium in Davos bezahlt die Wohle nicht.«
»Wenn ich so krank wäre, würde ich weniger rauchen«, erklärt Mittenzwey nachdrücklich.
»Das laß man meine Sorge sein, ja?« sagt Rucker. Und böse spuckt er wieder ins Gras. »Immer noch besser, ich verschaffe mir mit der Illustrierten mein Geld, als es so zu machen wie die Brüder, die sich von Fanzelau bezahlen lassen und dann noch in Westberlin rumlaufen oder in die Bundesrepublik fliegen und sich pro Flüchtlingskopf und -nase von Angehörigen sechs- bis achttausend Piepen geben lassen! Wenn da keiner für den, der flüchten will, zahlt, dann kann der verschimmeln drüben! Mensch, im Juni sind doch zwei Flüchtlinge von solchen Fluchthelfern sogar umgenietet worden, weil sie ohne Bezahlung rüber wollten!«
Umnieten, das heißt erschießen, Mittenzwey weiß es. Es gibt viele Fachausdrücke in diesem Gewerbe. Und er hat auch die Geschichte von den beiden Flüchtlingen gehört, denen sich in einem Tunnel Westberliner in den Weg stellten und sie zurückjagen wollten. Nach einer kurzen Prügelei waren die zwei Flüchtlinge zwei Leichen gewesen. Namen der Mörder? Nie bekannt geworden. Intern weiß man natürlich Bescheid …
Treuherzig sagte also Tbc-Boß Rucker: »Wenn du was gegen solche Dreckschweine hast – bitte sehr! Die verdienen sich wirklich dumm und dämlich! Die rechnen mit Hunderttausenden Reingewinn. Devise: Wer zahlt, darf fliehen, wer nicht zahlt, der nicht. Das nenne ich auch eine Sauerei. Aber meine Illustrierte …«
»Mensch, kapierst du denn nicht, daß deine Illustrierte ihr Geschäft mit der Lebensgefahr von denen drüben und deinen Kumpels und dir macht?«
»Klar kapiere ich das. Soll sie doch. Meine Lunge …«
»Deine Kumpels haben auch Lungen!«
»Aber gesunde.«
»Ja, noch. Mein letzter Boß ist hopsgegangen im August.«
»Künstlerpech. Jedenfalls nieten wir keinen um!«
»Bist mächtig stolz darauf, was? Vielleicht kommt’s noch. Ich will dir mal was sagen: Ich war gestern im Martin-Luther-Krankenhaus.«
Rucker wird plötzlich knallrot und schreit: »Was hast du mir nachzuspionieren?«
Ungerührt antwortet Mittenzwey: »Mit deinem Arzt habe ich gesprochen.«
»Woher weißt du …«
»Einer von den Reportern hat es mir erzählt. Die sind auf Draht! Haben sich erkundigt über dich, bevor sie einstiegen, deine Illustriertenfreunde. Ihnen genügt, daß sie das Krankenhaus kennen, in dem du gelegen hast. Mir hat das nicht genügt. Ich bin hingegangen und habe mit deinem Arzt geredet. Also, einen Monat warst du dort, dann hat der Doktor durchgesetzt, daß du in den Schwarzwald geschickt wirst. Prima Heilstätte. Kostenlose Behandlung. Auch Geld hast du gekriegt.«
»Der Doktor hatte überhaupt nicht das Recht, dir irgendwelche Auskünfte zu erteilen! Du bist kein Angehöriger von mir!«
»Ich habe ihm gesagt, meinem Bruder ginge es ausgezeichnet, er ließe sich herzlich bedanken und schön grüßen. Hast also das Geld genommen und bist dageblieben. Unbedingt Davos, was? Schwarzwald ist dir nicht fein genug. Bist ja auch ein ganz schwerer Fall, glatter Todeskandidat! Er hätte dich natürlich auch in Berlin hingekriegt, sagte der Doktor. Vernarbte Tb. Lunge an den Narbenstellen geschrumpft. Als du zu ihm kamst, hattest du einen Sekundär-Katarrh in dem geschrumpften Gewebe. Auswurf niemals positiv. Mit Neoteben wäre es weggegangen wie nichts. Er wollte dir bloß was Gutes tun, du solltest dich mal ausruhen und anfressen, sagte der Doktor. Würde sich freuen, wenn er wüßte, daß du hier die Gegend vollschleimst.«
»Aber das ist doch bloß Mache!« schreit Rucker, plötzlich zusammenbrechend.
»Was ist Mache?«
»Ich habe immer weiter Neoteben geschluckt! Der Katarrh hat ganz aufgehört. Ich bin gesund!«
»Deshalb mußt du ja schnellstens nach Davos.«
»Davos! Schulden habe ich, Mensch, grausige Schulden.«
Mittenzwey steht auf. In seinem Rücken hört er die Autos sausen, die Pneus singen. Er schaut Rucker kurz an, dann geht er los, zurück zur Stadt, auf den Funkturm zu.
Rucker rennt ihm nach.
»Du! Ich gebe dir Fünftausend, wenn du die Schnauze hältst!«
»Die gib diesem Reporter. Trell heißt er. Ich halte schon meine Schnauze. Aber ich habe sie auch voll. Ich buddle nicht weiter.«
Rucker wird weinerlich: »Kannst du das nicht verstehen? Hast du noch nie Schulden gehabt? Die Husterei mache ich doch nur, damit die anderen mir die Illustrierte verzeihen! Deshalb rauche ich so viel … Sobald ich rauche, muß ich husten …«
»Na, dann rauch man schön weiter«, sagt Mittenzwey. »Und nimm die Hand von meiner Schulter, bitte. Geh zu Trell. Gib ihm Fünftausend und erzähle ihm was Hübsches. Wird sich richtig erschütternd lesen: Schwer Lungenkranker als Fluchthelfer. Das letzte Wort, das er herauskotzte, war Freiheit!«
5
Otto Fanzelau.
Im Telefonbuch steht er nicht. Hat eine Geheimnummer, der große Bankier. Aber im Adreßbuch steht er. Mittenzwey fährt hinaus in den Grunewald, wo der kapitalkräftige Menschenfreund eine kleine, hübsche Villa in der Koenigsallee bewohnt.
Ein gepflegter Park. Die Häuser rechts und links von Bomben getroffen, nie mehr aufgebaut.
Ein Wolfshund. Ein vornehmer Diener. Herr Fanzelau.
Sonst wohnt niemand in der Villa, erklärt der Hausherr seinem jugendlichen Besucher, während er ihn durch Räume mit kostbaren Teppichen und Möbeln, Gobelins und Bildern von Renoir und Picasso, Modigliani, Klimt und Cézanne führt.
Herr Otto Fanzelau ist der kleinste Mann, den Mittenzwey jemals gesehen hat. Eine zierliche Riesenpuppe mit edlem Gesicht, wohlgeformtem Schädel, stahlblauen Augen und eisgrauem Haar.
Leise und hoch klingt die Stimme: »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Mittenzwey! Ich habe schon soviel von Ihnen gehört. Zuletzt über Ihren Streit mit Herrn Rucker.«
»Wer hat …«
Eine Handbewegung. »Ich weiß es, das genügt doch, nicht wahr? Ja, bitte, John?«
»Der Tee, Sir.«
»Danke. Kommen Sie, Herr Mittenzwey …«
Den Tee trinken sie in einer großen Halle, Wände und Plafond sind kunstvoll getäfelt. Antiquitäten stehen und liegen und hängen da, Totems aus fernen Ländern, schwarze Fruchtbarkeitsgöttinnen, Dämonen, griechische Vasen. Ein mächtiger Tisch in einer Ecke ist beladen mit Glückselefanten in allen Größen und aus vielen Materialien: Elfenbein, Holz, Gold, Silber, Marmor. Mindestens hundert Elefanten stehen auf dem Tisch, alle den Rüssel nach oben. Sonst bringen sie kein Glück. Behaupten jene, die so etwas sammeln, weiß Mittenzwey …
»Herrn Rucker habe ich sofort entlassen. Ein anderer Mann übernahm bereits die Gruppe. Die Illustrierte hat ihr Geld zurückerhalten. Sie können also beruhigt sein.«
»Herr Fanzelau …«
»Sie wollen selbst eine Gruppe leiten, ich weiß.«
»Woher …«
»Ich weiß es, das genügt doch, nicht wahr?«
»Ja. Natürlich …«
Mittenzwey fühlt sich ein wenig schwindlig.
Herr Fanzelau zeigt sich völlig informiert: Über ihn, über Barbara, Barbaras Eltern, Mittenzweys Vergangenheit und bisherige Tätigkeit im Westen.
»Wenn Sie nicht zu mir gekommen wären, hätte ich Sie gerufen, mein Freund«, sagt der elegante Zwerg mit der Perle in der Krawatte, dem englischen Diener, dem riesigen Wolfshund zu seinen Füßen. »Sie sind ein rechtlich denkender, integrer Mensch. Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Verzeihen Sie, wenn ich mich kurz fasse, es kommen noch einige andere Besucher. Ich möchte Sie gerne fest engagieren. Sagen wir achthundert Mark monatlich?«
»Das ist …«
»Also gut, tausend! Nicht zu versteuern. Einverstanden?«
Was heißt einverstanden? Am liebsten möchte Mittenzwey den kleinen Herrn umarmen. Aber da bräche er ihm sicher das Rückgrat, so unerhört zart ist der kleine Herr.
Nach einer halben Stunde steht Mittenzwey wieder auf der Koenigsallee. Alles geregelt, alles abgemacht. Ein Ehrenmann, dieser Otto Fanzelau, ein wirklicher Gentleman! denkt Mittenzwey, der zur Halenseebrücke hinuntergeht. Wer immer hinter ihm steht, in wessen Auftrag immer er handelt: Otto Fanzelau hat in seinem ganzen Leben keine einzige unanständige Handlung begangen, das sieht man auf den ersten Blick!
6
In den nächsten zwei Jahren baut Kurt Mittenzwey vier Tunnel. Alle werden von Fanzelau bezahlt. Auf Heller und Pfennig rechnet Mittenzwey ab. Mit der Monatsgarantie kann er den Haushalt und das Studium seiner Frau finanzieren und die Eltern unterstützen, die inzwischen eine eigene Wohnung erhalten haben.
Durch die ersten drei Tunnel kommen insgesamt zweihunderteinunddreißig Menschen, bevor die Einsteiglöcher entdeckt werden. Mittenzwey hat seine feste Mannschaft, wieder Studenten, Arbeiter und ein paar Spezialisten. Die nennen ihm jedesmal Namen von Freunden und Verwandten oder von Verwandten und Freunden von Freunden und Verwandten, die rüber wollen oder müssen. Bei den ersten drei Tunnel sind das zusammen vierundsiebzig Menschen. Die restlichen einhundertsiebenundfünfzig heißen ›Fanzelau-Leute‹. Mittenzwey kennt keinen einzigen von ihnen. Alle Flüchtlinge kommen sofort in das Auffanglager Marienfelde. Mittenzwey sieht sie nie wieder.
Er ist ein erstklassiger Tunnelbauer geworden, der alle Tricks und Bluffs und Sicherheitsmaßnahmen kennt. Sein Leben hat einen Sinn! Davon ist auch die schöne, rothaarige Barbara überzeugt. Sie liebt ihren Mann noch mehr nach dessen Wandlung. Nun erst sind sie richtig eins geworden in ihrem Kampf um die Freiheit. Ein großer, pathetischer, eher furchtbarer Begriff ist das, ›Freiheit‹! Wer kann ihn definieren? Wer wagt es überhaupt?
Barbara Mittenzwey.
»Freiheit, das ist immer die Freiheit der anderen!« sagt sie. Und diesen Satz findet ihr Mann wunderbar, ganz glücklich macht es ihn, sich die Worte wieder und wieder vorzusprechen. Denn um anderen Freiheit zu bringen, buddelt er doch weiter und weiter wie ein Berserker. Barbara hilft, wo sie kann. Auch sie ist glücklich: Im Westen darf sie den Kampf weiterführen, den sie im Osten unterbrechen mußte.
Zwei glückliche Menschen – eine glückliche Ehe. Was macht es, daß Mittenzwey oft wochenlang in einem fremden Keller, an einer neuen Baustelle schläft? Überhaupt nichts! Barbara kommt ihn besuchen. Sie plant doch jedesmal von Anfang an mit – auch im Januar 1964, als der vierte Tunnel in Angriff genommen wird.
Einen ganzen Monat hat das Ehepaar Mittenzwey überlegt und gesucht, bevor es sich für die Hasenauerstraße 67 entschied. Ausschlaggebend dabei war der Umstand, daß Herr Friedrich Czibilsky seine Dampfwäscherei daselbst ab 1. Januar 1964 stillgelegt hat. Der alte Herr, der in Wilmersdorf wohnt, schaffte es nicht mehr. Die Angestellten behumpsten ihn.
Herr Czibilsky will sich nicht zu Tode ärgern. Er wird den Laden verkaufen! Und er gibt eine Annonce in der ›B. Z.‹ auf.
Das ist der Moment, da Kurt Mittenzwey erscheint. Die Leute in der Hasenauerstraße 67 dürfen nicht ahnen, was er vorhat, aber Herrn Czibilsky sagt er es. Der wohnt erstens ganz woanders, zweitens haben sie seinen Bruder in der Zone bei der großen Kollektivierung gräßlich gepiesackt, weil er nicht gleich jubelnd in eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft eintreten wollte, drittens hat Czibilsky also eine Riesenwut auf die Roten, und viertens ist er enorm geldgierig. Das hilft natürlich am meisten.
»Sie geben mir Vollmacht, alle Verhandlungen bei Behörden und mit Firmen über den Umbau Ihrer Wäscherei zu führen. Die Arbeiten werden spätestens Ende August abgeschlossen sein. Bis dahin bieten Sie den Laden niemandem zum Verkauf an. Wir renovieren ihn vollkommen – es kostet Sie keinen Groschen. Im Gegenteil: Sie erhalten noch zweitausend Mark von mir, sobald wir das alles schriftlich fixiert haben. Wenn Sie jedoch. ein Wort darüber verlieren, was in Ihrem Keller wirklich geschieht …«
»Nun machense aber’n Punkt, junger Mann, ja? Wollen Sie mir beleidigen? Nach allem, was mein Bruder, der arme Franz, gelitten hat …«
»Also, Sie sind einverstanden?«
Klar ist Czibilsky einverstanden.
Und so kann es am 28. Januar dann losgehen, ganz öffentlich.
GESCHLOSSEN WEGEN TOTALUMBAU steht auf breiten Papierstreifen, die quer über den Auslagescheiben der Wäscherei kleben. TOTALUMBAU – das ist ein wichtiges Wort. Immerhin wird es ein halbes Jahr dauern, bis der Tunnel fertig ist. Eine gewöhnliche Renovierung würde nie so lange dauern. Ein Totalumbau – neues Geschäft, neuer Wäschereibetrieb, alles neu – das ist etwas anderes! Das kann so lange dauern. Sieht jeder ein, nicht wahr? Auch die Vopos …
Ah, und total umgebaut wird! Junge Männer in Overalls, Windjacken, Pullovern und Pelzjacken erscheinen mit Werkzeugen. Ein Kleinbus bringt Material: Holz, Farben, Beton, Maschinen.
Wie die im Geschäft herumwerken, den Fußboden herausreißen, neue Wände ziehen, Kabel legen! Alle Leute, die im Hause zu tun haben oder da wohnen, sehen es. Und ab und zu sieht es sicherlich auch ein Volkspolizist. Aus einem Fenster der Häuser auf der anderen Straßenseite. Die Häuser auf der anderen Straßenseite sind nämlich in der Hasenauerstraße so etwas wie der Mauerersatz. Quer durch die Riesenstadt läuft die Mauer, mit Stacheldrahtverhauen, Wachttürmen, Betonsperren, Stahlbarrieren, Sichtblenden, Scheinwerfern und Stolperdrähten. Tja, aber manchmal ist gerade eine Häuserfront die Grenze des Demokratischen Sektors, oder sie läuft durch die Spree oder den Wannsee. Im Wasser kann man keine Mauer bauen. Da patrouillieren Tag und Nacht Motorboote der Volksarmee. Wenn eine Häuserfront das Pech hatte, an der Grenze zu liegen, dann wurden alle Türen und Fenster vermauert. Weil es ja doch die einfachste Sache von der Welt gewesen wäre, aus den Haustoren zu gehen oder aus den Fenstern zu springen – in den Westen. Das war in der ersten Zeit tatsächlich auch die große Masche.
Nicht lange. Am 24. September 1961 wurden allein auf der Ostseite der Hasenauerstraße 2000 Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert. Heute sind 50 Hauseingänge, 67 Läden und 1235 Fenster vermauert – auf einer Strecke von 750 Metern.
Wie jede Straße, so hat natürlich auch die Hasenauerstraße Kreuzungen mit anderen Straßen. Die sind jetzt keine Kreuzungen mehr. An der Ostseite verbindet die richtige Mauer zwei vermauerte, leere Häuser. Auch auf den Dächern dieser Gespensterhäuser hat man Drahtsignalsperren und Stolperdrähte angebracht. Damit keiner, juppheidi, juppheida, vom Dach eines fünf- oder sechsstöckigen Gebäudes springt.
So ein Gespensterhaus ist Mottlstraße 35. Kein Mensch wohnt mehr darin. Erst wieder in 34 und 171. Bei manchen Fenstervermauerungen fehlt ein Ziegel. Das ist keine Schlamperei! Das sind Sehschlitze. Durch sie beobachten Vopos von Zeit zu Zeit Leben und Treiben auf der Westseite der Hasenauerstraße. Ab 28. Januar können sie sehen und lesen, daß da die Wäscherei Czibilsky umgebaut wird. Total.
Nach Rücksprache mit dem kleinen Herrn Fanzelau baut Mittenzwey den Laden tatsächlich um. Hypermodern! Czibilsky ist selig und läßt sich nicht blicken.
Selbstverständlich arbeitet nur ein Teil von Mittenzweys Crew im Laden, die meisten schuften im Keller. Schichtweise. Ohne Pause. Ursprünglich hatten sie eine Tiefe von siebzehn Metern unter der Erdoberfläche für den Tunnel geplant. Damit wäre er nämlich außerhalb der Reichweite aller Horchgeräte gewesen. Als sie im Keller aber einen zwölf Meter tiefen Schacht gegraben haben, bricht plötzlich Wasser ein. Der Schacht droht einzustürzen.
Die jungen Arbeiter und Studenten hetzen sich ab wie irre. Sie füllen den Schachtgrund mit Holz und Sandsäcken auf und stützen die Wände ab. Alles im eiskalten Wasser. Jeder einzelne muß immer wieder an einem Stahlseil in die Tiefe hinabgelassen oder heraufgeholt werden. Endlich haben sie den Wassereinbruch besiegt. Nun beginnen sie, horizontal zu buddeln, Richtung Osten. Der Tunnel soll unter der Hasenauerstraße und den Kellern des Hauses gegenüber verlaufen – bis in den Hinterhof von Mottlstraße 35. Da will man dann schräg aufwärts stoßen.
Nachdem sie zwanzig Meter weit gegraben haben, zeigen sich Folgen von Sauerstoffmangel. Mittenzwey kennt das. Aber diesmal ist es besonders schlimm. Ein paar Leute brechen zusammen, alle leiden unter rasenden Kopfschmerzen, und zuletzt gehen den Männern, die in den Schacht hinabgelassen werden, die Zigaretten bereits aus, wenn sie die Schachtsohle erreichen. Ein Exhaustor mußte her, um Frischluft in den Tunnel zu pumpen!
Den Exhaustor bringt Barbara Mittenzwey. Elegant gekleidet, in einem geliehenen Leopardenmantel, geschminkt und kokett, so fährt sie eines Tages im Februar mit dem Taxi vor.
Das Ganze war Mittenzweys Einfall. Immerhin, wenn so ein Laden umgebaut wird, dann erscheint doch von Zeit zu Zeit der neue Besitzer, um nach dem Rechten zu sehen, nicht wahr? Ist der Besitzer eine schöne, junge Frau, wird sein Besuch zur optischen Annehmlichkeit für alle. Auch für die Vopos. Und gerade eine Wäscherei kann sehr gut eine Besitzerin haben.
Überlegte Mittenzwey.
Aber kenne einer das menschliche Herz! Sage einer voraus, was Menschen denken werden!
Zuerst geht alles gut: Der Chauffeur schleppt die schwere Kiste mit dem Exhaustor in die Wäscherei, und keiner beachtet ihn, denn Barbara Mittenzwey führt inzwischen auf der Straße vereinbarungsgemäß ein ganz hübsches Theater auf: Lächeln, Flirten, Blicke schmeißen, Arbeiter befragen.
Viele Leute sehen dieses Theater – hauptsächlich Geschäftsleute, Tipsen und Ehefrauen, es ist Vormittag, und die Männer sind weg, die im Hause wohnen. Bei Heisterbergs, im vierten Stock, rührt sich vormittags meist überhaupt nichts, nur manchmal erscheint der Volkswagen des Wirtschaftsredakteurs, und Egon Heisterberg rennt die Treppen hoch, weil er irgend etwas vergessen oder zu erledigen hat …
Na schön, einmal kann so was Aufgedonnertes, Nuttiges ja herkommen, finden die Damen, die im Hause wohnen. Neue Besitzerin der Wäscherei ist die natürlich nie! Viel zu jung! Aber vielleicht eine Verwandte? Sollte sie im Laden als Angestellte auftauchen, wird man sie schon weggraulen, darüber sind die Damen sich einig. Das ist und war immer ein anständiges Haus. Und wenn die Herren Ehemänner so etwas sehen – kommt ja gar nicht in Frage! Alle Ehen in Nummer 67 sind vorbildlich. Bis auf die – na ja, traurig, traurig, bis auf die von Heisterbergs natürlich.