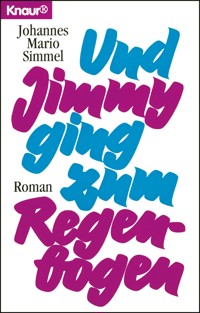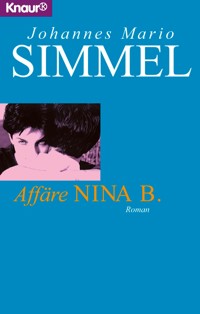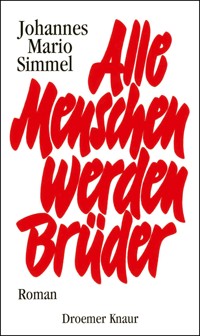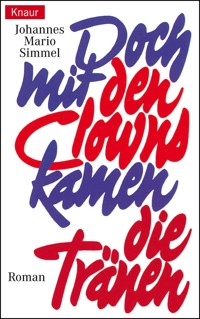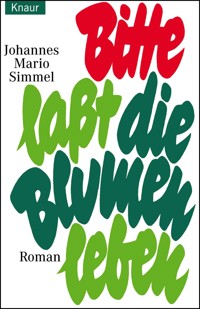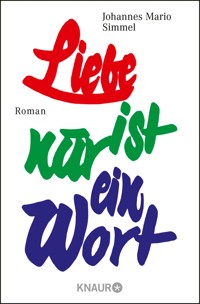
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte einer großen Liebe, aufgezeichnet von Oliver Mansfeld, einundzwanzig Jahre alt, Sohn eines Schiebermillionärs, Schüler eines Internats im Taunus. Er erzählt die Geschichte, um »aller Welt ohne Furcht und Scham die Wahrheit zu sagen« - die Wahrheit über seinen Vater, den er hasst; die Wahrheit über seine, Olivers, Liebe zu der schönen Verena Lord, die ihren Mann, den großen Bankier, betrügt und für die Liebe »nur ein Wort« ist; die Wahrheit über die Menschen, die Olivers Liebe zu Verena zunichte machen wollen: den heimtückischen, bösen Krüppel Hansi, die mannstolle Geraldine, den erpresserischen Diener Leo und den so nobel auftretenden Bankier Lord.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 893
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Johannes Mario Simmel
Liebe ist nur ein Wort
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Dies ist die Geschichte einer großen Liebe, aufgezeichnet von Oliver Mansfeld, einundzwanzig Jahre alt, Sohn eines Schiebermillionärs, Schüler eines Internats im Taunus. Er erzählt die Geschichte, um »aller Welt ohne Furcht und Scham die Wahrheit zu sagen« – die Wahrheit über seinen Vater, den er hasst; die Wahrheit über seine, Olivers, Liebe zu der schönen Verena Lord, die ihren Mann, den großen Bankier, betrügt und für die Liebe »nur ein Wort« ist; die Wahrheit über die Menschen, die Olivers Liebe zu Verena zunichte machen wollen: den heimtückischen, bösen Krüppel Hansi, die mannstolle Geraldine, den erpresserischen Diener Leo und den so nobel auftretenden Bankier Lord.
Inhaltsübersicht
Prolog
Das Manuskript: Erstes Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Zweites Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Drittes Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
22. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Viertes Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Fünftes Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Sechstes Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Siebtes Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Achtes Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Neuntes Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Epilog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Prolog
Das erste Wort, das der Schnee unsichtbar werden ließ, lautete »… niemals …«. Das zweite Wort, das verschwand, lautete »… immer …«.
Das Blatt, auf dem die Worte standen, war unter einen Holzsplitter geglitten, der aus dem Boden der Turmstube ragte. So widerstand das Papier der Zugluft, die zwischen den Luken des Gemäuers herrschte, Schneekristalle stäubten auf die blutbefleckten Dielen. Die Dielen waren alt, das Blut auf ihnen war noch jung, frisch, feucht und warm. Die Dielen waren so alt wie die schwarzen Dachbalken, die klobigen, unförmigen Mauersteine, die morsche, gleichfalls blutbespritzte Wendeltreppe. Älter als sie alle war der Turm. Viele Jahrhunderte alt. Älter als das Christentum in diesem Lande.
Das Wort »… vergessen …« und, an einer anderen Stelle des Blattes, die Worte »… mit meinem ganzen Herzen …« schneiten jetzt zu, danach der Name, der als Unterschrift den Brief beendete, dessen unregelmäßig verlaufende Zeilen die fiebrigen, fliegenden Züge einer Frauenhandschrift trugen. In großer Eile, großer Angst oder großer Verzweiflung mußte die Botschaft geschrieben worden sein, die der Schnee da begrub, lautlos und leise.
Vor sechzehnhundert Jahren bereits hatte jener Turm nur noch eine Ruine dargestellt. Elfmal war er in den folgenden Zeiten renoviert worden, von hessischen Raubrittern und hessischen Landgrafen, das letztemal von Seiner Allergnädigsten Durchlaucht Wilhelm IX. im Jahre 1804 – dem Wunsche dieses hohen Herrn gemäß in seinem ursprünglichen Stil: Als Wahrzeichen und Aussichtsturm. Nun war das Gemäuer längst schon wieder fast eine Ruine, an deren Fuß eine Tafel den Wanderer warnte:
EINSTURZGEFAHR! BETRETEN VERBOTEN!
Ignorierte man jedoch solcherlei Hinweise, dann konnte man durch die Luken der Turmkammer weit, weit hinaus ins Land blicken. Das Flüßchen Nidda sah man, das sich mit schilfbewachsenen Ufern durch Wiesen, Weiden, fruchtbares Ackerland, zwischen Gebüsch und Gruppen silberner Erlen talwärts schlängelte; den Großen Feldberg mit seinen dunklen, weiten Waldrücken; den dreifach gebuckelten Winterstein; im Osten den blauen Zug des Vogelsberges und das Massiv des Hohenrodskopfes, dessen mächtige, dreieckige Wiesenflanke im Sonnenlicht magisch aufleuchtete inmitten nachtschwarzem Baummeer; kleine und kleinste Dörfer, Burgen, Gehöfte, schwarze und hellbraun gefleckte Kühe daneben konnte man sehen, und Eisenbahnen, die sich, melancholisch pfeifend, fern im Dunst verloren. Bad Nauheim und Bad Homburg vermochte man wohl zu erblicken, wenn das Wetter schön war, Bad Vilbel, Königstein, Dornholzenhausen, Oberursel, ja, all dies und hundert andere Stätten menschlicher Gemeinschaft, deren größte Frankfurt war, Frankfurt am Main.
Nun hatte längst die Nacht begonnen, und Dunkelheit lag über allem. Gleichwohl, und wenn es heller Tag, gewesen wäre: Keine zwei Meter hätte man ins Land hinauszusehen vermocht, denn ein ungeheurer Schneefall sank seit drei Stunden nieder aus drohend düsteren Wolken.
So dicht schneite es in dieser Nacht, daß es war, als bestünde die Luft selber aus Schnee, als gäbe es überhaupt keine Luft mehr, sondern nur noch ein atemraubendes, alles Leben erstickendes und dabei doch nicht einmal zu greifendes, nicht einmal zu benennendes Medium, schwerelos und lastend schwer zugleich, aus der Unendlichkeit des Himmels kommend und also ohne Grenzen, ohne Ende, ein Treiben von Abermilliarden Flocken, welches die Finsternis erhellte, die Dunkelheit erbleichen ließ. Schon waren Straßen und Wege verlegt, schon brachen schwere Äste ächzend unter der Last des Schnees. Und dabei schneite es erst seit drei Stunden. In zwei Tagen sollten die ältesten Leute weitum sich an einen solchen Schneefall zu ihrer Lebenszeit nicht mehr erinnern können. Nein, keine zwei Meter hätte der Wanderer auch im Licht des Tages bei derart wüstem Treiben sehen können aus des Turmes Luken, die doch, bei schönem Wetter, hoch über den höchsten Baumwipfeln des Taunus, den Weg so weit, so weit ins Land freigaben.
Es war der ideale Ort für einen solchen Turm. Dieser Ansicht mußte schon zehn Jahre vor Christi Geburt der römische Feldherr Drusus gewesen sein, als er hier eine Befestigungslinie gegen die Germanen anlegen ließ. Der gleichen Ansicht mußte knapp hundert Jahre später der römische Kaiser und Feldherr Domitian gewesen sein, als er seinen Legionen befahl, mit dem Bau des Limes zu beginnen, der, über Berge und Schluchten hinweg, an Hünengräbern und Mooren vorüber, durch Auen und Wälder, eine fünfhundertundfünfzig Kilometer lange befestigte Grenze, die »befriedeten« Provinzen Obergermanien und Rätien schützen sollte. Die Kaiser Trajan, Hadrian und Antoninus Pius hatten das gewaltige Bauwerk zwischen Rhein und Donau fortgesetzt, zuerst mit Wällen und Pfahlgräben, danach mit mehr als eintausend Wachttürmen und über hundert Kastellen. Gut zu erkennen waren an vielen Stellen noch immer die Reste dieser gewaltigen Anlage, die errichtet worden war dereinst, von machtlosen Menschen gegen machtlose Menschen, auf Befehl der großen Machthaber und Menschenschlächter.
Ein Paar braune, pelzgefütterte Schuhe wanderten über dem Blatt hin und her. Sie hingen frei in der Luft, die Schuhe, und sie bewegten sich langsam, manchmal berührten sie einander sanft, jetzt und jetzt. Und jetzt nicht.
»… il nostro concerto …« Schnee lag bereits zentimeterhoch über diesen Worten, und über diesen auch: »… Porto Azzurro …« Flocken sanken herab auf manche feuchte Blutstelle der Dielen, machten sie rosenrot, rosig, hellrot, machten sie weiß. Immer mehr Blutspuren und immer mehr Worte verschwanden unter dem Schnee. Das Blut ließ er unsichtbar werden, die Tinte zerfließen, die Botschaft vergehen. Sie hatten keine Eile, die Flocken, und auch die festen Winterschuhe nicht.
Einen geruhsamen Viertelkreis beschrieben sie über dem Brief. Aus nördlicher Richtung wanderten ihre Spitzen nordnordöstlich gegen Osten hin. Hier erlahmte der Schwung, den die Zugluft ihnen verlieh. Sie pendelten zurück. Nordnordost. Nord.
»… ich schwöre Dir …«
Zerflossen die Worte, begraben der Schwur.
Die Schuhe des Erhängten pendelten über die Stelle daneben: »… bei meinem Augenlicht …« Diese Worte verschwanden zwei Minuten später.
Nord. Nordnordost Ost.
Auch auf den Schuhen und den Kleidern setzten die Flocken sich fest. Der Tote hing von einem dunklen Dachbalken herab, einen alten Strick um den Hals. Es gab viel Gerümpel in der Turmstube, zerbrochene Stühle, moderndes Holz, rostendes Werkzeug.
Milchigdunkel, diffus war das Licht hier oben, und keinen Laut hätte man vernommen (denn der majestätische Schnee kam stille, stille, er betrug sich, wie sich all jene betragen, die gar gewaltig Macht besitzen und wissen, daß sie tun und lassen können, was auch immer sie belieben), nein, keinen Laut hätte man vernommen, wären da nicht die kleinen Mäuse gewesen, die, hungrig und frierend, ruhelos geraschelt hätten unter den Seiten einer alten Zeitung, wo sie Schutz suchten vor der grausamen Kälte der Nacht.
Die Zeitung lag fernab des Toten, in einer Ecke der Stube, geschützt solcherart vor dem Schnee. Aufgeschlagen war sie, und ihr Titel lautete:
ANZEIGER DES REICHES DER GERECHTIGKEIT
MENSCHENFREUNDLICHE ZEITUNG FÜR JEDERMANN
ZUR MORALISCHEN UND SOZIALEN HEBUNG
VERLEGER:
DER ENGEL DES HERRN, FRANKFURT AM MAIN
Die Mäuse raschelten.
Erfroren, zusammengekrümmt und schwarz hingen Spinnen in zerstörten Netzen.
»… die Fischerboote mit den blutroten Segeln, blutrot im Sonnenuntergang …«
Verschwunden.
»… der Wein, den wir tranken im Hafen von Marciana Marina …«
Zerflossen.
»… unsere Bucht, die grünen Wellen, in denen wir einander umarmten …«
Vergangen. Vorbei.
Das junge Gesicht des Erhängten war blutverschmiert und zeigte Wunden, um die das Blut in der Kälte zu Krusten erstarrte. Auch auf die Wunden sanken die Flocken, auf das kurzgeschnittene braune Haar, in die offenen braunen Augen mit den riesig geweiteten Pupillen. Aber die Flocken schmolzen noch fort, dort, wo sie Haut und Haar und Augäpfel berührten. Der Tote konnte noch nicht lange tot sein. Es war noch Wärme in ihm.
Die starren, blicklosen Pupillen machten die kleine, end- und ziellose Reise der Schuhe mit, der ganze Körper machte sie, die Reise. Ost. Nordnordost. Nord.
Und wieder zurück.
Nord. Nordnordost. Ost.
Blutig waren die schmalen Hände des Erhängten, aufgeschlagen die Knöchel. Blutig und an mehreren Stellen zerrissen waren der dicke Rollkragenpullover, die graue Keilhose. Auf dem Pullover, auf den Schuhen, auf den Hosen blieb der Schnee schon liegen, denn sie waren kalt, so kalt wie auch der Körper des Erhängten bald schon sein würde. Kalt genug für die Flocken.
»… unsere erste Begegnung …«
Ost. Nordnordost. Nord.
»… unser erster Kuß …«
Nord. Nordnordost. Ost.
Und sie zerflossen, sie vergingen, all diese zärtlichen Worte, unter dem zärtlichen Druck des Schnees, der sie vergehen ließ, verschwinden, alle, alle …
Der Tote war etwa zwanzig Jahre alt, sein Körper der eines großen Jungen, schlank und wohlgewachsen. Ob er gut ausgesehen hatte im Leben, vor ein paar Stunden noch? Nun sah er grausig aus. Jetzt quoll die Zunge aus einem vor Stunden noch vielleicht sensiblen, vielleicht sinnlichen, nun verzerrten Mund, geschwollen, blau und scheußlich. Und Schneekristalle fielen auf sie und zergingen, denn auch die Zunge war noch warm.
Der da jetzt hing, er hatte die Geschichte des Limes wohl gekannt, hatte gewußt, daß dieser Aussichtsturm einst erbaut worden war von römischen Soldaten, die ihre Oberen, siegestrunken, machtberauscht, aus dem heiteren Süden und der Wärme ihrer Heimat hier heraufgehetzt hatten, in diesen eisigen, dunklen Norden. Vor den Weihnachtsferien war man in der Klasse des Toten darangegangen, bei Tacitus nachzulesen, was dieser über die Entstehung der Türme und ,Kastelle zu berichten wußte. (Tacitus, Cornelius, größter römischer Geschichtsschreiber, geb. um 55, gest. um 116 nach Christi Geburt. War Prätor, dann Konsul, später Statthalter der Provinz Asia. Schrieb die »Germania« – die erste Völkerkunde Germaniens –, die »Historiae« und die »Annalen«. Knüpfte in Stil, Komposition und pessimistischer Grundhaltung an Sallust an und versuchte, das Handeln der Herrschenden durch Erfassung psychologischer Momente zu erklären.)
All dies war dem Toten bekannt gewesen. Der in der helldunklen Nacht da hing, Strick um den Hals, und langsam kälter wurde, kälter, steifer, hatte – sich auf sein Abitur vorbereitend – wenige Wochen noch vor seinem Ende diese Worte des Cornelius Tacitus übersetzt: »Vier Legionen übergab also der Germanicus dem Caecina, fünftausend Mann Hilfstruppen und dazu in aller Eile zusammengeraffte Scharen aus den diesseits des Rheins wohnenden Germanen. Die gleiche Zahl Legionen, die doppelte an Bundesgenossen nahm er selbst mit sich. Auf den Überresten der Befestigungen seines Vaters Drusus auf dem Berge Taunus errichtete er neue Anlagen, Wälle, Pfahlbauten, Wachttürme und ein Kastell …«
Der Leichnam pendelte.
»… Du meine Seele, Du mein Atem …«
Es gab kein Wort, mit dem sie nicht fertig wurden, die Flocken. Unter der alten Zeitung raschelten die kleinen, frierenden Mäuse. Krachend wie eine explodierende Bombe brach irgendwo draußen in der weißen Sintflut wieder ein Ast. Und weiter schneite es, heftiger von Minute zu Minute, lautlos und unaufhörlich. Der Schnee war gekommen wie eine schwere Krankheit, Lähmung, Last, wie eine Plage, eine Heimsuchung, der man nicht entfliehen, der man sich nicht widersetzen konnte, sondern sich ergeben mußte wie dem Tod.
»Oliver, mein geliebter Oliver …«
Nun war auch diese Zeile verschwunden, mit welcher der Brief begonnen hatte. Die Schuhe wanderten über sie hinweg. Kläglich pfiffen die Mäuse. Eine Uhr am blutigen Handgelenk des Toten zeigte die Zeit. Es war 21 Uhr 34. Wieder pendelte der Körper zurück. Der Schnee erreichte die letzten noch unbedeckten Worte. Er hatte keine Eile, sie zu zerstören, er tat es sanft, behutsam, zärtlich. Doch er zerstörte sie. Nun waren sie verschwunden. So hatten sie gelautet: »… Liebe meines Lebens …«
Zu dieser Zeit – 21 Uhr 35 am 7. Januar 1962 – ertönte aus zahlreichen Lautsprechern in der zugigen, eiskalten Abfahrthalle des Frankfurter Hauptbahnhofs eine heisere, erkältete Männerstimme: »Achtung, bitte, auf Gleis 14! Der Fernschnellzug Paris-Expreß aus Paris nach Wien über Karlsruhe, Stuttgart, München, Salzburg und Linz fährt ab. Bitte vom Zug zurücktreten und die Türen schließen. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.«
Die letzten Türen des D-Zuges flogen zu. Sacht ruckte die Diesellokomotive an. Räder begannen zu rollen, schneller und schneller, Achsen schlugen. Der lange Zug fuhr in das nächtliche Schneetreiben hinein und war schon Sekunden später von ihm verschluckt.
Der Paris-Expreß führte drei Schlafwagen mit sich, den dritten als letzten Waggon des Zuges. In einem Einzelabteil erster Klasse dieses Wagens stand ein großer, schwerer Mann von achtundfünfzig Jahren. Er starrte den Sekundenzeiger einer altmodischen goldenen Repetieruhr an, die auf der Mahagoniplatte des geschlossenen Eckwaschtisches lag, und zählte seine Pulsschläge. Es waren sechsundachtzig in einer Minute.
Der dicke Mann verzog den kleinen, runden Mund zu einem wehen Lächeln, dem Moribunden gleich, der wohl weiß, daß er den nächsten Tag nicht mehr erleben wird, jedoch dahinzugehen gedenkt in Einsamkeit und Würde. Er ächzte schwer, betrachtete im Spiegel über dem Waschtisch sorgenvoll die Zunge, als trüge sie einen schwarzen Pestilenzbelag (sie war aber ganz gesund blassrot), ächzte wiederum und entnahm sodann einem kleinen altmodischen Koffer, der auf dem Bett lag, eine silberne Dose, in der sich Medikamentenfläschchen, Pillenröhrchen und Arzneischächtelchen aller Art sowie ein Fieberthermometer befanden. Die Schatulle trug die Initialen A. L.
Der Fettleibige mit der gesunden, rosigen Gesichtsfarbe, dem allzu langen ergrauenden Blondhaar und dem noch völlig blonden großen Schnurrbart, den er nach der Art des von ihm verehrten Albert Schweitzer trug, traf seine Wahl sorgfältig. Albert (Albert!) Lazarus schluckte zwei Pillen, zwei rote, längliche Kapseln, und trank Wasser nach, das er zuvor aus einer mitgebrachten Sprudelflasche in einen mitgebrachten Kunststoffbecher gegossen hatte. Er führte stets Selterswasser in Flaschen mit sich, er mißtraute allem Wasser, dessen Herkunft er nicht kannte, allen fremden Gläsern und allen fremden Toiletten, wogegen sich im letzteren Fall zu seinem Leidwesen nichts tun ließ.
Nun zog er umständlich, dabei andauernd seufzend, seinen altmodischen Anzug aus, den er absichtlich so groß hatte anfertigen lassen, daß er selbst an seinem mächtigen Körper noch lose schlotterte und Falten warf – gleich jenen Beinkleidern und Lüsterjacken, die der Mann aus Lambarene bevorzugte. In der Tat ging des Albert Lazarus’ Verehrung für den großen Menschenfreund im fernen Afrika so weit, daß er ihn nicht nur in Sprechweise und Kleidung nachahmte, sondern sich sogar bei den verschiedensten Behörden zu immer der nämlichen wissentlichen, willentlichen und darum strafbaren Handlung hatte hinreißen lassen.
»Ihr Name?« So hatte man ihn oft von Amts wegen gefragt.
»Albert Lazarus.« So hatte er dann stets geantwortet. Und dabei hieß er, der Wahrheit die Ehre, laut Eintragung im allerdings fernen (und zum Glück seit längerem unerreichbaren) Geburtenregister des Standesamtes III in der Stadt Leipzig Paul Robert Wilhelm Albert Lazarus. Solches verschweigend, hatte er zeit seines Lebens Albert zum Hauptrufnamen erkoren. Albert Lazarus spielte auch auf dem Harmonium, einem kleinen, das in seine Wohnung paßte, und er verehrte Bach …
Sorgsam hängte er den Anzug über einen Bügel des Abteils und zog sich weiter aus. Er trug eine Selbstbinderkrawatte, in deren schon glänzendem Knoten eine echte Perle saß, ein Hemd mit steifem Kragen, steifen Manschetten, dem gestickten Monogramm A. L. und lange, wollene Unterhosen. Alle diese Kleidungsstücke verwahrte er pedantisch. Ein Paar handgestrickte Kniestrümpfe streifte er nicht ab. Die Haut seines fetten Körpers war so rosig und rein wie die des Gesichtes, wie die eines Säuglings.
Nun zog er ein weißes Nachthemd an, das man am Halse mittels zweier rosaroter Kordeln schließen konnte. Das Nachthemd reichte bis zu seinen Füßen, besaß einen feinen rosaroten gestickten Saum und, über der Brust, wiederum das Monogramm A. L. Dem Koffer entnahm der Fettleibige eine große Bonbonniere und einen umfangreichen schwarzen Leitzordner. Stöhnend wuchtete er sodann das keineswegs schwere Gepäckstück in den Aluminiumträger über dem Fenster empor. Einen Waschbeutel beließ er darin. Er hatte nicht die Absicht, das Becken des Abteils zu benützen. Wer wußte, wer es vor ihm benützt hatte? Wer zählte die Mikroben, die sich in der Porzellanschüssel, im Zahnputzglas tummelten? Dem dicken Mann wurde schon übel, wenn er bloß daran dachte. Er wusch sich nie im Schlafwagen.
Jetzt überprüfte er, ob es durch die Kittstellen des Fensters auch nicht zog, befestigte zur Sicherheit noch den schwarzen Glanzstoffvorhang vor der spiegelnden Scheibe und stellte den Regler des Zentralheizungskörpers von »½« auf »Voll«, obwohl trockene Hitze im Abteil herrschte. Die Bonbonniere öffnete er, betrachtete mit plötzlich aufleuchtenden Augen ihren Inhalt und steckte eine Cognackirsche in den Mund. Die goldene Repetieruhr hängte er an den grünspanbefleckten Messinghaken über der samtgepolsterten kreisrunden Stelle der Mahagoniwand neben dem Kopfkissen, woselbst in den letzten vierzig Jahren gar viele Uhren gehangen haben mochten. Der Schlafwagen harmonierte mit dem Mann, der ihn benützte: Er war so altmodisch wie er. Sollte dieser in zwei Jahren verschrottet werden, so wollte jener in zwei Jahren in Pension gehen.
Albert Lazarus war seit einunddreißig Jahren Lektor eines großen Frankfurter Verlages, seit zwölf Jahren Cheflektor. Er hatte nie geheiratet. Er besaß keine Kinder. Er mochte Kinder nicht. Er war ambitionslos, gutmütig, menschenscheu und davon überzeugt, todkrank zu sein. Er war, in Wahrheit, kerngesund, wenn man von einem völlig unbedeutenden Leberleiden absah, das er zudem allein dem völlig unvernünftigen und unverordneten, ja ärztlich verbotenen Konsum gigantischer Mengen von Medikamenten aller Art und einer noch unvernünftigeren Art der Ernährung verdankte. Albert Lazarus war ein bedürfnisloser Mensch. Geld interessierte ihn ebensowenig wie Frauen oder Karriere. Eine einzige Leidenschaft hielt ihn in ihren Klauen: Süßigkeiten! Morgens aß er Pudding zum Frühstück, abends trank er heiße Schokolade. Wenn er im Verlag arbeitete, suchte er Mittag um Mittag eine nahe Konditorei auf und verspeiste dort Jahr um Jahr, Tag um Tag immer drei verschiedene Tortenstücke, riesige, cremereiche, giftigbunte, wobei er nie die Schlagsahne vergaß.
Sein Verleger kannte alle Schwächen des Albert Lazarus. Er wußte, daß er den größten Hypochonder der großen Stadt Frankfurt zum Cheflektor hatte – und dazu einen unbestechlichen Kritiker eingereichter Manuskripte, einen Mann, der in drei Jahrzehnten immer wieder neue Begabungen entdeckt und gefördert und dem Verlag größere Dienste erwiesen hatte als irgendein anderer Angestellter.
Der Verehrer des berühmten Humanisten und Arztes stellte die Bonbonniere auf den roten Teppich neben das Bett, schaltete die Deckenbeleuchtung des Abteils aus und die Leselampe über dem Bett an, lockerte die festgestopften Decken und kroch ächzend unter sie. Er angelte nach dem Leitzordner, der zu seinen Füßen lag. Ehe er ihn öffnete, wählte er aus der Bonbonschachtel noch ein Schokoladenstück mit einem gräßlich-grünen Pistaziensplitter darauf aus und steckte es in den Mund, dabei murmelnd: »Gift. Reines Gift für mich.« Er schluckte, preßte eine Hand gegen sein Herz und verspürte keinerlei Schmerz. Das schien ihn zu ärgern, denn er machte ein zorniges Gesicht. Und zornig schlug er den Ordner auf, der ein dickes Manuskript enthielt. Auf der Seite unter dem Deckblatt stand:
Wer immer dieses Buch liest:
Mein Name ist Oliver Mansfeld. Ich bin 21 Jahre alt und Sohn des Walter Mansfeld …
Der dicke Mann ließ das Manuskript sinken.
Oliver Mansfeld?
Ein Stück Nougat. (Ich werde ohnedies nicht mehr die nächsten Weihnachten erleben. Wir stehen alle in Gottes Hand.)
Sohn des Walter Mansfeld …
Von Oliver Mansfeld wußte Albert Lazarus nichts, der junge Herr hatte sich bislang weder literarisch noch auf anderem Gebiet hervorgetan. Sein Vater Walter jedoch war fast jedem erwachsenen Menschen der Bundesrepublik bekannt als Urheber eines der größten Skandale der Nachkriegszeit.
Ein Stückchen Krokant.
Lazarus lutschte hingegeben. Der Zug fuhr jetzt sehr schnell, die Achsen schlugen gehetzt. Hm. Der Sohn dieses Lumpen hatte also einen Roman geschrieben. So, so. Lazarus sah auf dem Deckblatt des Leitzordners nach. Danach war das Manuskript am 20. Dezember 1961 im Verlag eingetroffen und natürlich – Schlamperei von der Meyer, der werde ich etwas erzählen, wenn ich zurückkomme – über Weihnachten und Neujahr liegengeblieben. Erst gestern vormittag hatte diese Meyer, der man etwas erzählen würde, wenn man zurückkam, einem das Manuskript in die Hand gedrückt mit den Worten: »Vielleicht können Sie es sich auf Ihrer Reise ansehen, Herr Lazarus«.
Der Frankfurter Verlag besaß Zweigstellen in Wien, Berlin und Zürich. Lazarus sollte am Montag, dem 8. Januar 1962, einige geschäftliche Besprechungen in Wien führen. Die Fahrt dorthin dauerte etwa zwölf Stunden. So hatte er, da er gerne nachts las, das Manuskript mitgenommen.
Nun sehen wir (vielleicht eine Cognackirsche) … sehen wir also, was der junge Herr zu sagen hat.
Ich möchte Schriftsteller werden. Dieses Manuskript stellt einen ersten Versuch dar. Ich kenne selber am besten die Schwächen des Buches, das aus Gründen, die dem Lektor ohne Kommentar einleuchten werden, kein Schlußkapitel besitzt. Das vorliegende Manuskript ist ein (noch) unverschlüsselter Schlüsselroman …
Ein (noch) unverschlüsselter Schlüsselroman.
Lazarus überlegte:
Entweder ist dieser junge Herr sehr naiv oder sehr raffiniert. Kleine Sensationshascherei? Rache am Väterchen? Interesse des Lektors wecken? Lazarus kannte viele Tricks vieler Schriftsteller. Immerhin, das war einmal etwas Neues.
Ich glaube, daß jeder Autor in seinem ersten Buch fast ausschließlich persönliche Erlebnisse verwertet, die ihn sehr erschüttert haben …
Gift, reines Gift für mich. Lazarus steckte eine gefährlich mit Nußsplittern armierte Praline in den Mund.
So ist auch mein Buch entstanden, vielleicht sollte ich besser sagen mein Tagebuch, denn das ist es in der gegenwärtigen Form wohl eher noch. Weder die Namen der agierenden Personen noch die Schauplätze der Handlung noch die Handlung selbst wurden verändert. Was auf den folgenden Seiten steht, ist die Wahrheit …
Na fein. Jetzt ist ein Nußstückchen in den hohlen Zahn geglitten; es stand ja zu erwarten.
… die Wahrheit, wie ich sie erlebte.
Was weißt du schon von der Wahrheit, Bubi?
Ein Tagebuch gibt man nicht ohne weiteres aus der Hand, besonders, wenn es so private und intime Eintragungen enthält wie dieses. Noch weniger hat man gemeinhin den Wunsch, es gedruckt verbreitet zu sehen. Ich habe diesen Wunsch, und ich reiche mein Manuskript ein mit der ausdrücklichen Billigung jener Frau, für die es geschrieben wurde. Diese Frau und ich lieben einander. Mein Roman ist die Geschichte dieser Liebe …
Gott sei Dank, jetzt habe ich den Splitter mit der Zunge wieder herausbekommen. Wozu soll ich mich noch zum Zahnarzt schleppen, der ich das nächste Frühjahr kaum erleben werde? Aber keine Nuß mehr, lieber ein Stückchen Marzipan …
… und es ist uns gleichgültig, was andere Menschen denken. Wenn es nach uns beiden ginge, müßte weder ihr noch mein Name verändert werden. In einer Stunde bringen wir dieses Manuskript gemeinsam zur Post und schicken es an Ihren Verlag ab, denn wir haben einen Entschluß gefaßt, der es mir gestattet, nun ohne jede Furcht und ohne jede Scham aller Welt die Wahrheit zu sagen …
Mit der freien Linken strich Lazarus die herabhängende breite linke Schnurrbartspitze, wodurch ein Stückchen Schokolade auf die Bettdecke fiel, und grunzte. Ohne jede Furcht und ohne jede Scham. Na also. Nun wissen wir es endlich: Pornographie.
Der Kleine hat sich umgetan und festgestellt, daß dies das Jahrhundert der Pornographien ist. Der feinen, versteht sich, die in feinen Verlagen erscheinen. In einem wie unserem beispielsweise. Nur daß bei uns noch keiner erschienen ist.
Es liegt nicht an meinem Verleger, es liegt an mir. Ich habe noch nichts Rechtes gefunden. Mein Verleger: Ein fortschrittlicher Mann. »Moderne Literatur – das ist Sauerei«, sagt er. »Oder man macht pleite. Sehen Sie sich das an! ›Lady Chatterley‹! ›Lolita‹! Daneben kann man sich natürlich allerlei Hochgestochenes leisten. Und dann Sachbücher! Sachbücher gehen immer. Aber Fiction? Ich frage Sie, Lazarus, wozu bezahle ich Sie eigentlich? Damit Sie hier jahraus, jahrein auf Ihrem dicken Hintern sitzen und mir Ihre Dichter andrehen wollen?« So redet er, ein moderner Mensch. Ich bin altmodisch. Ich finde, es würde auch immer noch ohne Pornographie gehen. Schuld an allem ist Hemingway. Der hat damit angefangen. Aber bei dem haben sie von den schlimmsten Wörtern nur den ersten und den letzten Buchstaben gedruckt und dazwischen Punkte. Heute drucken sie die ganzen Wörter.
Auf der anderen Seite: Er war immer gut zu mir, mein Verleger. Ich habe mein Leben bei ihm verbracht. In zwei Jahren verlasse ich ihn, das heißt, wahrscheinlich schon früher. Umständehalber. Er soll dann nicht auf einen Toten schimpfen. Es wäre eigentlich nur Freundespflicht, daß ich ihm noch so ein richtiges, saftiges Ding beschaffe, bevor ich abkratze.
Hoffentlich schreibt der Kleine da auch noch in diesem hingekackten Gefasel, das sie »Inneren Monolog« nennen, ach, ach, und dann bitte, bitte, noch in schlechtem Deutsch und mit falscher Interpunktion! Oder noch besser gar keiner! Dann verkaufen wir ihn als deutschen James Joyce. Als Henry Millers Komparativ. Aber wenn er bloß nicht die Schweinereien abstrakt geschrieben hat! Idioten, die das tun, gibt’s bei uns nämlich gerade haufenweise. (Darum ist mir auch noch nichts Rechtes untergekommen.) Da sitzt die deutsche Hausfrau dann, und wenn sie nicht eine intellektuelle halbstarke Tochter hat, die ihr die Sache erklärt, muß sie an allem verzweifeln, was sie von Anatomie weiß, und sich händeringend fragen: Was ist denn eigentlich hier los? Was macht sie denn mit ihm? Wie viele sind es denn überhaupt? Und die Fremdwörter findet sie auch nicht im Brockhaus …
Aber vielleicht haben wir diesmal Glück.
Albert Lazarus sah nach, wie dick das Manuskript war.
743 Seiten.
19 Mark 80. Billiger werden wir es wohl nicht herstellen können. Aber wenn der Junge vernünftig ist und sich klar ausdrückt, wo er sich klar auszudrücken hat, und wenn er außerdem noch Enthüllungen über diesen Schieber, seinen Vater, macht – können wir glatt Zehntausend als erste Auflage drucken!
Wenn.
Jetzt vielleicht noch ein Stück Nougat.
Manch einer in der Geschichte unserer Liebe wird abstoßend oder so gezeichnet, daß er sich in seiner Ehre gekränkt oder in seinen Gefühlen verletzt sehen könnte …
Da haben wir es. Wieder nichts. Ich wußte es ja.
… vor allem mein Vater und Fräulein Stahlmann, und ich gebe zu, daß es mir tiefe Befriedigung bereiten würde, gerade sie vor aller Welt in ihrer Pervertiertheit und ihren Lastern bloßzustellen und so zu schildern, wie sie wirklich sind.
Ein Hoffnungsschimmer. Der Junge scheint wirklich naiv zu sein. Naivität läßt sich natürlich auch verkaufen. Und erst Naivität mit Pornographie …
Ruhig, ruhig!
Weiterlesen.
Man ist schon allzu oft enttäuscht worden. Dann sind diese Knaben naiv und unanständig und können nicht schreiben. Haben wir alles schon gehabt.
Behalten wir aber die Namen Mansfeld und Stahlmann bei und verändern nur die Namen aller anderen Personen und die Schauplätze der Handlung, dann ist nichts gewonnen. Ich habe gehört, daß jeder Mensch sogenannte Persönlichkeitsrechte besitzt …
Ja, Kleiner, hast du das schon gehört?
… und sich dagegen verwahren kann, in erkennbarer Form als Gestalt eines Romans benützt zu werden, selbst wenn diese Gestalt durchaus positiv und liebenswert gezeichnet ist.
Ich darf keine Bonbons mehr essen, sonst wird mir schlecht. Ach, ich sterbe ohnedies. Leberkrebs. Die Ärzte sagen es mir nur nicht. Noch eine Cognackirsche. Ein komischer Junge ist das. Sicherlich kein Idiot. Und wenn die anderen den »Schlüssel« und das »Ruhekissen« drucken, warum sollen nicht auch wir endlich einmal …
Das ist das Dilemma, in dem ich mich befinde. Ich bitte Sie, meine Herren, die Sie auf dem Gebiet Experten sind, unter diesen Gesichtspunkten mein Manuskript zu prüfen und mich, falls es Ihr Interesse findet, juristisch zu beraten. Ich werde gerne bereit sein, das Buch in der von Ihnen empfohlenen Weise umzuarbeiten. Im voraus danke ich Ihnen für die Mühe der Lektüre. Oliver Mansfeld.
Nougat ist doch am besten, dachte Lazarus. Er blätterte um. Auf der nächsten Seite stand:
LIEBE IST NUR EIN WORT
Roman
Albert Lazarus verspürte ein leichtes Brennen im Magen. Na also, dachte er voller Genugtuung, jetzt ist mir schlecht. Danach begann er zu lesen.
Er las bis gegen drei Uhr früh, dann zog er das Läutewerk der goldenen Repetieruhr, das er auf 7 Uhr 30 eingestellt hatte, auf und putzte seine Zähne mit Mineralwasser. Endlich zerrte er den Glanzstoffvorhang ein wenig zur Seite und blickte in die Nacht hinaus. Der Zug befand sich zu dieser Zeit auf der Strecke zwischen München und Rosenheim. Hier schneite es nicht. Lazarus sah einsame Lichter vorüberhuschen, und er hörte das Sausen des Nachtsturms, der an der Wagenkette des Paris-Expresses rüttelte. Er hatte etwa die Hälfte des Manuskriptes überflogen, »angelesen«, wie das in seinem Fachjargon hieß, und er war plötzlich traurig geworden und ratlos.
Wieder im Bett, analysierte er seinen Zustand. Nicht das Manuskript (seinen Verleger und dessen Ansichten über auflageträchtige Sujets hatte er vollends vergessen) machte ihn so verwirrt. Nein. Dieser Roman war in der Tat ein »Erstling«, an vielen Stellen verbesserungsbedürftig, wenn nicht unbrauchbar, und dazu in einer Sprache abgefaßt, die den Lektor zuerst dermaßen irritiert und abgestoßen hatte, daß er immer wieder versucht gewesen war, den Leitzordner auf den Tisch zu werfen – um dennoch immer wieder weiterzulesen.
Das lag, konstatierte Lazarus, wohl an zweierlei. Erstens hatte er, der alternde Eigenbrötler, der Kinder nicht mochte, von der Welt, in der dieses Buch spielte, bislang nicht das geringste geahnt, und er kam sich vor wie ein Gulliver, der unversehens, unvorbereitet, jählings in ein Reich der Zwerge katapultiert worden war. Und zum zweiten, hm, nun ja, also der Wahrheit die Ehre (mit lindem Sodbrennen wälzte Lazarus sich auf seinem Lager), zum zweiten war das, was er da gelesen hatte, die erste Liebesgeschichte, die ihm seit Jahren unter die Augen gekommen war. Immer weiter nachgrübelnd über das Gelesene, fiel der Achtundfünfzigjährige zuletzt in einen schweren Schlaf und hatte einen wirren, traurigen Traum, aus dem ihn Punkt 7 Uhr 30 das Schrillen seiner Repetieruhr riß.
In Wien war es sehr kalt, aber trocken.
Albert Lazarus verbrachte den Tag mit Besprechungen. Er erledigte seine Geschäfte dermaßen abwesend und offensichtlich beständig mit ganz anderen als den zur jeweiligen Sache gehörenden Gedankengängen beschäftigt, daß seine Gesprächspartner sich mehr als einmal über den sonst so korrekten und konzentrierten Mann ärgerten, jedoch aus Höflichkeit schwiegen.
Kaum im Abteil des Schlafwagens, der mit dem Paris-Expreß Wien um 22 Uhr 15 verließ, ging Lazarus wieder zu Bett und las das Manuskript zu Ende. Er aß diesmal keine Pralinen. Gegen vier Uhr früh legte er den Leitzordner fort und starrte, ein fetter Mann in einem lächerlichen Nachthemd, aufrecht sitzend, lange Zeit ins Nichts. So schlief er ein, ohne die Uhr aufgezogen und die Zähne geputzt zu haben. Eine Fahrtstunde vor Frankfurt weckte ihn der Schaffner und brachte Tee. Er fand den Reisenden des Einzelabteils 13/14 in einem zerwühlten Bett, unwirsch und schlechter Laune.
In Hessen schneie es mit unverminderter Heftigkeit, die Bahnstrecke war zum Teil verweht. Während der Herr schlief, hatte es deswegen bereits einige Aufenthalte gegeben, berichtete der Schaffner. Den heißen Tee schlürfend, hörte Lazarus stumpf solchem Gerede des braun Uniformierten zu, der, nachdem er um Erlaubnis gebeten hatte, die schwarze Blende vor dem Fenster hochzog und so den geröteten Augen des Albert Lazarus den Blick in eine weiße Wüstenei freigab.
»In Norddeutschland soll es noch schlimmer sein.«
»So.«
»Die meisten Zugverbindungen sind überhaupt unterbrochen, Telefonleitungen zerstört. Der Frankfurter Flughafen und andere Flughäfen haben den Betrieb eingestellt.«
»So.«
»Die Autobahn soll von Frankfurt an in Richtung Kassel noch nicht geräumt und unbefahrbar sein. Wir haben auch Verspätung.«
»So.«
»Ich will den Herrn nicht stören.«
»Dann tun Sie es nicht«, sagte Lazarus. Seit einem Vierteljahrhundert war keine so unhöfliche Bemerkung über die schmalen, runden Lippen dieses dicken Mannes gekommen, der bei aller Robustheit unter einer geradezu krankhaften Schüchternheit litt. Der Schaffner verschwand beleidigt.
Albert Lazarus fühlte sich übel an diesem Morgen. Er, der jede Woche zu einem Spezialisten und jedes Vierteljahr zu einem anderen ging und alle Spezialisten Scharlatane nannte, weil sie alle ihm immer wieder nichts anderes als das bestätigten, was er nicht hören wollte, nämlich, daß er vollkommen gesund sei. Albert Lazarus hatte am Morgen dieses 9. Januar 1962, eine Fahrtstunde vor Frankfurt, die objektiven Gefühle eines Menschen, der vor dem Ausbruch einer schweren Krankheit steht, und zwar zu einem noch so frühen Zeitpunkt, daß er nicht in der Lage ist, die dumpfe, quälende Quelle seines Unbehagens zu lokalisieren.
Lazarus holte die Medikamentenschatulle hervor. Er schluckte Pillen und zählte Tropfen auf den Teelöffel ab. Aber während er sich, die Haushälterin verfluchend, die vergessen hatte, ihm seine Pantoffeln in den Koffer zu legen, in Socken vor dem Wandspiegel mit einem elektrischen Gerät rasierte und anzog, wuchs sein Unbehagen weiter. Der Kopf schmerzte. Er fröstelte. Wieder in seinem altmodischen Anzug, glitt er, obwohl auch dieses Abteil überheizt war, in die Ärmel des gefütterten Wintermantels, wand einen Schal um den Hals und setzte einen altmodischen Schlapphut (Schweitzer!) auf, bevor er sich neben das Fenster setzte und in das irrsinnige Schneetreiben hinausstarrte, welches das ganze Land in einem einzigen grenzenlosen weißen Chaos untergehen ließ. Nur an der temperierten Scheibe schmolzen die Flocken.
Nach einer Weile wurde Lazarus schwindlig. Er senkte den Kopf und bemerkte, daß er noch immer in Socken dasaß. Diese elende Martha, dachte er, sich ob seiner Fettleibigkeit mühsam bückend und ein Paar altmodischer Schnürstiefel anziehend, ich werde mich erkältet haben, weil ich gestern und heute nacht ohne Pantoffeln im Abteil herumgegangen bin.
Diese »elende Martha« war ein ältliches Fräulein, das seit nunmehr siebzehn Jahren den kleinen Haushalt des Albert Lazarus führte. Er rauchte nicht. Er trank nicht. Es hatte niemals Frauen in seinem Leben gegeben. Und auch mit Fräulein Martha (52) verband ihn trotz siebzehnjähriger Gemeinschaft keine wirklich menschlich zu nennende Beziehung. In gelegentlichen Anfällen von Jähzorn (sie traten immer dann auf, wenn ein Spezialist ihm gerade wieder einmal einen exzellenten Gesundheitszustand bestätigt hatte) pflegte der alternde Mann dem alternden Fräulein aus lächerlichstem Anlaß zu kündigen –jedoch jedesmal nach dem fünfzehnten eines Monats. Da das Arbeitsverhältnis laut Vertrag immer nur bis zum fünfzehnten eines Monats kündbar war, wies Fräulein Martha die Entlassung denn jedesmal auch prompt und kühl zurück, worauf Lazarus die Affäre auf sich beruhen ließ. Dieses seltsame Spiel, das sie seit siebzehn Jahren miteinander spielten, war das einzige, was sie beide verband, die einzige Brücke über die Abgründe ihrer und seiner Einsamkeit.
Ich warte noch ein paar Tage, überlegte Lazarus, die Senkel seiner Stiefel schnürend, und wenn es eine Grippe wird, dann werfe ich sie diesmal hinaus. In ein paar Tagen war der fünfzehnte …
Er richtete sich auf und sah wieder aus dem Fenster.
Was sollte das alles? Er war zu klug, um nicht zu wissen, warum er sich elend fühlte, zerschlagen, matt und krank. Der Zustand hatte seelische Ursachen, nicht körperliche. Das Manuskript, das er in zwei Nächten gelesen hatte – war es gut, war es schlecht? Lazarus hätte es nicht zu sagen vermocht. Etwas Derartiges war ihm noch nie passiert. In Kollegenkreisen bewunderte man die Treffsicherheit seines Urteils. Diesmal, zum ersten Male, war er ratlos. Das einzige, was ihm völlig klar schien, war: Die Geschichte, die er gelesen hatte, war nicht erfunden, nein, sie war erlebt worden. Und echt, wie dieses Manuskript, mußte wohl auch die Liebe sein, von der das Buch erzählte. War sie aber echt, dann schwebte der junge Mensch, der hier in exhibitionistischer Weise intime und intimste Geschehnisse offenbarte, in Gefahr. In großer Gefahr. In Lebensgefahr.
Plötzlich bemerkte Lazarus, daß er Angst hatte, Angst um diesen Oliver Mansfeld und die Frau, die jener liebte. Sie waren beide in Gefahr. Man mußte ihnen helfen! Wer? Und wie? Wer wußte denn von dem, was sie beschlossen hatten, was sie planten? Lazarus fuhr sich nervös durch den mächtigen Schnurrbart.
Er, er war der einzige, der davon wußte. Nur er: Ein alternder, unbeholfener Bücherwurm, der niemals geliebt, dem niemals eine Frau begegnet war, die ihn geliebt hatte, die ihn hätte lieben können. Er, ein schüchterner, wehleidiger Mensch ohne Freunde, ein Mann, über den Männer lächelten und den Frauen lächerlich fanden, stets lächerlich gefunden hatten. Ein altmodischer, schwerfälliger, fetter Mensch, der zuviel Süßes aß und keine Lücke hinterlassen würde, wenn er starb, keinen, der um ihn weinte. So sah das einzige Wesen aus, das nun um eine Liebe wußte, welcher Unheil, Leid und ein gewaltsames Ende drohten.
Darum, erkannte Albert Lazarus in plötzlicher Hellsicht, fühle ich mich krank, übel, elend. Weil ich Angst habe, Angst um einen Einundzwanzigjährigen, den ich nicht kenne, um eine unbekannte Frau, von der ich dennoch alles weiß, alle Geheimnisse, die sie hat, Angst davor, daß etwas Furchtbares geschieht, bevor ich etwas tun und so vielleicht eine Katastrophe verhindern kann.
Was kann ich tun? Ich, ein kleiner Mann ohne Macht, Geld, Kraft? Mein Leben lang habe ich nichts tun können. Niemandem helfen. Niemals. Keinem. Aber nun muß ich etwas tun, und schnellstens, niemand kann mir diese Verpflichtung abnehmen. Ich muß handeln.
Handeln, wie? Tun, was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wenn wahr ist, was auf diesen Seiten steht – er hob den schwarzen Leitzordner auf, der zu Boden geglitten war, und starrte ihn an –, wenn all dies wahr ist (und es ist gewiß wahr, das ist das einzige, das ich gelernt habe in dreißig Jahren: Die sogenannte Kunst, die stets verlogen ist, zu unterscheiden von der Wahrheit, die stets nichts mit sogenannter Kunst zu tun hat), dann muß ich diesen jungen Menschen schnellstens warnen, zu mir rufen. Allerschnellstens. Sonst ist es zu spät …
Er schlug das Manuskript noch einmal auf. Die Titelseite, erinnerte er sich, trug einen Adressenvermerk. Da war er.
Alle Rechte bei:
Oliver Mansfeld
c/o Internat Professor Florian
Friedheim im Taunus
Telefon 34321
Ich werde ihn anrufen, überlegte Lazarus, sobald ich im Büro bin.
Benommen wie ein Mensch mit leichtem Fieber fühlte er sich nun, da er noch einmal, abwesend, mit wirren, leicht wandernden Gedanken das Manuskript durchblätterte, in dem so leidenschaftlich und in einer ihm so fremden Sprache von so vielem gesprochen wurde, das Albert Lazarus in achtundfünfzig Jahren eines ereignislosen Lebens niemals erfahren hatte: Von der unermeßlichen Seligkeit der Liebe, von der abgründigen Verzweiflung der Liebe, von Eifersucht, Haß, Verzückung und Hoffnung. Ja, ich werde sofort anrufen, dachte Lazarus. Dann fiel ihm ein, daß der Schaffner etwas von unterbrochenen Telefonverbindungen erzählt hatte. Albert Lazarus, das Manuskript auf den Knien, fröstelte.
Mit einer Verspätung von eineinhalb Stunden erreichte der Paris-Expreß endlich Frankfurt am Main. In der Bahnhofshalle kaufte der dicke Mann, der seinen kleinen Koffer selber trug, eine Mittagszeitung. Als er die Schlagzeile erblickte, blieb er stehen. Er stellte den Koffer auf den nassen, schmutzigen Boden, mitten im Mahlstrom unzähliger eiliger Menschen. Lautlos bewegte er die Lippen, sein rosiges Gesicht hatte jede Farbe verloren. Die Schlagzeile lautete:
SOHN DES SCHIEBERMILLIONÄRS MANSFELD ERMORDET
Lazarus stand reglos; nur die Hände, welche die noch druckfeuchte Zeitung hielten, zitterten. Er las, was in Fettschrift, zunächst dreispaltig, später einspaltig gesetzt, unter der Überschrift stand:
Frankfurt, 9. Januar (Eigenbericht). Blutüberströmt, mit schweren Verletzungen, die auf einen erbitterten Kampf schließen lassen, wurde der 22jährige Schüler Oliver Mansfeld, Sohn des berühmt-berüchtigten Radioindustriellen Walter Mansfeld, in der ersten Morgenstunde des heutigen Tages in der Giebelstube eines verfallenen Aussichtsturms, nahe dem Dorf Friedheim im Taunus, erhängt aufgefunden. Alle Begleitumstände sprechen dafür, daß Oliver Mansfeld einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.
Schüler Mansfeld – er besuchte trotz seines Alters noch die neunte Klasse des Internats Professor Florian – wurde bereits am Sonntagabend vermißt. Seit Montagmittag durchkämmten Landgendarmerie und Bundeswehr das unübersichtliche Waldgebiet rund um das Internat, wo Mansfeld am Sonntagnachmittag zum letztenmal gesehen worden war. Die anhaltenden katastrophalen Schneefälle erschwerten die Aktion außerordentlich. Gegen Mittag entdeckten Angehörige der Bundeswehr in einer Waldschneise, etwa zwei Kilometer vom Schulgebäude entfernt, den völlig zugeschneiten Wagen des Toten. Die Sitze, das Lenkrad, der Boden, das Armaturenbrett sowie die Außen- und Innenseite der linken Wagentür waren über und über mit Blut befleckt.
Zu spät. Er war zu spät gekommen.
Mit hängenden Schultern, offenem Mund und offenen Augen, die ins Nichts starrten, stand Albert Lazarus da, ein fetter, alter Mann, dem graublondes, stumpfes Haar unter der Hutkrempe hervorquoll und unordentlich über die Ohren fiel. Mechanisch tastete er nach seinem Schnurrbart, in dem noch immer etwas Schokolade klebte. Er merkte nicht, daß Menschen ihn anstießen. Er hörte und sah nichts. Zu spät. Zu spät. Wenn diese Meyer das Manuskript nicht verschlampt und es ihm vor den Feiertagen gegeben hätte …
Oder wäre es auf jeden Fall geschehen? Gab es im Leben nichts, was man verhindern konnte? Lazarus fror. Sein Kopf schmerzte zum Zerspringen. Ein Satz von Oscar Wilde fiel ihm ein: »Die Wahrheit erkennen wir immer erst dann, wenn wir mit ihr absolut nichts mehr anzufangen vermögen.«
Er nieste. Er zwang sich, weiterzulesen.
Der Text war nun einspaltig gesetzt:
Da alle Telefonverbindungen zwischen Frankfurt und dem Taunus unterbrochen sind, forderte die Landgendarmerie daraufhin über Funk die Hilfe des Frankfurter Polizeipräsidiums an. Eine Mordkommission unter Führung von Kriminalhauptkommissar Hardenberg wurde mit Hubschraubern zum Fundort geflogen. Die Maschinen landeten auf einem freigeschaufelten Tennisplatz neben der Schule. Das Internat besitzt eine Kartei der Blutgruppen aller Schüler. Der Polizeiarzt der Mordkommission konnte so leicht feststellen, daß das im Wagen gefundene Blut mit der Blutgruppe Oliver Mansfelds identisch ist. Beamte des Erkennungsdienstes sicherten eine Reihe von Hinweisen und Spuren, die zur Stunde noch geheimgehalten werden.
Die Suche nach dem Verschwundenen wurde auch bei Einbruch der Nacht …
»Mensch, können Sie sich nicht vielleicht woanders hinstellen?« Lazarus, heftig angestoßen von einem Mann, der ein Paar Skier über der Schulter und einen Rucksack trug, taumelte zur Seite. Entschuldigend zog er den alten Hut und trat mit seinem Koffer neben einen Blumenladen beim Ausgang. Hier zog es heftig, aber Lazarus spürte es nicht.
… wurde auch bei Einbruch der Nacht nicht unterbrochen. Mit Handscheinwerfern und Fackeln, auf Skiern, setzten über 70 Mann die Aktion fort, die heute morgen um 0 Uhr 35 Erfolg hatte. Die Leiche Oliver Mansfelds, die, steifgefroren und eingeschneit, in der völlig verschneiten Aussichtsstube eines alten Turmes, etwa zwei Kilometer vom Schulgebäude entfernt, entdeckt wurde, befand sich in einem solchen Zustand, daß der Arzt der Mordkommission schon nach einer ersten kurzen Untersuchung folgendes feststellen konnte:
• der Tod muß bereits in den Nachmittags-, spätestens in den frühen Abendstunden des Sonntags eingetreten sein;
• alle Anzeichen sprechen dafür, daß Oliver Mansfeld zusammengeschlagen, schwer verletzt und sodann, wahrscheinlich während er bewußtlos war, erhängt wurde.
Für die Annahme, daß Mord vorliegt, sprach sich unserem gleichfalls mit Hubschrauber zum Fundort geflogenen Berichterstatter gegenüber auch Hauptkommissar Hardenberg aus, nachdem Beamte des Erkennungsdienstes in der Turmstube Spuren und Gegenstände sichergestellt hatten, deren Art zur Stunde ebenfalls noch geheimgehalten wird.
Hier folgte, in der Mitte der Seite, wieder dreispaltig gesetzt und mit schwarzen Balken eingeschlossen, dieser Text:
DIE POLIZEI BITTET UM MITARBEIT
Wer hat Oliver Mansfeld (22 Jahre, schlank, 1,78 Meter groß, schmales, auffallend gebräuntes Gesicht, braune Augen, sehr kurz geschnittenes, dichtes braunes Haar) seit Sonntag, den 7. Januar, 15 Uhr 30 auf dem Rhein-Main-Flughafen, der Autobahn oder an einem anderen Ort gesehen? Der Tote war zuletzt bekleidet mit einem kamelhaarfarbenen Dufflecoat, einem dicken blauen Rollkragenpullover, grauen Keilhosen und pelzgefütterten, festen braunen Winterschuhen.
Wer hat nach 15 Uhr 30 am 7. Januar einen weißen Wagen der Marke Jaguar 500, schwarze Schweinslederpolsterung, gesehen? Es handelt sich um ein Kabriolett mir schwarzem Dach, das wahrscheinlich zurückgeschlagen war. Aller Wahrscheinlichkeit nach saß Oliver Mansfeld am Steuer und neben ihm ein elfjähriger Junge von fremdländischem Aussehen. Der Wagen trägt das polizeiliche Kennzeichen L 43131-Z (Zollnummer!).
Wer ist in der Lage, Einzelheiten über ein Telefongespräch zu berichten, das Oliver Mansfeld in der Blauen Bar des Rhein-Main-Flughafens am 7. Januar 1962 zwischen 15 Uhr 30 und 15 Uhr 45 von einem Apparat aus führte, der auf der Bartheke stand? Anzeichen sprechen dafür, daß sein Gesprächspartner eine Frau war. Hat Oliver Mansfeld ihren Namen oder ihren Vornamen genannt? Zur fraglichen Zeit hielten sich zahlreiche Gäste in der Bar auf.
Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, nimmt jede Polizeidienststelle, vor allem aber das Dezernat 1 des Frankfurter Polizeipräsidiums, Telefon 236531, entgegen.
Albert Lazarus ließ die Zeitung sinken und starrte in das Schneegestöber auf dem Platz vor dem Bahnhof hinaus. Er überlegte lange wie ein Mann, der gewissenhaft das Für und Wider einer schwerwiegenden Entscheidung abwägt, denn er wußte, daß von dem, was er nun tat, Ungeheuerliches abhängen konnte – für jene Akteure des Dramas, die noch lebten. Zuletzt ging er mit schleppenden Schritten zu der langen Reihe der Telefonzellen, die sich in der Halle befanden, betrat eine von ihnen und wählte die Nummer, welche die Zeitung angab.
Zweimal surrte das Freizeichen, dann meldete sich eine monotone Männerstimme: »Polizeipräsidium. Dezernat 1. Kommissar Wilms.«
»Hier spricht …« Lazarus mußte sich räuspern, seine Stimme war völlig heiser, die Kehle verlegt. »Hier spricht Albert Lazarus.« Er nannte seinen Beruf und den Namen des Verlages, für den er arbeitete. »Ich komme gerade von einer Reise zurück und lese vom Tod Oliver Mansfelds.«
Die Stimme am anderen Ende der Leitung wurde interessierter: »Ja? Und?«
»Mein Verlag hat vor Weihnachten das Schreibmaschinenmanuskript eines Romans erhalten. Absender und Verfasser ist ein gewisser Oliver Mansfeld.«
»Woher wissen Sie das?«
»Es steht auf dem Manuskript.«
»Es muß nicht wahr sein.«
»Es ist wahr, Herr Kommissar. Ich habe das Manuskript auf meiner Reise gelesen. Die Ereignisse des Romans spielen sich im Taunus, im Internat eines gewissen Professor Florian ab. Das Internat liegt unweit Friedheim.«
Jetzt klang die andere Stimme atemlos: »Der Autor nennt die richtigen Namen?«
»Und zwar in allen Fällen, wie er in einem Vorwort erklärt. Die Handlung setzt im September 1960 ein, und Mansfeld erzählt dann, was sich seither zugetragen hat – bis knapp vor Weihnachten 1961. Das Manuskript ist unvollendet, trotzdem glaube ich …«
»Das Präsidium liegt fünf Minuten vom Bahnhof entfernt. Darf ich Sie bitten, sofort zu mir zu kommen, Herr Lazarus?«
»Das wollte ich gerade tun.«
»Gehen Sie nicht zum alten Bau an der Friedrich-Ebert-Anlage. Kommen Sie in den Neubau in der Mainzer Landstraße. Dritter Stock, links. Dezernat Mord. Ich erwarte Sie.«
»Ich komme sofort.«
»Vielen Dank«
Albert Lazarus hängte ein und trat aus der Zelle. Er ging zum Ausgang und in das Schneetreiben hinein, das ihn beinahe blind machte. Minuten später schon gefror der Schnee in seinem Walroßschnurrbart, seinem langen Haar und seinen buschigen, blondgrauen Augenbrauen zu kleinen Eispartikelchen.
Autos am Straßenrand bemühten sich vergebens, aus riesigen Schneewehen freizukommen. Pneus drehten sich rasend und sinnlos. Es stank nach verbranntem Gummi. Ein Funkstreifenwagen mit heulender Sirene und aufgeblendeten Scheinwerfern jagte vorbei.
Als Albert Lazarus, der unbekannte Mann mit dem berühmten Leitbild, die Poststraße überquerte, um in die Ottostraße einzubiegen, geriet er in eine größere Menschenmenge, die eben, ärgerlich und gereizt, einen Straßenbahnzug verließ, der vor einer eingefrorenen Weiche steckengeblieben war. Schwindlig und erregt, schwitzend und frierend zugleich, stieß Lazarus mit Männern und Frauen zusammen, die hinter ihm herschimpften.
Er hörte es nicht. Als wollte er ihn schützen, hob er den kleinen Koffer vor die breite Brust und hielt ihn da mit beiden Händen. So trug er ihn durch die weiße Schneehölle, vorsichtig, mit den unsicheren Schritten eines alten Prostatikers (der er nicht war), er, Albert Lazarus, in dessen unwichtigem, unbedeutendem Leben niemals noch etwas Wichtiges, Bedeutendes geschehen war – bis zu dieser Stunde.
Und so verlieren wir ihn denn aus den Augen, hinter den wirbelnden Rädern und Schlieren der Flocken, diesen Unbekannten unter Unbekannten, diesen Einen unter Millionen, diesen achtundfünfzig Jahre seines Lebens geduckten, einsamen Mann, der in einem altmodischen Koffer ein Manuskript von 743 Schreibmaschinenseiten trägt wie einen kostbaren Schatz. Helfen soll dieses Manuskript nun, ein Verbrechen zu klären, ein Rätsel zu lösen, und erzählt doch nur die Geschichte einer Liebe, die kein Ende hat und nie haben wird, und die ihren Anfang nahm vor mehr als fünfzehn Monaten, an einem schönen Herbstnachmittag, um ganz genau zu sein: Am vierten September des Jahres eintausendneunhundertundsechzig.
Das Manuskript: Erstes Kapitel
1
Wär’s nicht zum Flennen, müßte man ja wohl darüber lachen. Jedesmal, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, gibt es dasselbe Theater. Seit sieben Jahren geht das so. Langsam könnten sich die Herren mit dem Gedanken vertraut machen, daß mein verfluchter Vater in ihren Fahndungsbüchern steht als Mann, der sofort zu verhaften ist. Er – nicht ich.
Wenn man bedenkt, wie oft ich in diesen sieben Jahren zwischen Luxemburg und Deutschland hin und her geflogen bin! Aber nein, nichts zu wollen, es ist immer dasselbe, auch an diesem 4. September 1960. Es ist genauso, wie es immer war und immer sein wird. Bis Gras über die Sache gewachsen ist und sie meinen Alten wieder ins Land lassen. Schon toll, daß so eine Sauerei eines Tages verjährt und keiner ihm dann mehr an seinen schönen Wagen fahren kann! Was denn? Totschlag kann sogar schon nach fünf Jahren verjähren. Feine Gesetze haben wir.
Wie gesagt: Es ist genauso wie immer. Nur über dem Flugplatz müssen wir diesmal nicht so lange kreisen wie sonst. Zwei Maschinen landen vor uns. Teddy fliegt dauernd Linkskurven. Teddy Behnke heißt er. Der Pilot von meinem Alten. Im Krieg hat er Bomber geflogen. Jetzt fliegt er eine »Cessna« und eine Beech-»Bonanza«. Mein Herr Papa hat sich zwei Flugzeuge zugelegt, seit er nicht mehr nach Deutschland darf. Niedliche Dinger. Trotzdem, zum Kotzen. Auf beide Rumpfseiten der »Bonanza« hat mein Alter in Riesenbuchstaben hinschmieren lassen: MANSFELD. Rot auf Silber.
Das ist typisch für ihn. So ein richtiger Neureicher. Mit ihm verglichen, kommt Teddy aus der englischen Hocharistokratie. Aber Teddy kann weiter nichts als Golfspielen und Tennis und Fliegen. Von Golf und Tennis kann man nicht leben. Also muß Teddy fliegen. Im Krieg hat er es für das Vaterland getan, fürs teure, schließ dich an, jetzt tut er es für einen dreckigen Schieber. Es muß schlimm sein, wenn man weiter nichts kann als Fliegen. Ich glaube nicht, daß Teddy gern bei meinem Alten arbeitet. Er hat immer das gleiche Poker-Face und läßt sich nichts anmerken, aber manchmal merkt man es doch.
Wir landen, er läßt die Karre vor dem Flughafengebäude ausrollen. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Herr Oliver, dann möchte ich gerne gleich zurückfliegen.«
»Sie meinen, Sie wollen nicht mit mir zum Paß gehen und sich filzen lassen.«
»Das habe ich nicht gesagt, Herr Oliver.«
»Aber gedacht. Glauben Sie, ich würde da reingehen, wenn ich nicht müßte?«
Er schaut mich an und macht the old Poker-Face und sagt keinen Ton.
»Such is life«, sage ich, nehme meine braune große Reisetasche und klettere aus der Maschine. Er springt mir nach und brabbelt ziemlich undeutlich: »Ich muß noch zur Flugsicherung.«
»Sail well, dear fellow of mine«, sage ich. Diesen Tick mit den englischen Brocken dazwischen habe ich noch aus dem letzten Internat behalten. Hoffentlich verschwindet er bald. Bin neugierig, was die da oben im Taunus gerade für einen Tick haben. Irgendeinen haben wir alle, immer. Nicht besorgniserregend. Geht vorüber. Nothing serious.
»Sie sind mir nicht böse, daß ich Sie nicht begleite und warte, bis Sie abfahren?«
»Keine Spur. Grüßen Sie meine Mutter.«
»Gewiß, Herr Oliver. Ich werde die gnädige Frau morgen im Sanatorium besuchen, ich verspreche es Ihnen.«
»Bringen Sie ihr Blumen mit«, sage ich und gebe Teddy Geld. »Rote Rosen. Erzählen Sie ihr, ich hätte gesagt, diesmal würde ich mich zusammennehmen. Aus diesem Internat fliege ich nicht wieder raus. So etwas beruhigt sie immer.« Er antwortet wieder nicht, und darum frage ich: »What’s the matter, old boy?«
»Es ist alles sehr peinlich für mich, Herr Oliver.«
»Ach, Teddylein! Glauben Sie, für mich ist es das reine Honiglecken? Sie sind wenigstens nicht sein Sohn! Sie können kündigen! Sie haben es gut. Dieser verfluchte Hund!«
»So sollten Sie nicht von Ihrem Vater sprechen.«
»Vater! Daß ich nicht vor fröhlichem Gelächter ersticke! Meinetwegen kann er verrecken, mein alter Herr«, sage ich. »Und die liebe Tante Lizzy dazu. Es wäre ein Freudentag für mich. Na ja«, sage ich und gebe Teddy die Hand, »also dann. In diesem Sinne!« Er sagt leise: »Gott schütze Sie.«
»Wer?«
»Gott.« (Teddy ist fromm.)
»Und was soll er tun?«
»Er soll Sie beschützen.«
»Ach so«, sage ich. »Ja, natürlich, das soll er. Und Sie soll er auch beschützen. Und die ›Bonanza‹ auch. Und die ›Cessna‹! Er soll überhaupt alles beschützen. Schließlich beschützt er ja auch so ein Schwein wie meinen Alten. Da kann man es schon von ihm verlangen! So long, Teddy.«
»Leben Sie wohl, Herr Oliver«, sagt er, und dann hinkt er über den Betonboden zu einer Tür, darüber steht: AIR WEATHER CONTROL. Hat einen Flaksplitter ins Knie bekommen, ganz zum Schluß noch, fünfundvierzig, als alles schon im Eimer war. Darum hinkt er. Und darum ist er wohl fromm geworden. Feiner Kerl, dieser Teddy. Was der wohl so denkt über unsere Familie? Ich kann es mir vorstellen. Dasselbe wie ich vermutlich.
Ich nehme meine Tasche auf und gehe zur Paßkontrolle. Gibt sehr viel Betrieb heute. Sonntags immer. Eine Menge großer Maschinen. Drüben, vor dem Restaurant, sitzen die Menschen im Freien und trinken Kaffee und sehen zu, wie die Boeings und die Caravelles starten und landen. Ist auch ein schöner Tag. Blauer Himmel, ganz warm. Und diese silbernen Fäden in der Luft, Altweibersommer. Nach Kartoffelfeuer riecht es. Draußen, auf dem Flugfeldrasen, weidet eine Herde Schafe …
»Ihren Paß, bitte.«
Ich gebe dem Beamten hinter der hohen Theke meinen Paß. Er schlägt ihn auf, und gleich darauf macht er dann dieses Gesicht, das sie alle machen. Immer. Manche pfeifen auch ein bißchen, wenn sie meinen Namen lesen. Oder sie summen. Aber sie machen immer dieselben Gesichter.
Übrigens ist das schon wieder ein neuer Beamter, ich habe ihn noch nie gesehen. Auch den nicht, der in der Sperre vor mir lehnt, damit ich um Himmels willen nicht vielleicht flüchte.
Ich habe Flanellhosen, ein weißes Hemd ohne Krawatte und einen Blazer angezogen. Keine Manschettenknöpfe. Slipper. Ich ziehe mich immer so an, wenn ich nach Deutschland komme. Dann geht das Ausziehen schneller.
»Sie heißen?«
Hören Sie, könnte ich jetzt beispielsweise sagen, das steht in dem Paß, den Sie in der Hand halten, warum fragen Sie also? Aber ich sage es nicht, denn das weiß ich schon lange, daß so etwas gar keinen Sinn hat. Sagst du es, dann lassen sie dich eine halbe Stunde im Transitraum warten und tun so, als ob sie telefonieren, und alles dauert fünfmal so lange. Trotzdem: Zuerst habe ich es ein paarmal gesagt, vor sieben Jahren. Da war ich vierzehn und habe es nicht besser verstanden. Inzwischen bin ich klüger geworden. Das walte Hugo.
Mit einem verbindlichen Lächeln erwidere ich: »Ich heiße Oliver Mansfeld. Aber ich bin der Sohn, nicht der Vater.«
Der hinter der Theke hört gar nicht hin, sagt keinen Ton, bückt sich und sucht etwas.
»Links im obersten Fach«, sage ich.
»Was ist da?«
»Das Fahndungsbuch«, sage ich. »Wenn es noch die letzte Ausgabe ist, dann Seite 134, unten, vorletzte Zeile. Da steht er.«
»Wer?«
»Mein väterlicher Urheber.«
Tatsächlich holt er das Fahndungsbuch aus dem Fach, das ich ihm verraten habe, und folgsam blättert er zur Seite 134. Dabei beleckt er einen Finger. Dann fährt er mit ihm die ganze Seite herab, obwohl ich ihm gesagt habe, daß mein Vater ganz unten steht, und dort findet er ihn dann endlich und liest, was es zu lesen gibt, und bewegt lautlos die Lippen.
Der andere, der sich mir in den Weg gestellt hat, fragt inzwischen: »Woher kommen Sie?«
Ich habe eine Menge gelernt in den letzten sieben Jahren, und darum sage ich nicht: Das wissen Sie so gut wie ich, der Kontrollturm hat Sie angerufen und mich avisiert, als wir noch Linkskurven drehten. Ich antworte sanft und höflich: »Aus Luxemburg. Wie immer.«
»Was heißt: Wie immer?«
»Das heißt, daß ich immer aus Luxemburg komme.«
»Seine Familie lebt da«, sagt der hinter der Barriere und macht das Fahndungsbuch zu. »Hier steht es.«
Danach geht alles so weiter wie immer, ein bißchen ausführlicher vielleicht diesmal, weil die beiden gerade nichts zu tun haben.
»Wohin wollen Sie jetzt?«
»In den Taunus hinauf. Morgen fängt die Schule an.«
»In welche Klasse gehen Sie?«
»In die achte.«
»Mit einundzwanzig?«
»Ja.«
»Dann sind Sie dreimal sitzengeblieben?« Schlauer Junge, was? Immer höflich, immer freundlich.
»Jawohl. Ich bin ein sehr schlechter Schüler. Mathematik und Physik kapiere ich einfach nicht. Ich bin ein Idiot. Aber mein Vater besteht darauf, daß ich das Abitur mache.« Daß er darauf besteht, stimmt. Daß ich ein Idiot bin, stimmt nicht. Ich kapiere Physik und Mathematik. Ich bin dreimal sitzengeblieben, um meinen Alten zu ärgern. Es ist mir gelungen. Er hat wochenlang getobt. Das waren die glücklichsten Wochen in den letzten sieben Jahren für mich. Ich werde auch beim Abitur durchfallen. And how! Zeit, daß ich mir wieder einmal ein paar schöne Stunden mache.
»Das ist Ihr ganzes Gepäck?«
»Ja.«
»Was ist da drin?«
»Bücher. Schallplatten. Waschzeug.«
»Und alles andere?«
»Habe ich in Frankfurt gelassen. Bei einem Freund. Der hat meine Sachen inzwischen schon ins Internat hinaufgeschickt.«
Draußen wird ein grelles Schrillen lauter und lauter. Dann geht die Tonhöhe herunter, wir hören ein Jaulen. Dann wird es still. Eine Turboprop ist gelandet, ich kann sie durch die offene Tür sehen.