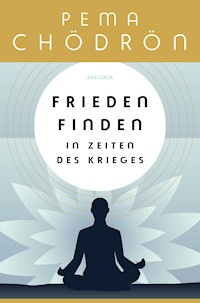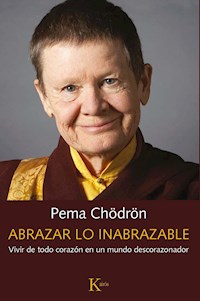Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kamphausen Media
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Liebende Zuwendung l Freude im HerzenDieses Buch lehrt uns, ja zu sagen zum Leben und Freundschaft zu schließen mit uns selbst, mit der Welt und mit allem, was sie uns an Freude und Leid zu bieten hat. Wenn man anfängt zu meditieren oder sich mit einer spirituellen Disziplin zu befassen, hofft man oft, auf irgendeine Weise zu einem besseren Menschen zu werden. Doch das ist im Grunde nur eine Art subtiler Gewalt gegen das, was man wirk lich ist, gegen das eigene Wesen. Liebende Zuwendung sich selbst gegenüber - das, was im Buddhismus Maitri genannt wird, bedeutet nicht, dass wir irgendwelche Eigenschaften von uns ausmerzen müssen. Maitri bedeutet, dass wir so verrückt, so wütend, so ängstlich und so eifer süchtig sein dürfen, wie wir es nun mal sind und schon immer waren. Die Basis unserer Übung sind wir selbst, wer immer wir in diesem Augenblick sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pema Chödrön
Liebende ZuwendungFreude im Herzen
Pema Chödrön
•
LiebendeZuwendung
•
Freudeim Herzen
•
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem TitelThe Wisdom of No Escape bei Shambhala Publications, Boston.Die deutsche Ausgabe erschien zunächst unter dem TitelDharma als Lehre, Dharma als Erfahrung.
Pema Chödrön
Übersetzung: Katharine Cofer
Liebende Zuwendung – Freude im
Titelgestaltung: Jutta Kümpfel
Herzen © Aurum in J. Kamphausen
E-Book Gesamtherstellung:
Mediengruppe GmbH, Bielefeld
Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
www.weltinnenraum.de
E-Book Ausgabe 2014
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN Print 978-3-89901-331-3
ISBN E-Book 978-3-89901-977-3
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen undsonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabesowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten.
Für meinen Lehrer,Vidyadhara den ehrwürdigen Chögyam Trungpa Rinpoche,und für meine Kinder, Arlyn und Edward.
Inhalt
Vorwort
Liebende Zuwendung
Zufriedenheit
Unsere wahre Natur finden
Präzision, Sanftheit und Loslassen
Die Weisheit des Nicht-Ausweichen-Könnens
Freude
Aus einer weiteren Perspektive betrachten
Es gibt keine wahre Geschichte
Das Wetter und die Vier Edlen Wahrheiten
Nicht zu fest und nicht zu locker
Entsagung
Aussenden und Hereinnehmen
Zuflucht nehmen
Weder Samsara noch Nirvana vorziehen
Dharma als Lehre und Dharma als Erfahrung
In einem Boot bleiben
Unbequemlichkeit
Vier Punkte zum Erinnern
Bibliographie
Vorwort
Die Vorträge in diesem Buch wurden während einer einmonatigen Übungsperiode (dathun) im Frühjahr 1989 gehalten. Während dieses Übungsmonats wandten die Teilnehmer, die sich sowohl aus Laien als auch aus Mönchen zusammensetzten, die von Chögyam Trungpa gelehrte und in diesem Buch beschriebene Meditationstechnik an. Zur formalen Sitzmeditation kamen die Meditationen beim Gehen und beim Essen (oryoki) sowie die Mithilfe bei der Pflege der Räume und der Umgebung des Klosters und bei der Essenszubereitung hinzu.
Diese Reden wurden jeden Tag morgens früh gehalten. Sie sollten die Teilnehmer inspirieren und sie dazu ermutigen, für jedes Ereignis von ganzem Herzen wach zu bleiben und die Fülle von Material, die der Alltag bietet, als wichtigsten Lehrer und wichtigste Führung zu betrachten.
Die naturgegebene Schönheit von Gampo Abbey, einem buddhistischen Kloster für westliche Männer und Frauen, 1983 von Chögyam Trungpa gegründet, trug maßgebend zur Stimmung der Vorträge bei. Das Kloster liegt auf der Insel Cape Breton in der kanadischen Provinz Neuschottland am Ende einer langen ungeteerten Straße, hoch auf den Klippen über der Saint Lawrence-Bucht, wo die Wildheit und Verspieltheit des Wetters, der Tiere und der Landschaft die ganze Atmosphäre prägen. Während man in der Meditationshalle sitzt, durchdringt die Weite des Himmels und des Wassers den Geist und das Herz. Die Stille des Ortes, verstärkt durch die Geräusche von Meer und Wind, von Vögeln und anderen Tieren, durchdringt die Sinne.
Während des dathun (wie im übrigen zu jeder Zeit im Kloster) hielten sich die Teilnehmer an die fünf Mönchsgelübde: nicht lügen, nicht stehlen, sich keiner sexuellen Betätigung hingeben, nicht töten und keine Rauschmittel verwenden. Das Zusammenwirken von Natur, Einsamkeit, Meditation und Gelübden führte zu einer mal schmerzhaften, mal beglückenden Situation des Nicht-Ausweichen-Könnens, die wir auch »Kein Ausgang« nennen. Ohne die Möglichkeit, sich irgendwo verstecken zu können, konnte man leichter die in diesen einfachen Reden dargebotenen Lehren mit offenem Herzen und offenem Geist aufnehmen.
Die Botschaft sowohl für die Teilnehmer am dathun als auch für den Leser dieses Buches lautet: bei sich sein, ohne jede Verlegenheit oder Härte. Es handelt sich um eine Anweisung, wie man sich selbst und die eigene Welt lieben kann. Damit ist dieses Buch also auch eine einfache, für jedermann zugängliche Unterweisung darin, wie man menschliches Elend auf persönlicher wie auf globaler Ebene lindern kann.
Ich möchte Jonathan Green von Shambhala Publications danken, der mich dazu ermutigte, dieses Buch zu veröffentlichen; des weiteren Migme Chödrön von Gampo Abbey, die die Vorträge aufzeichnete und redigierte, und Emily Hilburn Sell von Shambhala Publications, die sie in ihre gegenwärtige Form brachte. Das hier Gesagte ist nichts anderes als meine sehr eingeschränkte, bisherige Auffassung dessen, was mein Lehrer, Chögyam Trungpa Rinpoche, mir mit großem Mitgefühl und unendlicher Geduld gezeigt hat. Möge es von Nutzen sein.
(Anm. d. Übers.: Um die Schlichtheit und Unmittelbarkeit auszudrücken, die die Beziehung zwischen Meister und Schülern im Buddhismus und insbesondere auf solchen Meditationskursen wie dem hier beschriebenen charakterisieren, wurde bei der Übersetzung für die direkte Anrede bewußt das »Du«, in einigen Fällen, wo eindeutig die Gruppe der Zuhörenden gemeint ist, das »Ihr« gewählt.)
Liebende Zuwendung
Unter allen Menschen, die je auf der Erde geboren wurden, herrscht das weit verbreitete Mißverständnis, daß wir dann am besten leben, wenn wir versuchen, dem Schmerz aus dem Weg zu gehen und es uns bequem zu machen. Dieses Bestreben kann man sogar bei den Insekten und Tieren und Vögeln beobachten. In diesem Punkt sind wir alle gleich.
Zu einer viel intessanteren, mitfühlsameren, abenteuerlicheren und freudvolleren Lebensweise können wir jedoch gelangen, wenn wir beginnen, unsere Neugierde zu entwikkeln, und es uns dabei einerlei ist, ob der Gegenstand unserer Wißbegier bitter oder süß ist. Um ein Leben zu führen, das über Kleinlichkeit und Vorurteil sowie über das Bestreben, das Geschehen stets in unserem Sinne zu lenken, hinausreicht, um ein leidenschaftlicheres, volleres und beglückenderes Leben zu führen, müssen wir erkennen, daß wir viel Leid und viel Freude ertragen können, um herauszufinden, wer wir sind und was diese Welt ist, wie wir funktionieren und wie unsere Welt funktioniert, wie das Ganze einfach ist. Wenn wir uns der Bequemlichkeit um jeden Preis verschreiben, werden wir, sobald wir auf die geringste Schmerzgrenze stoßen, davonlaufen; wir werden nie wissen, was sich hinter jener Schranke oder Mauer oder angsterregenden Schwelle verbirgt.
Wenn man anfängt zu meditieren oder sich mit irgendeiner Form von spiritueller Disziplin zu befassen, hofft man oft, auf irgendeine Weise zu einem besseren Menschen zu werden, was aber im Grunde eine Art subtiler Gewalt gegen das darstellt, was man wirklich ist, gegen das eigene Wesen. Es ist in etwa so, als würde man sich immer wieder vorsagen: »Wenn ich jeden Tag einen Waldlauf mache, werde ich ein viel besserer Mensch seın« oder »Hätte ich nur eın schöneres Haus, wäre ich ein besserer Mensch« oder eben »Wenn ich nur meditieren und mich beruhigen könnte, dann wäre ich ein besserer Mensch.« Vielleicht hat man in seiner Vorstellung auch immer etwas an den anderen auszusetzen und sagt sich etwas wie: »Wenn mein Mann nicht so schwierig wäre, dann hätte ich eine perfekte Ehe.« Oder: »Wenn mein Chef nicht so unmöglich wäre, dann hätte ich einen tollen Job.« Und dann: »Wenn mein Geist nicht so unruhig wäre, dann wäre meine Meditation ausgezeichnet.«
Doch liebende Zuwendung uns selbst gegenüber – das, was im Buddhismus maitri genannt wird – bedeutet nicht, daß wir irgendwelche Eigenschaften von uns ausmerzen müssen. Maitri bedeutet, daß wir so verrückt sein dürfen, wie wir eben nun mal sind oder schon immer waren. Wir dürfen so wütend sein, wie wir es schon immer waren. Wir können immer noch ängstlich oder eifersüchtig sein oder uns unwürdig fühlen. Der Punkt ist, daß wir nicht versuchen sollten, uns in irgendeiner Weise zu ändern. Bei der Meditationspraxis geht es nicht darum, uns selbst auf den Müll zu werfen und etwas Besseres werden zu wollen. Es geht darum, uns damit anzufreunden, wie wir jetzt sind. Das Fundament unserer Übung, das bist du, das bin ich, wer auch immer wir in diesem Augenblick sind, wie wir eben sind. Das ist die Grundlage, das ist das, was wir beobachten, was wir mit großer Neugierde und starkem Interesse kennenlernen wollen.
Manchmal wird unter Buddhisten das Wort »Ego« oder »Ich«, hier mit einem anderen Inhalt als in der Freudschen Theorie, in einem abschätzigen Sinne benutzt. Als Buddhisten könnten wir zum Beispiel sagen: »Mein Ego macht mir so viele Probleme.« Daraus könnten wir den Schluß ziehen: »Gut, dann müssen wir es einfach ausmerzen, nicht wahr? Dann ist das Problem gelöst.« In Wirklichkeit handelt es sich hier aber nicht darum, das Ego auszumerzen, sondern vielmehr darum, unser Interesse an uns selbst zu erwecken, unser Selbst neugierig zu erforschen.
Der Weg der Meditation und der Weg unseres Lebens haben überhaupt mit Neugierde, mit Wißbegier zu tun. Den Urboden dafür bildet unser Selbst: Wir sind hier, um uns selbst zu beobachten und kennenzulernen, und zwar jetzt, nicht irgendwann später. Oft sagt man mir: »Ich wollte kommen und mit Ihnen sprechen, ich wollte Ihnen einen Brief schreiben, ich wollte Sie anrufen, aber ich wollte warten, bis ich mich mehr im Griff habe.« Und ich denke: »Nun, wenn du so bist wie ich, dann könntest du unter Umständen ewig warten!« Deshalb ist es besser, man kommt so, wie man ist. Der Zauber entsteht dann, wenn man bereit ist, sich dem zu öffnen, für diesen Zustand völlig wach zu sein. Eine der wichtigsten Entdeckungen, die wir in der Meditation machen, besteht darin, zu sehen, wie wir ständig vor dem gegenwärtigen Augenblick wegrennen, wie wir es vermeiden, hier zu sein, einfach so, wie wir sind. Das wird nicht als Problem betrachtet; es geht nur darum, es zu sehen.
Wißbegier oder Neugierde haben damit zu tun, sanft, präzise und offen zu sein – im Grunde geht es dabei um die Fähigkeit, loszulassen und sich zu öffnen. Sanftheit bedeutet eine Haltung der Gutherzigkeit gegenüber uns selbst. Präzision bedeutet, sehr klar zu sein, keine Angst zu haben, das zu sehen, was wirklich da ist, ebenso wie ein Wissenschaftler keine Angst hat, in ein Mikroskop zu schauen. Offenheit bedeutet, loslassen und sich öffnen zu können.
Die Wirkung dieses Meditationsmonats, den wir nun beginnen, wird so sein, als ob am Ende eines jeden Tages jemand dir ein Video von dir vorführen würde und du dein ganzes Verhalten sehen könntest. Du würdest sicher oft zusammenzucken und »Igitt!« sagen. Du würdest wahrscheinlich sehen, daß du selbst all die Dinge machst, wegen derer du all die Menschen in deinem Leben kritisiert, die du nicht magst, all die Menschen, die du verurteilst. Mit dir selbst Freundschaft zu schließen, heißt im Grunde auch, mit all jenen Menschen Freundschaft zu schließen, denn wenn du schließlich diese Art von Ehrlichkeit, Sanftheit und Gutherzigkeit, verbunden mit Klarheit in bezug auf dich selbst erlangt hast, steht dem Empfinden von liebender Zuwendung auch in bezug auf andere nichts im Wege.
So ist also der Urgrund von maitri das Selbst. Wir sind hier, um uns selbst kennenzulernen und zu beobachten. Der Pfad, der Weg, um dort hinzukommen, unser wichtigstes Fahrzeug wird die Meditation und darüber hinaus auch ein generelles Gefühl der Wachsamkeit sein. Unsere Wißbegier wird sich nicht auf die Zeit beschränken, in der wir hier sitzen: Ob wir nun über die Gänge laufen, die Toiletten benutzen, draußen spazierengehen, in der Küche das Essen zubereiten oder uns mit unseren Freunden unterhalten – egal, was wir tun, wir werden versuchen, dieses Gefühl der Lebendigkeit, der Offenheit und der Neugierde in bezug auf alles, was geschieht, wachzuhalten. Vielleicht werden wir das erleben, was traditionell als die Frucht von maitri beschrieben wird: die Ausgelassenheit.
So hoffe ich, daß wir einen schönen Monat hier verbringen werden, daß wir uns dabei besser kennenlernen und eher ausgelassener als grimmiger werden.
Zufriedenheit
Es ist sehr hilfreich, zu erkennen, daß wir im Grunde nichts anderes brauchen als hier zu sein, in der Meditation dazusitzen, einfache Aktivitäten des Alltags zu verrichten, wie zum Beispiel arbeiten, draußen spazierengehen, mit Leuten reden, baden, auf die Toilette gehen, essen, um völlig wach, völlig lebendig, völlig menschlich zu sein. Es ist auch hilfreich, zu erkennen, daß dieser Körper, den wir besitzen, dieser Körper, der hier und jetzt auf dem Boden dieses Schreinraums sitzt, dieser Körper, der vielleicht schmerzt, weil es erst der zweite Tag des dathun ist, und auch dieser Geist, den wir jetzt besitzen, genau das sind, was wir brauchen, um völlig menschlich, völlig wach und völlig lebendig zu sein. Außerdem sind die Gefühle, die wir gerade in diesem Augenblick haben, die positiven wie auch die negativen, genau die, die wir brauchen. Es ist, als ob wir uns umsehen würden, um herauszufinden, was der größte Reichtum wäre, den wir überhaupt besitzen könnten, um ein gutes, anständiges, absolut erfüllendes, dynamisches, inspiriertes Leben führen zu können, und alles bereits in uns vorfinden würden.
Mit dem zufrieden zu sein, was wir bereits haben, ist ein magischer, goldener Schlüssel zum vollen, uneingeschränkten und inspirierten Lebendigsein. Eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu dem, was traditionell als Erleuchtung bezeichnet wird, ist der Groll, das Gefühl, beschwindelt worden zu sein, darüber mißmutig zu sein, wer man ist, wo man ist, was man ist. Deshalb reden wir so oft davon, mit uns selbst Freundschaft zu schließen, denn aus irgendeinem Grund erleben wir diese Art von Zufriedenheit nicht in einer tiefen, wirklich erschöpfenden Weise. Meditation ist ein Prozeß des Leichterwerdens, ein Weg, der letztendlichen Güte dessen, was wir haben und wer wir sind, vertrauen zu lernen, eine Möglichkeit, zu erkennen, daß alle Weisheit, die existiert, in dem existiert, was wir bereits haben. Unsere Weisheit ist voll und ganz mit dem vermischt, was wir unsere Neurose nennen. Unsere Brillanz, unser Saft, unser Pfeffer sind voll und ganz mit unserer Verrücktheit und unserer Verwirrung vermischt, und deshalb nützt es nichts, wenn wir versuchen, unsere sogenannten negativen Anteile loszuwerden, weil wir uns dabei auch unserer ureigenen Herrlichkeit entledigen. Wir können unser Leben so führen, daß wir immer mehr dafür wach werden, was wir sind und was wir tun, anstatt zu versuchen, uns zu bessern oder umzukrempeln oder unliebsame Eigenschaften loszuwerden. Letztendlich geht es darum, aufzuwachen, aufmerksamer, wißbegieriger und neugieriger in bezug auf uns selbst zu werden.
Während wir in der Meditation dasitzen, tun wir nichts anderes, als die Menschheit und die ganze Schöpfung in Form unserer selbst zu erforschen. Wir selbst können Spezialisten werden für Wut, Eifersucht und Selbstverurteilung oder aber für Freude, Klarheit und Einsicht. Alles, was Menschen empfinden, empfinden wir auch. Wir können äußerst weise und empfänglich der ganzen Menschheit gegenüber werden, indem wir einfach nur uns selbst kennen, so, wie wir sind.
Hier geht es wieder um die liebende Zuwendung, wenngleich von einem etwas anderen Blickwinkel aus gesehen. Der Urgrund der liebenden Zuwendung ist dieses Gefühl der Zufriedenheit damit, wer man ist und was man hat. Der Weg dorthin ist ein Gefühl des Staunens, wieder wie ein zwei- oder dreijähriges Kind sein, alles wissen wollen, was nicht gewußt werden kann, alles in Frage stellen. Wir wissen, daß wir niemals wirklich die Antworten finden werden, denn solche Fragen entstehen aus einem Heißhunger, einer Leidenschaft für das Leben heraus – sie haben nichts damit zu tun, irgendeine Lösung zu finden oder alles zu einem ordentlichen Paket zusammenzuschnüren. Diese Art zu fragen, ist die Reise selbst. Worauf sie hinausläuft, ist die Erkenntnis unserer Verwandtschaft mit der ganzen Menschheit. Wir erkennen, daß wir an allem teilhaben, was alle anderen haben und sind. Dieser Weg, mit uns selbst Freundschaft zu schließen, hat nichts mit Selbstsucht zu tun. Wir versuchen nicht, alles Gute für uns selbst herauszuschlagen. Es handelt sich vielmehr um einen Prozeß, liebende Zuwendung und echtes Verständnis auch in bezug auf andere Menschen zu entwickeln.
Unsere wahre Natur finden
In einer seiner Lehrreden spricht Buddha von den vier Arten von Pferden: dem ausgezeichneten Pferd, dem guten Pferd, dem schlechten Pferd und dem sehr schlechten Pferd. Das ausgezeichnete Pferd, so heißt es im Sutra*, bewegt sich schon, bevor die Peitsche seinen Rücken überhaupt berührt; der bloße Schatten der Peitsche oder das geringste Geräusch vom Kutscher reicht aus, um das Pferd anzutreiben. Das gute Pferd rennt bei der geringsten Berührung der Peitsche auf seinem Rücken. Das schlechte Pferd rennt erst, wenn es Schmerz empfindet, und das sehr schlechte Pferd rührt sich nicht von der Stelle, bis der Schmerz ihm nicht durch Mark und Bein gegangen ist.
Wenn Shunryu Suzuki in seinem Buch Zen-Geist, Anfänger-Geist diese Geschichte erzählt, sagt er, daß seine Schüler, wenn sie diese Geschichte gehört haben, immer das beste Pferd sein wollen, daß es aber, wenn wir sitzen, im Grunde völlig gleich ist, ob wir das beste Pferd oder das schlechteste Pferd sind. Er sagt dann auch, daß das wirklich schlechte Pferd im Sinne der Übung dennoch das beste ist.
Was ich im Laufe meiner Meditationspraxis erkannt habe, ist, daß es nicht darum geht, das beste Pferd oder das gute Pferd oder das schlechte Pferd oder das sehr schlechte Pferd zu sein. Es geht vielmehr darum, unsere wahre Natur zu finden und aus dieser heraus zu sprechen und zu handeln. Was auch immer unsere besondere Eigenschaft ist, darin besteht unser Reichtum, unsere Schönheit; darauf reagieren andere Menschen.
Einmal hatte ich Gelegenheit, mit Chögyam Trungpa Rinpoche darüber zu sprechen, daß ich es nicht schaffte, meine Meditationspraxis richtig durchzuführen. Ich hatte gerade mit den Vajrayana*-Praktiken begonnen und sollte beim Üben visualisieren. Ich konnte aber überhaupt nichts visualisieren. Ich bemühte mich noch und noch, aber es tat sich überhaupt nichts; ich fühlte mich bei der Übung wie eine Betrügerin, weil sie mir so unnatürlich vorkam. Ich war ganz unglücklich, weil alle anderen offenbar alles mögliche visualierten und sich dabei anscheinend nicht schwer taten. Dazu sagte Rinpoche: »Ich bin immer mißtrauisch bei denen, die sagen, daß alles gut läuft. Wenn du meinst, es laufe alles gut, kommt das meistens von irgendeiner Art von Arroganz. Wenn es dir allzu leicht fällt, dann entspannst du dich zu sehr. Du bemühst dich nicht wirklich, und so erfährst du nie, was es bedeutet, voll und ganz Mensch zu sein.« Er ermutigte mich also, indem er mir sagte, daß man gut übt, solange man solcherlei Zweifel hat. Wenn man aber anfängt zu meinen, alles sei perfekt, und sich selbstgefällig und den anderen überlegen fühlt, dann ist Vorsicht geboten!
Dainin Katagiri Roshi erzählte einmal eine Geschichte über seine eigene Erfahrung, das schlechteste Pferd zu sein. Als er das erste Mal aus Japan in die Vereinigten Staaten kam, war er ein junger Mönch Ende zwanzig. Er war lange Zeit in Japan Mönch gewesen – wo alles sehr genau, sehr sauber, sehr ordentlich zugeht. In den U.S.A. waren seine Schüler lauter barfüßige Hippies mit langen, ungewaschenen Haaren und zerlumpten Kleidern. Er mochte sie nicht. Er konnte nichts dafür, aber er konnte diese Hippies einfach nicht ausstehen. Ihre ganze Art beleidigte ihn zutiefst. Er sagte: »Den ganzen Tag hielt ich also Vorträge über Mitgefühl, und abends ging ich nach Hause und heulte, weil ich erkannte, daß ich überhaupt kein Mitgefühl hatte. Weil ich meine Schüler nicht mochte, mußte ich viel härter arbeiten, um mein Herz zu entwickeln.« Wie Suzuki Roshi mit seinem Beispiel klarmacht, geht es um genau diesen Punkt: Wenn wir uns selbst in der Rolle des schlechtesten Pferdes wiederfinden, werden wir inspiriert, uns stärker zu bemühen.
In Gampo Abbey hatten wir einmal einen tibetischen Mönch, Lama Sherap Tendar, der uns beibrachte, wie man die tibetischen Musikinstrumente spielt. Uns standen 49 Tage zur Verfügung, um das Instrumentenspiel zu lernen; und wir sollten während dieser Zeit, so dachten wir, auch vieles andere lernen. Wie es sich aber herausstellte, taten wir 49 Tage lang zweimal am Tag nichts anderes, als zu lernen, wie man die Zimbel und die Trommel schlägt und wie man die beiden zusammen spielt. Wir übten und übten, jeden Tag. Wir übten allein, und dann spielten wir dem Lama Sherap vor, der immer dasaß und so eine kleine, gequälte Miene machte. Dann nahm er unsere Hände und zeigte uns, wie man richtig spielt. Dann machten wir es wieder alleine, und dann seufzte er immer. Und so ging es 49 Tage lang. Er sagte nie, daß wir es gut machten, aber er war sehr liebenswürdig und sehr sanft. Zum Schluß, als alles vorbei war und wir unser letztes Vorspiel gegeben hatten, prosteten wir uns gegenseitig zu und hielten kleine Reden, und dann sagte Lama Sherap: »Eigentlich habt ihr sehr gut gespielt. Ihr habt von Anfang an sehr gut gespielt, aber ich wußte, wenn ich euch sage, ihr spielt gut, dann bemüht ihr euch nicht mehr.« Er hatte recht. Er hatte eine so sanfte Art, uns zu ermutigen, daß wir deswegen keine Wut auf ihn bekamen und den Mut nicht verloren. Wir bekamen einfach das Gefühl, daß er wußte, wie man die Zimbel richtig spielt, daß er diese Zimbel seit seiner frühesten Jugend gespielt hatte und daß wir uns einfach weiterhin bemühen mußten. Während der 49 Tage arbeiteten wir also sehr hart.
In der gleichen Weise können wir auch an uns selbst arbeiten. Wir müssen nicht hart mit uns sein, wenn wir beim Sitzen das Gefühl haben, unsere Medition oder unser oryoki oder unsere Art, in der Welt zu sein, sei in der Kategorie des schlechtesten Pferdes. Wir könnten damit großes Mitgefühl haben und daraus die Motivation für unsere Bemühungen ziehen, uns weiterzuentwickeln, unsere wahre Natur zu finden. Dabei werden wir nicht nur unsere wahre Natur finden, sondern wir werden auch viel über andere Menschen lernen, denn im Grunde ihres Herzens kommen sich die meisten von uns wie das schlechteste Pferd vor. Vielleicht hältst du dich oder einen anderen für einen arroganten Menschen, aber jeder, der auch nur einen Augenblick lang Arroganz verspürt hat, weiß, daß sie nichts anderes ist als eine Tarnung für das Gefühl, daß man in Wirklichkeit das allerschlechteste Pferd ist, und der Versuch, ständig das Gegenteil zu beweisen.
In seinem Vortrag sagt Suzuki Roshi, daß die Meditation und der ganze Prozeß der Suche nach der eigenen wahren Natur eine einzige Kette von Fehlern ist und daß das kein Grund zur Depression oder zur Entmutigung sein soll, sondern vielmehr die Motivation zum Weitermachen darstellt. Wenn man sich in der Meditation beim Zusammensacken ertappt, ist das die Motivation, sich stärker aufzurichten, nicht, um das eigene Selbst schlechtzumachen, sondern vielmehr aus einem Gefühl des Stolzes auf alles, was einem widerfährt, aus Stolz darauf, wer man ist, so, wie man gerade ist, aus Stolz auf die eigene Güte oder Gerechtigkeit oder Schlechtigkeit – wie man sich eben vorfindet –, aus einem Gefühl heraus, daß man den Stolz nimmt und ihn einsetzt, um sich selbst anzuspornen.
Die Karma Kagyü-Übertragungslinie des tibetischen Buddhismus, in der die Schüler von Chögyam Trungpa ausgebildet werden, wird manchmal die »Übertragungslinie des Mißgeschicks« genannt wegen der Abenteuerlichkeiten, in die sich die weisen und ehrwürdigen Lehrer dieser Linie immer wieder stürzten. Am Anfang war Tilopa, der ein Verrückter war, völlig irre. Sein wichtigster Schüler war Naropa. Naropa war dermaßen intellektuell und verkopft, daß er zwölf Jahre des Zermalmens, der schwersten Prüfungen durch seinen Lehrer über sich ergehen lassen mußte, damit er überhaupt begann aufzuwachen. Er war dermaßen in der Begrifflichkeit gefangen, daß er immer, wenn jemand ihm etwas erzählte, erwiderte: »O ja, aber damit meinen Sie doch sicher dieses.« So funktionierte eben sein Kopf. Sein wichtigster Schüler war Marpa, der berüchtigt war wegen seiner schrecklichen Wutanfälle. Er geriet ständig in Rage und schlug und schrie auf Menschen ein. Überdies war er ein Säufer und auch dafür bekannt, unglaublich dickköpfig zu sein. Sein Schüler war Milarepa. Milarepa war ein Mörder! Rinpoche sagte immer, daß Marpa Schüler des Dharma wurde, weil er meinte, viel Geld machen zu können, indem er Texte aus Indien mitbrachte und sie ins Tibetische übersetzte. Sein Schüler Milarepa wurde Dharma-Schüler, weil er Angst hatte, in der Hölle zu landen, weil er Menschen umgebracht hatte.