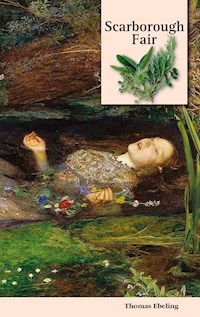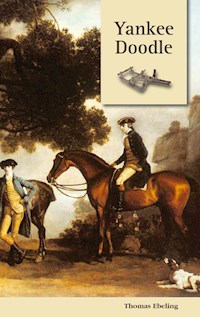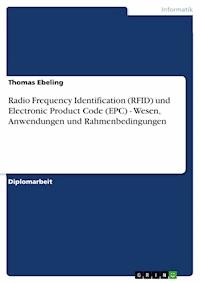Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Benjamin Jenkins
- Sprache: Deutsch
Das Ende der britischen Herrschaft in Virginia. Lord John Murray Earl of Dunmore, Gouverneur und Oberbefehlshaber der britischen Streitkräfte in Virginia verlässt Amerika. Mit ihm fahren nicht nur seine Familie, seine Bediensteten, sein Stab und ein Teil seiner Soldaten zurück nach England, auch Benjamin und Molly Jenkins, ein junges Ehepaar aus Irland befindet sich an Bord seines Schiffes. Alle Pläne und Hoffnungen, die sie in der neuen Welt entwickelten, sind zunichte gemacht worden. Erneut werden sie in die Intrigenspiele der Mächtigen hineingezogen... Nun müssen sie sich den Schatten ihrer Vergangenheit stellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zu diesem Buch:
HMS Fowey
Hummer
Segel am Horizont
Der Lehrer
Spithead
Schottland
Gartenkunst
London
Die Entdeckung
Salonkonzert
Handel
Lester Bonham
Abreise
Dublin
Im Pub
Investigation
Musikabend
Empfehlung
Geburt
London, Frühjahr 1778
Der Gehstock
Der Auftrag
Beschattung
Kriegserklärung
Satisfaktion
Nachtdienst
Wiedersehen
Der letzte Morgen
Drei Schüsse
Oktober 1778
London Winter 1778
Epilog
Danke
Weitere Bücher des Autors:
5 BÄNDE BENJAMIN JENKINS
KIES VAN BEEK - TOD AN DER GRACHT
KIES VAN BEEK - GRAB IM MEER
ANDEO, FISCHERJUNGE
ZU DIESEM BUCH:
Diese Geschichte vor historischem Hintergrund ist frei erfunden. Historische Personen wurden erwähnt, ihre charakterlichen Eigenschaften sind aber von mir angedichtet. Ihr Andenken sollte in keinster Weise beschädigt werden. Da ich verschiedene historische Quellen benutzte, kann es hier zu Ungenauigkeiten gekommen sein. Das Lied Loch Lomond besingt die Heimkehr zweier schottischer Soldaten nach der Niederlage bei Culloden 1745. Beide wurden gefangengenommen, einer zum Tode verurteilt, der andere freigelassen. Der eine, Hingerichtete, nimmt die »low road«, den Pfad des Todes und ist so früher am Ziel als der Überlebende auf der »high road«. Des weiteren singt der dem Tode Geweihte davon, seine Geliebte an den schönen Ufern des Loch Lomond niemals wiedersehen zu dürfen. Komponist und Autor sind leider unbekannt.
Auch der Weg von Ben und Molly führt sie in diesem fünften Teil nach Schottland, wo sie nun versuchen, endlich Ruhe zu finden. Doch reichen die Schatten der Vergangenheit auch bis hierher?
HMS Fowey
Mit lautem Gepolter erwachte die schwere Ankerkette zum Leben. Insgesamt 18 Männer hatten sich mit aller Kraft in die Spaken des Gangspills gelegt, um mit Hilfe dieser großen, senkrecht stehenden Winde den tonnenschweren Anker der »HMS Fowey« aus dem Grund zu reißen. Es war früh am Morgen dieses Junitages 1776 in den Gewässern vor New York, wohin sich das Schiff mit dem letzten britischen Gouverneur von Virginia an Bord vor drei Monaten zurückgezogen hatte. Nun sollte sie die Reise zurück ins Mutterland antreten, zum einen, um überholt zu werden, zum anderen, um zu helfen, neue Truppen aus England herbeizuschaffen. In diesem Konflikt in den Kolonien musste ein Wendepunkt herbeigeführt werden, denn im Moment befand sich die britische Armee überall in der Defensive. Boston war genauso gefallen wie Virginia. Auch hier in New York waren die Loyalisten in der Minderheit, man ging davon aus, dass Washington die Stadt nun gegen die Briten befestigen wollte. In den anderen Kolonien Nordamerikas drohte ebenfalls die Niederlage. Nur in den nördlichen kanadischen Provinzen Québec, Nova Scotia und New Brunswick war die Lage stabil und die Bevölkerung loyal geblieben. Einen Angriff der Patrioten auf diese Provinzen hatte man erfolgreich abwehren können. Eigentlich hätte Lord Dunmore schon einen Monat früher diese Reise antreten wollen, doch wegen der anhaltenden Versorgungsengpässe hatte das Ausrüsten der Fregatte viel länger als geplant gedauert. Zudem hatte man noch auf zwei Passagiere gewartet, die gegen einen gefangenen amerikanischen Rebellenoffizier ausgetauscht worden waren. Dunmore selbst hatte darauf bestanden, diesen Austausch durchzuführen, denn es ging um eine Dame aus der anglo-irischen Aristokratie und ihren Mann, die man auf einer Plantage in Virginia gefangen gehalten hatte. Dunmore war diese Lady zwar unbekannt, er wollte es jedoch nicht riskieren, in England nicht nur als Versager dazustehen, sondern auch noch als ein Mann, der nicht alles getan hat, was in seiner Macht stand, eine Dame von hoher Geburt aus den Fängen der Rebellen zu entreißen. Natürlich würde er noch prüfen müssen, ob es sich bei besagter Dame nicht um eine Hochstaplerin handelte.
Jedoch, als Versager sah er sich nicht, in langen Erklärungen hatte er bereits nach England geschrieben, dass er nur durch Verrat, Untreue und fehlende Unterstützung die Gewalt über die Kolonie verloren habe. Seine einflussreichen Freunde und Beziehungen in London, deren er sich sicher sein konnte, hatten zudem dafür gesorgt, dass er den Titel des Gouverneurs von Virginia zeitlebens führen würde. Ob nun diese Kolonie noch zum britischen Empire gehörte, oder nicht, war dafür belanglos.
Seine Lordschaft befand sich nicht an Deck, als der Befehl zum Auslaufen gegeben wurde. Er saß gemütlich in seinem Bett und ließ sich eine erste Tasse Kaffee servieren. Später würde er vielleicht nach oben gehen, um einen letzten Blick auf die amerikanische Küste zu werfen. Aber eigentlich war ihm das egal. Er freute sich vielmehr, endlich nach Hause zu kommen und diese lästigen politischen Geschäfte einmal ruhen zu lassen. Sicherlich, er würde vor dem Parlament sprechen und seine Niederlage eingestehen müssen. Aber auch das würde er überstehen.
Zunächst ließ er sich einen Nachttopf bringen, denn wenn das Schiff erst einmal die geschützten Gewässer verlassen hatte, würde der Seegang diesen Vorgang und so vieles andere erheblich erschweren.
Die perfekt eingespielte Mannschaft der »Fowey« zeigte sich in bester Verfassung, alle Manöver liefen präzise wie ein Uhrwerk ab. Jahrelanger Drill, strengste Disziplin und unbedingter Gehorsam galten als Garanten des Erfolges der Royal Navy. Das hatten alle ihre Offiziere bereits als Kadetten und Anwärter verinnerlicht. Wer das nicht mit jeder Faser seines Seemannsdaseins lebte, hatte hier niemals die Chance auf Beförderung.
Die »HMS Fowey« war mit ihren beinahe 30 Jahren zwar eine etwas betagte, aber immer noch schnelle Fregatte 6. Ranges. Schiffe wie diese waren das Rückgrat der Royal Navy. Natürlich gab es die Linienschiffe, Zwei- und Dreidecker mit bis zu hundert Kanonen. Sie würden eine Fregatte wie die Fowey mit einer einzigen Breitseite vom Wasser fegen. Doch so einem Koloss würde man einfach davon segeln, oder ihn ausmanövrieren. Nur ein gezielter Treffer von hinten auf das Ruder und auch das größte Schiff konnte besiegt werden. Ausserdem waren diese großen Schiffe teuer in Anschaffung und Unterhalt, so dass die Marine in Friedenszeiten immer so viele davon wie möglich stilllegte. Doch nun, mit der Ausweitung des Konflikts in Amerika waren wieder einige in Dienst gestellt worden. Das Empire rüstete auf.
Hier, in den amerikanischen Gewässern, gab es jedoch keine ebenbürtigen Gegner für die Fregatten König Georges.
Nur die Franzosen hatten gleichwertige Schiffe aufzubieten. Ihr Eingreifen hätte aber einen großen Krieg in Europa nach sich gezogen.
Dunmore sah sich selbst bei dieser Fahrt nur als privilegierter Passagier. Zugegeben, sehr privilegiert. Er hatte seine Familie, seine Leibwache, bestehend aus 20 Highländern, seinen Stab und Entourage, insgesamt nocheinmal zehn Personen, dabei. Seinen Sekretär, Mr Price, seine Adjutanten, drei seiner Diener, den Koch und seine Gehilfen und Mr. Whiser, seinen Baumeister und gleichzeitig Lehrer seiner Kinder. Diesen schleppte er schon seit Jahren in der Welt mit sich herum, damit dieser Inspiration bekam. Er war ein Schüler von Sir William Chambers, dem berühmtesten Baumeister Englands. Er hatte für Dunmore schon einige repräsentative Bauwerke erstellt, unter anderem sein Sommerhaus bei Falkirk. Dorthin wollte Dunmore nun zurückkehren, um es zu vollenden.
Dunmore war auch ohne Gouverneursposten sehr reich und angesehen. Er kehrte nicht wie ein geschlagener Hund zurück nach England. Er sah sich eher wie einer der tragischen Helden im antiken Griechenland, die Reisen selbst waren das Ziel. Hatten sie nicht auch Königreiche erobert und wieder verloren, um am Ende zurückzukehren als wahre Helden?
Drüber sinnierte er bei seinem Morgengeschäftnach. Je mehr er sich an diesen Gedanken gewöhnte, desto mehr gefiel er sich darin. Schließlich kam das Schiff mehr und mehr in Bewegung und Dunmore rief nach seinem Diener, dass er ihn rasieren sollte. Auch dieser Vorgang würde in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt nicht immer ohne weiteres möglich sein.
»Sieht man noch Land, Sparks?«, fragte er seinen Leibdiener.
»Oh, ja, Sir! Man sieht noch sehr schön die Küstenlinie achteraus«, gab dieser freundlich zurück. Er war schon so lange in Diensten des Lords, dass er jede, noch so kleinste Gefühlsregung seines Herrn kannte. Und in seiner Frage hatte Sparks sofort etwas Anspannung erkannt.
»Nun, dann beeil‘ Dich. Ich möchte einen letzten Blick auf diesen verfluchten Kontinent werfen! Und richte Lady Charlotte aus, dass ich mit ihr in einer Stunde frühstücken werde!«
Seine Frau, Lady Charlotte, logierte mit den Kindern in der geräumigen Heckkabine, die eigentlich dem Kapitän vorbehalten war. Dieser hatte sich gezwungenermaßen in eine Leutnantskabine begeben müssen, die Offiziere in die der Unteroffiziere. Dies hatte bis zu den niederen Rängen Folgen, sodass Maate wieder bei den einfachen Matrosen in den Logis vor dem Mast gelandet waren.
Etwa zehn Minuten später stand Sir John Murray, 4. Earl of Dunmore, an der Heckreling der Fregatte. Eine sanfte Dünung hob das Schiff auf und ab, während es durch die Seen glitt.
Wehmütig blickte der Lord achteraus. Ihn beschlich das Gefühl, dass er niemals wiederkehren würde. Immerhin hatte er viele Jahre in Williamsburg von seiner Residenz aus die Geschicke der Kolonie gelenkt. In den letzten fünf Monaten hatte er alles daran gesetzt, so schnell wie möglich wieder in Virginia Fuß zu fassen. Jetzt war er jedoch zur Überzeugung gekommen, dass dies nicht sein Weg war. Beinahe hätte er es ausgesprochen: Nur schnell weg!
»Eure Lordschaft, Sir? Verzeihen Sie, dass wir Sie hier so überfallen«, hörte er plötzlich eine Stimme hinter sich. Dunmore wandte sich um. Ihm gegenüber stand ein junger, groß gewachsener, schlanker Mann, Anfang zwanzig in einem schwarzen Gehrock, an seinem Arm eine etwa ebenso junge Dame, kleiner, aber sehr anmutig. Sie trug ein rosafarbenes Kleid und einen hellen Haubenhut, der am Kinn zusammengebundenwar, um nicht vom Wind verweht zu werden. Der junge Mann hatte seinen Hut in die Hand genommen, er hatte rabenschwarzes langes Haar, das zwar im Nacken zusammengebunden war, aber in Strähnen im Wind flog. Beide erwiesen dem hohen Herren Ehrerbietung, er durch Verbeugung, sie durch einen Knicks.
»Was zum...«, wollte Dunmore schon beginnen, schließlich störten ihn die beiden jungen Leute in einem sehr emotionalen Moment. Doch Dunmore war ein beherrschter Mann. Zumal er sofort wußte, wer diese beiden waren.
»Ah. Misses Jenkins, Mr. Jenkins, nehme ich an? So lernen wir uns endlich kennen. Sie müssen verzeihen, dass ich Sie nicht früher empfangen habe. Die politischen Geschäfte, Sie verstehen? «
Benjamin war überrascht, dass Dunmore sich rechtfertigte. Das hätte er gar nicht tun müssen. Ein Mann in seiner Position rechtfertigte sich nicht. Er hatte seine Worte sorgsam vorher bedacht, denn von diesem Mann würde ihr weiteres Schicksal abhängen.
»Mylord, wir müssen uns entschuldigen. Wir haben uns noch nicht bedankt, dass Sie uns gerettet haben. Ohne Ihre Intervention hätte man uns niemals gegen Captain Payton ausgetauscht.«
»Ich bitte Sie, mein Lieber! Was ist denn so ein Sklaventreiber gegen eine Lady und einen Gentleman aus der Dubliner Society wert?«
Jetzt übertrieb Dunmore in Bens Augen gewaltig. Was hatte man ihm erzählt?
»Und Sie sind also die gebürtige Lady Morgana Harrington? Ich meine,die Schwester von Sir William Godfrey? Ich bin entzückt!«, drehte Dunmore jetzt auf. Er nahm Mollys Hand und deutete einen Handkuss an. Trotz des Windes bemerkte Molly sein Eau de Toilette. Es roch süßlich.
Sie bedankte sich:
»Zuviel der Ehre, Mylord. Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich gar nicht von meinem Bruder...«
»Madame, das müssen wir ja nicht hier besprechen. Ich schlage vor, Sie heute Abend zum ersten Dinner auf See einzuladen! Bitte sagen Sie mir nicht ab! Lady Charlotte, meine Frau, wird sich freuen!«, fiel ihr Dunmore ins Wort.
»Das ist uns eine sehr große Ehre, Mylord! Wir kommen natürlich gerne«, übernahm nun Ben wieder und verneigte sich erneut, wohl wissend, dass der Lord sie beide nicht aus Menschenfreundlichkeit ausgelöst hatte. Sie mussten gut aufpassen, nicht zum Spielball der Herrschenden zu werden. Heute Abend konnten sie vielleicht ausloten, wie Dunmore Mollys Herkunft ausnutzen wollte.
Mit Empfehlungen an Lady Charlotte verabschiedete sich das Ehepaar. Sie mussten das Achterdeck verlassen. Hier an Bord eines Kriegsschiffes hatten sie nur sehr begrenzten Raum, sich zu bewegen. Das Schiff war überfüllt mit Menschen, die zurück nach England wollten. Die meisten davon waren letztendlich Kriegsflüchtlinge.
Es war alles anders als bei der Überfahrt im letzten Jahr. Keiner der Offiziere sprach sie an, ausser einem freundlichen, aber kurzem Gruß. Die Matrosen tippen sich zum Gruß bestenfalls mit dem Finger an Hut oder Mütze und senkten den Blick. Gleich zu Beginn hatte der Kapitän alle Passagiere gebeten, niemanden anzusprechen, der sich im Dienst befand. Auch den Offizieren und Mannschaften war dies befohlen worden, es sollte unbedingt Distanz zwischen den Mannschaften und den Passagieren gewahrt werden. Dennoch waren Ben und Molly privilegiert, sie galten als persönliche Gäste des Lords. Dieser Status sorgte für eine zusätzliche Unnahbarkeit. Vom ersten Moment an fühlte sich Molly isoliert.
»Man traut uns nicht, Ben. Niemand spricht mit uns. Als wären wir Luft!«
»Ja, es scheint so, Liebling. Aber das hier ist ein Kriegsschiff. Und die Navy ist bekannt für ihre eiserne Disziplin. Die Männer haben Befehl, uns in Ruhe zu lassen.«
»Das wird eine grauenvolle Überfahrt. Nur diese Lordschaften als Gesprächspartner? Wie langweilig.«
»Psst. Nicht so laut. Also, ich bin ganz zufrieden mit meiner Begleitung«, sagte Ben und sah Molly liebevoll an, »Dann sind wir wenigstens die meiste Zeit unter uns.«
»Benjamin Jenkins! Wir sind doch immer zusammen. Ich will auch mal mit anderen Leuten reden. Mich interessieren die Leute eben!«
»Andere Leute? Na, hier sind ja fast nur Männer!«
»Na und? Ich mag die Gesellschaft von Männern! Hast Du die Highländer gesehen?«
»Molly!«
Sie grinste. Sie wußte genau, wie sie Ben aus der Fassung bringen konnte und liebte es, damit zu spielen.
»Jedenfalls, ich bin gespannt auf Lady Charlotte. Sie soll sieben Kinder haben.«
»Aha? Ich habe nur drei gesehen. Und alle noch sehr klein.«
»Ich glaube, sechs, acht und zehn Jahre. Es wird sehr interessant werden, mit einer Frau zu sprechen, die schon so viele Geburten hinter sich hat.«
»Das stimmt. Und ich muss herausfinden, was Dunmore mit uns vorhat. Ich glaube nicht, dass er uns nur zum Vergnügen kostenlos nach England bringt.«
»England. Wie ist es da? Ich meine, warst Du schon einmal in London? Es muss eine der glänzendsten Metropolen der Welt sein!«
»Nein, Dublin ist die größte Stadt, die ich bisher sah. Aber ja, Du hast recht. Es muss wirklich eine faszinierende Stadt sein!«
Hummer
»Haben Sie schon einmal so ein stolzes Tier gesehen? Ich schätze diesen Hummer auf mindestens 8 Pfund. Ha! Sehen Sie nur diese gewaltigen Scheren! Ich werde diese Krustentiere vermissen in England. Was sind da schon diese mickrigen Flusskrebse gegen solch ein . . . , ja, königliches Tier?«
Lord Dunmore ergoss sich geradezu in Lobreden über das Meerestier. Ben graute davor. Jetzt fehlte nur noch, dass der Lord ihm als seinem Gast die Ehre überließ das Ding zu zerteilen.
»Jenkins! Machen Sie uns die Freude, und zerlegen Sie dieses Untier! Ich nehme gerne etwas Fleisch aus der Schere!«, rief der Aristokrat, als könne er Gedanken lesen.
»Ich, äh, zu viel der Ehre, Sir.« stammelte Ben unbeholfen.
»Papperlapapp! Legen Sie los! Das Vieh darf nicht kalt werden. Fangen Sie an!«
Ben stand auf und nahm Messer und Gabel zur Hand. Er versuchte, die Gabel in die Schere zu stechen, doch er glitt am Panzer ab. Dunmore grinste. Ben war ihm in die Falle gegangen.
»Sir, wenn Sie erlauben?«, sagte Molly, stand auf und nahm sich des Tieres an. Durch jahrelange Erfahrung mit Meerestieren aller Art hatte sie den Panzer schnell geknackt und tranchierte geschickt das köstliche Fleisch.
»Ben? Bist Du so lieb und gibst mir die Teller? Lady Charlotte, möchten Sie etwas von der Schere, oder lieber von dem zarten Bauchfleisch?«
Dunmores Gesicht erhellte sich mehr und mehr.
»Lady Morgana, ich bin überrascht. Sie machen das, als hätten Sie im Leben nichts anderes getan. Wo haben Sie das gelernt?«
»Von meine Zieheltern, Sir. Sie lebten vom Muschel-und Fischfang. Auch Austern und Muscheln muss man knacken. Und dieser Bursche hier, Sir, ist auch nur ein Meeresbewohner mit harter Schale.«
»Ha! Sie gefallen mir! Wir sollten unsere Kinder auch in die Lehre von Fischern geben. Wissen Sie, ich bin auch ein Mann der Praxis, nicht nur der Theorie.«
Lady Charlotte bedachte die letzte Äußerung ihres Gatten mit einem sehr ernsten Blick.
»Ein Stück vom Bauchfleisch bitte, Mrs. Jenkins. Aber nur ein kleines. Ich mache mir nicht so viel aus diesen Krebsen.« Lady Dunmore vermied es, Molly mit »Lady« anzusprechen.
»Es ist ein Hummer, Liebste. Ein Hardshell Lobster. Der beste Hummer auf der bekannten Welt!«, sagte Dunmore nun etwas beleidigt.
Molly verteilte den Hummer an alle, auch den Kindern gab sie schöne Portionen ab.
»Und Du, Ben? Bauch, Schere oder Kopf?«, fragte Molly und lächelte ihren Mann an. Ben hasste alles, was aus dem Meer kam und einen Panzer oder eine Schale hatte. Auf der Platte lag noch eine ganze Schere und der Kopf des Tieres.
»Schere«, sagte er schmallippig. Insgeheim hatte er gehofft, dass nichts von dem Tier übrig bleiben würde. Aber es war einfach zu groß.
Molly zwickte mit der Hummerzange eine Schere ab und legte sie Ben mit Geklapper auf den Teller. Ungläubig starrte dieser das Teil an. Was sollte das? Wollte sie ihn hier vorführen. Hatte er sich nicht schon genug blamiert?
»So, jetzt zeige ich Dir, wie es am einfachsten geht. Sieh her!«
Molly nahm das Messer, zeigte Ben, wo er es ansetzen musste und deutete die Bewegung an, die er machen sollte. Ben tat, wie ihm gezeigt. Und tatsächlich, der Panzer knackte und gab das weiße Fleisch preis.
»Guten Appetit!«, sagte Molly.
»Ja, genau so! Lernen, indem manes tut!«, frohlockte Dunmore.
»Diener! Wo bleibt der Weißwein? Zum Hummer immer Weißwein, nicht wahr?«, rief er.
»Wie köstlich! Wenn man bedenkt, dass diese Tier vor einer Stunde noch gelebt hat! Nur die Art der Zubereitung ist doch etwas, . . . grausam.«, sagte der Lord und quetschte eine Zitrone auf seinem Hummerfleisch aus.
Ben horchte auf.
»Nun, Kinder? Wollt Ihr unseren Gästen nicht erzählen, wie man einen Hummer zubereitet? Ich glaube, Mr. Jenkins weiß das gar nicht!«, sagte der Lord nun zu seinen Kindern mit einem breiten Grinsen.
»Das weiß doch jedes Kind, Sir! Man kocht sie bei lebendigem Leib!«, rief der jüngste, Leveson.
Ben verzog das Gesicht. Mit einem großen Schluck spülte er er den Bissen hinunter.
Die Kinder lachten. Lord Dunmore tat es ihnen gleich und sogar Lady Charlotte lächelte milde.
Zum Fisch Weißwein, zum Wildbret Rotwein, zum Dessert Port. Ben musste aufpassen, nicht die Kontrolle zu verlieren. Wenn das jeden Abend so ging, würde er zum Alkoholiker werden. Sogar die Kinder bekamen zum Abschluß des Abends vom süßen Portwein. Das gefiel Molly überhaupt nicht. Doch sie sagte zu Bens großer Erleichterung nichts, verzog nur eine Augenbraue. Sie selbst nippte nur an ihrem Weinglasund trank lieber Wasser.
Dunmore redete und redete. Eigentlich brauchte dieser Mann keine Gesprächspartner, denn er redete selbst ohne Unterlass. Er erzählte von seinen Feldzügen, von exotischen Menschen und Tieren, die er gesehen hatte. Vor allem aber erzählte er von seiner Leidenschaft für Botanik und seinen Gartenplänen in Schottland. Es war zwar nicht unbedingt langweilig, ihm zuzuhören, aber eben sehr einseitig. Dunmore fragte nie nach. Direkt nach dem Essen brachte Lady Charlotte die Kinder zu Bett und zog sich dann selbst auch zurück. Molly hätte gerne noch mit ihr gesprochen, aber die unterkühlte Art, welche die Adelige ihr gegenüber an den Tag legte, hatte sie sofort in die Schranken gewiesen. Niemals würde die uneheliche Tochter eines Lords die gleiche gesellschaftliche Akzeptanz erwarten können, wie eine echte Lady.
Als Ben und Molly am späten Abend in ihrer Koje lagen mussten sie sich eingestehen, dass sie hier bestenfalls Statisten waren. Nur so lange sie für Dunmore und seine Familie von Nutzen waren, würde man sie unterstützen.
Alle ihre Pläne und Ziele waren dahin, die Anstellung Bens bei den Paytons genauso wie Mollys Geschäftsidee mit den Nachttöpfen, die sie in Jamestown zurücklassen hatte müssen.