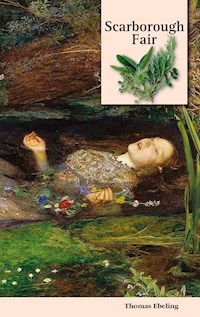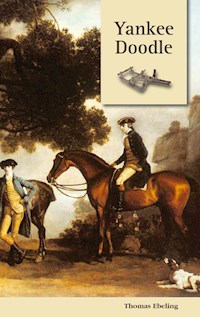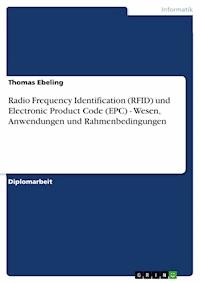Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Benjamin Jenkins
- Sprache: Deutsch
Das frischgebackene Ehepaar Molly und Benjamin Jenkins reist an Bord eines Schoners im Jahr 1775 nach Amerika. Obwohl sich die Kolonien im Aufstand befinden, sind die englischen Machthaber davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis man die Milzen der amerikanischen Kolonisten niedergeschlagen hat. Doch der Handel mit den Kolonien kommt nahezu zum Erliegen. Inzwischen sehen sich einige Geschäftsleute nach anderen lukrativen Einnahmequellen um. Eine lange, gefährliche Seereise liegt vor dem jungen Paar, das sich auf dieser Reise erst richtig kennenlernt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Farewell and adieu to you, Spanish Ladies, farewell and adieu to you, Ladies of Spain, For we ’ve received order to sail for old England, but we hope in a short time to see you again« (Traditional, unknown Author)
ZUDIESEM BUCH:
1775 befinden sich 13 Provinzen in Nordamerika im Aufstand. Der Handel mit den Aufständischen ist verboten, englische Kriegsschiffe blockieren die Häfen. Trotzdem gelingt es an der langen Atlantikküste Amerikas mutigen Schmugglern immer wieder, mit ihren schnellen Schiffen die Blockade zu durchbrechen.
Der Text des Liedes »Spanish Ladies« stammt vermutlich aus napoleonischer Zeit, als britische Seeleute und Soldaten in Spanien kämpften. Der Text verweist auf die Ansteuerung des Ärmelkanals mittels der Landmarken Schily-Inseln und Ushant auf der Ile de Quessant. Weiterhin wird der Weg entlang der südenglischen Küste beschrieben. Gleichzeitig ist es ein kämpferisch, trotziges Lied, voller seemännischer Ausdrücke. Ein Soldatenlied. Es ist also nicht ganz aus der Zeit, in der diese Geschichte spielt, sondern etwa 30 Jahre jünger.
Inhaltsverzeichnis
Ile de Quessant
Sturm
Nacht
Lorient
Regatta
Mr. Cooper
Pistolen und Säbel
Exempel
La Goreé
Samariter
Kurs West
Tischgespräche
Prozess
Machenschaften
Mangel
Medizin
Verdacht
In Flammen
Der neue Kommandant
Epilog
Ile de Quessant
»Wir werden wohl eine stürmische Überfahrt haben, Mr. Jenkins. Um diese Jahreszeit ist selbst die südliche Route in die Kolonien eine ziemlich nasse Angelegenheit. Ich tue selbstverständlich alles, damit sich die Damen an Bord wohl fühlen. Aber es ist nur natürlich, dass sie unter der Seekrankheit leiden. Glauben Sie mir, Sir, das geht vorüber. Wenn wir die irische See hinter uns gelassen haben, werden wir genauer sehen, wie es das Wetter mit uns meint. Sie müssen wissen, mit diesem Schiff können wir bei günstigem Wind eine sehr schnelle Reise machen. Aber das natürlich zu dem Preis, dass es etwas ungemütlich sein wird, für die nächsten Tage und Wochen«, sagte Kapitän Archibald Williams, der breitbeinig auf dem Achterdeck des Schoners stand. Er hielt sich mit einer Hand an einer Brasse fest, die andere hielt er zur Faust geballt hinter seinem Rücken. Er knetete mit den Fingern, denn es war kalt an diesem 16. November 1775 und alle an Deck waren durchnässt und froren.
Benjamin Jenkins und seine junge Ehefrau Molly waren auf dem Weg in die nordamerikanischen Kolonien, um dort die Geschäfte einer Werft zu übernehmen. Leider waren sie gezwungen gewesen, ein Schiff zu nehmen, das noch einen Umweg über die Kapverdischen Inseln nahm, um dort Handelsware umzuschlagen. So würde man die vorherrschenden Winde am Bestennutzen können. Dies sei, wie man ihnen versichert hatte, die gängige Route nach Amerika. Welche Ware allerdings umgeschlagen werden sollte, war Benjamin nicht bekannt. Der Laderaum war fest verschalkt, und das Schiff schien auch nicht sehr schwer beladen zu sein.
Jenkins, der keine Ahnung von Schiffbau und Seefahrt hatte, versuchte bei jeder Gelegenheit so viel wie möglich über das Zusammenspiel von Mannschaft und Schiff, über die Bauweise von Rumpf und Takelage, sowie über die Schiffsführung und Navigation herauszufinden. Dabei war er jedoch schon mehrmals von den Seeleuten hinters Licht geführt worden, die sich eine Spaß daraus machen, der Landratte Jenkins phantasievolle Erklärungen zu allen möglichen Ausrüstungsgegenständen zu geben. Erst als er dem Steuermann eine Entlohnung anbot, begann dieser sein Wissen preiszugeben. Dem Kapitän gefiel das Interesse des jungen Mannes, aber er hatte auch seine Vorbehalte, denn schließlich war er als Schiffsführer darauf aus, das Passagiere und Seeleute stets Distanz wahrten.
»Wie meinen Sie das, dieses Schiff? Ist es etwas besonderes?«, fragte Jenkins, der sich mit beiden Händen festhalten musste, um wegen des Seeganges nicht zu stürzen, oder gleich über Bord zu gehen. Auch er litt an der Seekrankheit, seine Neugier war aber stärker. Und endlich hatte er Gelegenheit, den Kapitän zu fragen.
»Nun, das will ich meinen, Sir! Diese Schiff ist eine neue Konstruktion aus der Provinz Massachusetts. Genauer gesagt, aus Gloucester nördlich von Boston.«
Benjamin nickte. Ihm war schon aufgefallen, das sich Rumpf und Takelage diese Schiffes von den anderen im Hafen unterschieden hatten. Er hatte die fehlenden Rahen bemerkt und auch die relativ kleine Besatzung von 25 Mann kam ihm seltsam vor. Bisher hatte er aber nicht gewagt, seine Beobachtungen kund zu tun und sich mit seinen Fragen eventuell zu blamieren.
Sie waren nun drei Tage von Dublin weg. Der Kapitän hatte wegen des starken Nordwestwindes, der sich mehr und mehr zum Sturm auswuchs die südliche Route um Irland gewählt, in der Hoffnung, dass sich das Wetter bessern möge, wenn man den offenen Atlantik erreichte.
Benjamin sah den Männern zu, die Taue längs des Decks spannten.
»Warum tun die Männer das?«, fragte er den Steuermann.
»Wir erwarten schlechtes Wetter, Sir. Es dient zur Sicherheit.«
»Wie, Sie erwarten schlechtes Wetter? Ist das hier nicht schon schlecht genug?«
Der Steuermann grinste.
»Jedenfalls noch kein Sturm, will ich meinen, Sir.«
Mit jeder Seemeile, mit der man sich dem offenen Atlantik näherte, schien der Wind stärker zu werden. Schon lagen die Scillys an Backbord, ein sicheres Zeichen, dass man viel zu weit nach Süden abgedriftet war. Benjamin machte sich unter großen Mühen auf den Weg zurück zu seiner Kabine, um nach Molly zu sehen. Wegen des starken Seeganges dauerte diese Unterfangen ewig lange. Die Seeleute sahen dem bedauernswerten jungen Mann grinsend nach. Benjamin bekam von der weiteren Diskussion des Kapitäns und seines Steuermannes nichts mehr mit.
Der Steuermann legte dem Kapitän nahe, in den Kanal abzudrehen und in Falmouth einen sicheren Hafen zu suchen und das Wetter abzuwarten. Doch Kapitän Williams winkte ab.
»Liegegebühren, Zeitverzögerung, Kosten über Kosten! Der Hafenverwalter dort ist nicht besser als ein Strandpirat. Wir wollen versuchen, die Ile de Quessant zu umrunden, was uns mit etwas Glück gelingen mag. Notfalls gehen wir in der Bucht von Ushant vor Anker, dort sind wir ebenfalls geschützt.«
»Aber das gehört zu Frankreich, Sir!«, gab Simpson, der Steuermann erschrocken zurück.
»Na und? Im Moment herrscht Frieden. Der Handel läuft gut und es gibt keinen Grund, die Franzosen zu fürchten.«
Der Steuermann schaute mürrisch drein. Zu lange hatte er bei der Navy gedient und gegen die Franzosen gekämpft. Er sprach sogar ein paar Brocken dieser flötenden Sprache. Aber eine englische Hafenschänke war ihm allemal lieber als eine französische. Bei diesem Sturm konnten Tage vergehen, bis man weiterkam. Und bis sich die beiden Nationen wieder bekämpften, würde es auch nicht lange dauern.
»Ist noch etwas, Mr. Simpson? Meine Befehle sind klar! Lassen Sie Segel kürzen. Wir setzen Kurs auf die Ile de Quessant, Ich gehe nach unten und stecke den genauen Kurs ab!«
»Aye, Sir!«, gab der Steuermann mit finsterer Mine zur Antwort.
Auf dem Weg zur Kajüte traf der Kapitän erneut auf Benjamin, der sehr blass aussah. Benjamin versuchte gerade, etwas Wasser für seine junge Frau zu holen.
»Na, junger Freund, geht es Mrs. Jenkins besser?«, fragte er, obwohl das offensichtlich nicht der Fall war.
»Danke der Nachfrage, es geht...«, sagte Benjamin und würge dabei etwas.
»Würden Sie und Mrs. Jenkins mir die Freude machen und heute meine Einladung zum Dinner annehmen? Ich habe auch Mr. Cooper eingeladen. Dann lernen Sie sich endlich kennen.«
»Was? Äh, ich meine, das ist uns natürlich eine hohe Ehre, Sir. Ich, jedoch..., äh. Ich weiß nicht...«
»Sagen wir um sieben?«
Benjamin nickte. Molly würde ihn umbringen. Vorausgesetzt, dass sie überhaupt aufstehen würde können. Seit Tagen lag sie in ihrer Koje, und erbrach alles, was Benjamin versuchte ihr einzuflößen. Nur etwas Wasser und Brot hatte sie behalten können. Dieser Einladung konnten Sie unmöglich nachkommen. Doch trotz allem war Benjamin neugierig auf diesen Cooper, den er bisher noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Zwar hatte Benjamin zwei große Reisekoffer gesehen, die in die Kabine erster Klasse gebracht worden waren, als auch sie an Bord gekommen waren, aber besagten Herren hatte man bis jetzt nicht gesehen. Wahrscheinlich lag auch er seekrank in seiner Koje. Benjamin wollte unbedingt an diesem Dinner teilnehmen, auch wenn klar war, dass er heute kaum einen Bissen hinunterbringen würde.
Sturm
Hatte Benjamin Jenkins gedacht, das Wetter und der Seegang könnten kaum noch schlechter und stärker werden, so hatte er sich damit gründlich getäuscht. Bis zum Nachmittag verstärkte sich der Wind derart, dass fast alle Segel geborgen werden mussten. Die Seeleute zurrten alles fest und die Passagiere durften nicht mehr an Deck. Der Wind wehte nun aus Nordnordwest und schob gewaltige Wellenberge aufeinander. Das Schiff ächzte und knarrte, in den Wanten und Brassen pfiff der Wind und mit dem Donnern und Rauschen der Brecher ergab sich so eine grausame Kakophonie, ein ohrenbetäubender Lärm, der die verängstigten Landratten in ihren Kabinen und Verschlägen um ihr Leben fürchten ließ. Molly und Ben wurden in ihren Kojen hin und her geschleudert, nur die seitlich hochgespannten Segeltuchbarrieren verhinderten, dass sie herausfielen. Es stank nach Erbrochenem, Schweiß und anderen Körperausscheidungen. Zudem war es feucht und bitterkalt. Hatte Molly zunächst noch gehadert und geschimpft, dass Ben sie auf diese Reise gezwungen habe, dass es die Gottes Strafe sei für den Betrug, durch den sie aus Irland geflohen waren, so war sie nun nur noch verängstigt und wimmerte. Benjamin, dem es nicht viel besser ging, versuchte dennoch, sie zu trösten und ihr Mut zuzusprechen, wenngleich die Worte eigentlich für ihn selbst waren.
»Es geht wieder vorüber, jeder Sturm ist einmal zu Ende, Liebste. Wir werden das schon schaffen. Das ist ein gutes Schiff, ganz modern, es ist besonders stark und schnell.«
Da klopfte es an der Kabinentüre.
»Sir? Mylady? Kapitän Williamsbittet untertänigst um Verzeihung, aber das Dinner fällt wegen des Sturmes leider aus. Er bittet Sie um Verständnis«, sagte der Steward, der nicht auf eine Aufforderung die Türe zu öffnen gewartet hatte und einfach den Kopf hereinstreckte.
»Äh, ja, vielen Dank! Sagen Sie dem Kapitän, . . . äh, dass wir das sehr bedauern. Wir wären gerne seiner. . . , Einladung gefolgt«, presste Benjamin hervor. Dabei kam ihm ein Schwall hoch, den er gerade noch mit der Hand zurückhalten konnte.
Der Steward schlug die Türe wieder zu und hangelte sich zurück zum Kapitän. Diese Antwort auszurichten hielt er zwar für überflüssig, aber er konnte sie auch nicht ignorieren. Das Schiff machte inzwischen die wildesten Sprünge und nur sehr erfahrene Seeleute konnten sich noch darauf bewegen. Kaum dass der Mann draussen war, erbrach sich Benjamin erneut in den festgebundenen Eimer neben der Koje. Er fühlte sich hundeelend.
Die Männer an Deck in ihrem Ölzeug hatten sich angeleint, zwei Mann standen am Steuerrad. Es war ihnen kaum mehr möglich, den Kurs zu halten.
Der erste Steuermann war wieder auf dem Wegzum Kapitän, gerade als der Steward die Nachricht von Jenkins ausgerichtet hatte. Die beiden Männer stießen im Gang heftig aneinander, als das Schiff sich wieder senkte und sie mussten sich sekundenlang aneinander festhalten. Fast sah es aus, als wollten sie ein Tänzchen wagen.
»Mach‘ Platz, Smut, ich muss zum Käpt‘n!«, raunte Simpson.
»Mach‘ selber Platz, Simpson! Soll ich mich in Luft auflösen?«
Sie drängten sich in dem Gang aneinander vorbei und Simpson hangelte sich weiter zur Kapitänskajüte.
»Was ist los, Simpson? Warum haben Sie ihren Posten verlassen?«, fuhr ihn der Kapitän an, als der Steuermann vor ihm stand.
»Sir, bei allem Respekt! Wir können den Kurs nicht länger halten! Der Wind wird immer noch stärker und treibt uns zu weit ab. Wir verpassen Quessant. Wir sollten vor Top und Takel lenzen und uns nach Süden in den Golf treiben lassen. Dort haben wir genügend Seeraum!«
»Dann verlieren wir sehr viel Zeit. Das wird dem Eigner nicht gefallen. Aber Sie haben Recht, wenn wir Ushant nicht anlaufen können, und nicht weiter nach Westen kommen, können wir nur beidrehen und hoffen, dass es sich ausbläst.«
»Wenn nicht, laufen wir allerdings Gefahr an der Küste zu zerschellen!«, gab Simpson ängstlich zurück.
»Dann laufen wir einen sicheren Hafen an. Ich kenne die Küste hier gut. Wir werden Lorient ansteuern. Lassen Sie beidrehen! Wir lenzen vor Top und Takel! Ich komme an Deck, wir müssen versuchen, Ushant zu peilen. Wir brauchen unseren Standort! Es wird bald dunkel«
Mithilfe des Phare du Stiff, des Leuchtturmes von Ushant, der seit fast hundert Jahren auf der Ile de Quessant stand, hatte schon so mancher Seemann sein Leben retten können. Sein Licht war Peilmarke in der Nacht, der Turm Landmarke am Tag. Zumindest war es so möglich, eine genaue Linie zu ermitteln auf der sich das Schiff befand. Die Entfernung zum Leuchtturm konnte man nachts nur schätzen, am Tag war diese Einschätzung natürlich wesentlich genauer. Der Turm markierte die südliche Begrenzung der Einfahrt in den Ärmelkanal und galt als der westlichste Punkt Frankreichs. Seine aussergewöhnliche Doppelturmform machte ihn unverkennbar.
Der Steuermann Tom Simpson machte sich seine Gedanken. Schon als Irland noch in Sicht war, hätte man versuchen müssen, so sich so weit westlich wie möglich zu halten. Viel zu lange waren sie auf dem bequemeren Südwest-Kurs geblieben. Die Passagiere waren sowieso seekrank, ein paar Tage Sturm und man wäre auf dem offenen Atlantik gewesen. Nun war es zu spät und der Seeraum begrenzt. Aber er war nicht der Kapitän. Er hatte zu gehorchen.
Als sie an Deck standen, rief Williams den Ausguck im Fockmast an. Seine laute Stimme trotzte dem Orkan. Der Ausguck winkte und zeigte in eine Richtung mehr achterlich als querab.
»Verdammt, wir sind schon längst vorbei. Lassen Sie uns vor den Wind gehen!«, brüllte er Simpson ins Ohr.
Sie mussten die Masten entlasten und alle Segel bergen, damit sie nicht brachen. Nur ein kleines Sturmsegel wurde am Fockmast gesetzt, um das Schiff vor dem Wind zu halten. Die Brecher rollten über das Heck und begruben regelmäßig die beiden Rudergänger unter sich. Der Druck auf das Ruder selbst war jetzt nur noch gering, nur wenn ein Brecher das Heck erfasste, mussten sie es festhalten. Zusätzlich sicherten sie es darum mit starken Tauen. Dann ließ der Schiffsführer die Geschwindigkeit loggen, sie liefen vor dem Sturm mit 7 Knoten. Alle Wanten und Brassen waren hart gespannt, aber die Masten sicher. Noch einmal peilte der Kapitän Ushant, es lag nun beinahe hinter ihnen. Auf diesem Kurs konnten sie nun mindestens 200 Seemeilen laufen, ohne dem Land zu nahe zu kommen. Hinein in Golf von Biscaya.
»Wecken Sie mich, wenn der Wind sich dreht, Simpson! Sie halten Wache!«, rief der Schiffsführer dem Steuermann zu.