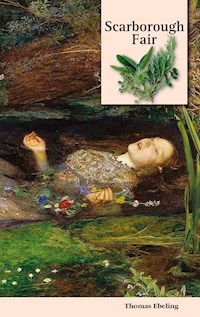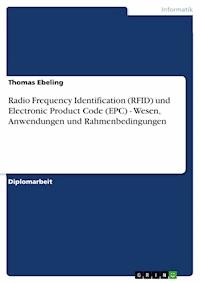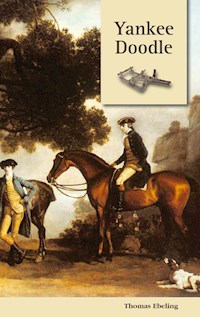
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Benjamin Jenkins
- Sprache: Deutsch
1776 Ben und Molly Jenkins sind in Virginia gestrandet. Ohne Freunde und Fürsprecher müssen sie sich in einer Gesellschaft zurechtfinden, die den Einwanderern aus Irland nicht über den Weg traut. Erst vor kurzem haben sich die Patrioten in Virginia von der Herrschaft der Briten befreit und den letzten Gouverneur, John Murray, Earl of Dunmore, aus dem Land gejagt. Doch der düpierte Gouverneur gibt nicht auf und sucht mit seinen Schiffen die Küsten Virginias plündernd heim.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:
Diese Geschichte ist frei erfunden. Ähnlichkeiten oder Namensgleichungen mit lebenden Personen sind rein zufällig. Ich habe historische Personen erwähnt, aber ihre charakterlichen Eigenschaften sind von mir angedichtet, beziehungsweise interpretiert. Ihr Andenken sollte in keiner Weise gestört werden. Alle historischen Begebenheiten wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, eventuelle Fehler sind aber möglich, weil ich unterschiedliche Quellen benutzte. Darum berufe ich mich auf die künstlerische Freiheit, die Geschichte meiner Protagonisten so zu erzählen, wie ich es tat.
Inhaltsverzeichnis
Zu diesem Buch
Hampton
Die Plantage
Dinner
Tragödie
Plantagenarbeit
Geheime Informationen
Ticonderoga
Neue Ziele
Der Brief
Mr. Pellard
Der Gast
Verfolger
Menschenkenntnis
Mai 1776
Epilog
Impressum
Hampton
»Wir sollten die beiden einsperren! Auch wenn sie noch so sehr beteuern, unbeteiligte Zivilisten zu sein, sind sie doch nicht hier geboren. Ich sage, vertraut niemanden, der nicht hier geboren wurde! Gerade eben erst aus Irland angekommen! Na, und? Sehen Sie sich Euch an, Sir! Sie kommen nicht gerade in Lumpen daher. Sie waren auf einem schnellen Handelsschiff in einer Einzelkabine unterwegs. So sehen keine armen Einwanderer aus Irland aus. Ich halte sie für Spione!«
Colonel Woodford, der Befehlshaber der Revolutionstruppen in Virginia wollte die Sache schnell vom Tisch haben. Zu viele kleine Entscheidungen wurden von ihm verlangt, während er doch eigentlich ganz anderes zu tun hatte. Er ärgerte sich darüber, dass man ihn mit so etwas belästigte. Dass nun dieser Captain aus Jamestown sich hier so engagierte, war ihm eigentlich nicht recht, andererseits wollte er hören, was er vorschlug.
»Es war ein Sklavenschiff. Aber weiter, Captain Payton. Was wollen Sie mir damit sagen?«
»Noch verfügen wir weder über eine geeignete Administration noch über ein Gerichtswesen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als Jenkins und seine Frau unter Beobachtung zu stellen. Ich schlage vor, sie auf einer Plantage unterzubringen. Als unsere Gäste, selbstverständlich. Ich denke da an die Plantage meines Bruders Leroy in der Nähe von Jamestown. In der Abgeschiedenheit wird es ihnen schwer fallen, mit den Briten Kontakt aufzunehmen. Ausserdem haben wir so die Möglichkeit herauszufinden, ob sie überhaupt irgendetwas politisches im Schilde führen. Meine Schwägerin Hannah Philippa ist geradezu prädestiniert, herauszufinden, wer diese Leute sind. Ausserdem können wir sie gegebenenfalls immer noch gegen andere Gefangene austauschen.«
Woodford zögerte. Sollte es sich wirklich um Spione handeln, durfte er keinen Fehler machen. Doch er sah im Moment keine andere Möglichkeit, sie sicher unterzubringen. Wenn dieser Payton die Verantwortung übernahm, um so besser.
»Nun gut, machen Sie das, Payton. Lassen Sie die beiden nach Jamestown bringen. Aber auf Ihre Verantwortung! Damit wäre das geklärt. Die anderen Passagiere verteilen wir auf Familien hier in Hampton. Captain Cooper hat für sie gebürgt«, sagte Woodford.
Die Sache war für ihn erledigt. Er würde sich wieder seiner eigentlichen Aufgabe widmen. Noch immer wüteten die Briten entlang der Küste, nachdem sie Norfolk angegriffen, beschossen und einige Häuser dort in Brand gesetzt hatten. Im Gegenzug hatte Colonel Woodford die Zerstörung der gesamten Stadt angeordnet, um den Briten diesen Stützpunkt endgültig zu entziehen. Es war nämlich nicht klar gewesen, ob man Norfolk gegen die Briten auf Dauer hätte halten können, denn viele der Einwohner waren Loyalisten gewesen, die nun auf der Flucht oder auf den britischen Schiffen waren. So hatten die Colonels Woodford und Howe seitens der Patrioten eine sehr unangenehme Entscheidung treffen müssen, die sie im Nachhinein propagandistisch den Briten in Schuhe zu schieben versuchten.
Sir John Murray, 4. Earl of Dunmore auf der anderen Seite tat das Gleiche, auch er gab die Schuld der Gegenseite. Dunmore, der britische Gouverneur von Virginia, hatte im letzten Jahr einen Fehler nach dem anderen gemacht. War er zunächst beim Volk äußerst populär gewesen, da er selbst zu Fuß durch Virginia marschiert war, um gegen aufständische Indianer vorzugehen, hatte er danach doch nicht verstanden, dass die Bewohner Virginias inzwischen so selbstbewusst waren, sich nicht weiter durch Steuern und Handelsbeschränkungen knechten zu lassen. Er hätte durchaus die Macht gehabt, zu Gunsten seiner Amerikaner Politik zu betreiben und hätte wegen seiner weitreichenden Befugnisse als eine Art Vizekönig viele Dinge zu deren Wohlwollen regeln können. Aber er war auf der alten, starren Linie geblieben, dass niemand anders entscheiden durfte, wie der König und das Parlament in London es vorgaben. Dabei wären gerade hier regional viele Möglichkeiten vorhanden gewesen, die Amerikaner loyal zu halten. Nein, Dunmore war hart und unverständig geblieben und hatte noch härtere Bedingungen angesetzt, bis er am Ende sogar allen Sklaven, die sich gegen ihre patriotischen Herren auflehnten und flohen, den Dienst in der britischen Armee und die Freiheit versprochen hatte. Für seine eigenen Sklaven galt dies natürlich nicht. Er hatte sogar ein so-genanntes »Äthiopisches Regiment« aufstellen lassen, dass schon einige Erfolge erziehlen hatte können.
Aber nun lag er, seines Stützpunktes verlustig gegangen, mit seinen Schiffen und Soldaten vor der Küste. Norfolk hatte 3 Tage gebrannt, das Leid der geflohenen Bevölkerung war groß, Anfang Januar 1776.
Colonel William Woodford und Colonel Robert Howe ihrerseits hatten ebenfalls große Probleme, ihre Soldaten und die Zivilisten aus Norfolk zu versorgen.
Im Moment verfügte Dunmore über mindestens 3 Fregatten sechsten Ranges mit 20 bis 28 Kanonen und über mehrere kleinere Kriegsschiffe, sie lagen alle im Elizabeth River und bedrohten die Siedlungen. Jetzt galt es für die Amerikaner durchzuhalten und wachsam zu sein, um möglichst zu verhindern, dass sich die Briten mit Lebensmitteln versorgten. Denn nicht nur die Menschen an Land froren und hungerten, auch auf den Schiffen wurde es zu dieser Jahreszeit sehr ungemütlich.
Als Lieutenant Meyers im Auftrag von Captain Payton dem Ehepaar Benjamin und Molly Jenkins die Nachricht über die Entscheidung der Militärs unterbreitete, die ihr weiteres Schicksal maßgeblich beeinflussen sollte, versuchte Ben möglichst gefasst zu reagieren. Die beiden waren in einem Gasthaus in Hampton untergebracht worden, dessen Wirt eine Wuchersumme für ein kleines, schmutziges Zimmer verlangte. Hampton war zwar eine der ältesten englischen Siedlungen in Virginia, aber es hatte sich ein dörflicher Charakter bewahrt. Die Wege hier im Ort waren morastig und aufgeweicht, Ben und Molly konnten kaum vor die Tür. So ähnelte dieses Gasthaus einem Gefängnis, wenngleich die Türen offen waren. Ohne Ortskenntnis und Hilfe war an eine Flucht nicht zu denken.
»Sir, ich habe vollstes Verständnis für Ihr Vorgehen.
Wir fügen uns der Gewalt. Dennoch protestiere ich in aller Form! Ich möchte Sie vor allem fragen, was nun mit unserem Eigentum geschieht. Wir haben auf dem Schiff Kleidung und persönliche Gegenstände zurücklassen müssen. Ich bestehe darauf, dass sie uns zurückerstattet werden! Ausserdem gehört uns eine Ladung feinsten französischen Porzellans, welches der Grundstock unserer Handelstätigkeit hierzulande sein sollte. Wenn wir hier bleiben sollten, wäre das sehr wichtig!«, versuchte Ben mit dem jungen Offizier zu verhandeln.
»Nun, Ihre persönlichen Gegenstände werden Ihnen natürlich zugestanden. Alle Waren und Sklaven an Bord sind beschlagnahmt. Ich fürchte, leider auch das Porzellan. Handelt es sich dabei um Geschirr, oder vielleicht um Vasen?«
»Es handelt sich um einen größeren Posten Bourdalous. Äh, Pot de Chambre, vornehmlich zum..., äh, Gebrauch von Damen. Wir konnten diesen Posten unterwegs von Mr., äh..., ich meine, Captain Cooper erwerben. Ich wundere mich doch sehr, dass so ein Ehrenmann von ihm verkaufte Ware nun auf diese Weise wieder zurückfordert. Schließlich haben wir in Gold bezahlt!«
»Ich, äh, da muss ich..., an Captain Cooper selbst verweisen. Mir sind da leider die Hände gebunden. Tut mir leid, Sir!«, sagte Meyers etwas verlegen.
»Und meine Kleider? Wollen Sie sich die auch unter den Nagel reissen?«, fragte nun Molly mit einem leicht aggressiven Unterton.
»Madame, ich werde mich selbst darum kümmern. Gibt es an Bord eine Person Ihres Vertrauens, die ich beauftragen kann, die Sachen zu holen?«, fragte Meyersetwas betreten.
»Nun, ich denke, Mr. Haynes könnte die Sachen bringen. Er hat sich meines Wissens zum Dienst in Ihrer neuen Navy gemeldet. Und was unsere Ware angeht, ich werde Mr. Cooper schreiben. Würden Sie die Freundlichkeit haben, ihm diesen Brief dann zu überbringen?«, gab Ben nach einer kurzen Denkpause zurück. Wenigstens gab es nun die Aussicht auf einen kleinen Erfolg.
»Natürlich, Mr. Jenkins. Haynes, sagten Sie? Ja, richtig. Er lag in Ketten, als wir das Schiff übernahmen. Sind Sie sicher, dass er zuverlässig ist?«
»Unbedingt, Lieutenant. Ich wüsste sonst keinen anderen.«
»Nun gut. Das ist leider alles, was ich im Moment für Sie tun kann. Meine Order lautet, mit der »Bride of Boston« so schnell wie möglich auszulaufen.«
Die Plantage
Die Kutsche, die das Ehepaar Jenkins abholte, war ein klobiges Fuhrwerk und eigentlich zum Transport von schweren Waren gebaut. Sie wurde von zwei starken Pferden gezogen. Auf dem Bock saß in einen schäbigen, aber scheinbar warmen Mantel dick eingepackt ein Mann, der afrikanischer Herkunft war und zwei Soldaten der Miliz. Die Soldaten waren sehr jung, sie froren in ihren einfachen Uniformröcken und versuchten sich zu wärmen, indem sie ihre Arme vor der Brust verschränkt und die Hände unter die Achseln geschoben hatten. Zusätzlich hatten sie sich in Decken gehüllt und auch ihre Beine und Füße mit dicken Gamaschen umwickelt. Sie machten keine Anstalten zu helfen, als Benjamin die beiden schweren Überseekoffer auf die Ladefläche wuchtete. Wenigstens diese hatten sie zurückerhalten. Die gesamte Ladung der »Bride« blieb requiriert. Dann half Ben Molly auf das Gefährt, und kletterte schließlich selbst hinauf. Für eine übertrieben teure Summe hatte ihnen der Wirt eine Wolldecke verkauft, die sie sich nun teilten, um nicht völlig schutzlos auf der offenen Ladefläche zu sitzen. Sie hatten entgegen der Fahrtrichtung auf dem Boden Platz nehmen müssen, damit sie sich an die Rückseite des Kutschbocks lehnen konnten. Es war sehr früh am Morgen und noch nicht ganz hell. Die Pfützen auf den Wegen waren mit einer dünnen Eisschicht bedeckt, darunter stand jedoch eiskalter Schlamm. Die dünnen Eisplatten zerbrachen krachend, als sich Pferde und Wagen darüber bewegten.
Die Soldaten sprachen kein Wort. Der schwarze Kutscher ließ nur ein leises »Hü!« oder »Hoh!« hören oder er schnalzte mit der Zunge im Backen, um die Pferde anzutreiben. Seine Art, Pferde und Wagen zu lenken war sehr entspannt, er nutze nie die Peitsche. Als sie eine kleine Anhöhe oberhalb der Stadt erreicht hatten, konnte man im Morgengrauen den Hafen erkennen. Die »Bride of Boston«, die sie hierher gebracht hatte, war bereits verschwunden. Auch alle anderen Schiffe und Boote hatten sich entfernt, denn man erwartete jederzeit einen Angriff der Briten.
»Wie weit ist es denn bis zu unserem Ziel, Herr Kutscher?«, fragte Ben schließlich, der irgendwie Kontakt mit den Männern auf dem Bock aufnehmen wollte.
»Is‘ weit. Keine Ahnung, wieviele Meilen, Sir«, gab der Mann zurück.
»Schaffen wir das bei diesen schlechten Wegen denn heute überhaupt?«, fragte nun Molly. Sie bekam keine Antwort.
»Hallo? Hören Sie schwer?«
»Weiß nich‘.«
»Was? Ob Sie schwer hören oder ob wir es schaffen?«, sagte Molly, die schon lange eine Abneigung gegen alle Fuhrleute hatte. Und dieser hier schien genau zu ihren Vorurteilen zu passen.
»Molly, lass‘ gut sein«, beschwichtigte sie Ben und versuchte sie abzulenken, »Ist dir kalt, Liebling?«
Doch damit kam er nicht gut an.
»Wenn so einer da vorne hockt, wird‘s mir gleich warm! Unverschämter Kerl. Was bildet der sich ein?«
»Missie, wir kommen heute schon noch an. Machen mittags ne‘ Pause, ich weiß, wo wir einen Tee bekommen. Verlassen Sie sich nur auf Washington!«
»Was? Auf den General? Treffen wir den auch? Das fehlt mir gerade noch!«
»Nee, Misses«, mischte sich nun einer der Soldaten ein und lachte,
»Er heißt Washington. Hat mal dem General gehört, stimmt‘s?«
»Ja, ich war erster Sklave im Hause von General Washington. Aber nun bin ich bei der Familie von Mr. Payton.«
»Ah, dann sind Sie jetzt ein freier Mitarbeiter?«, fragte Molly.
Die beiden Soldaten lachten erneut.
»Liebling, ich denke, Mr. Payton hat Washington dem General abgekauft. Ist es nicht so?«, mischte sich nun Benjamin ein, um Molly weitere Peinlichkeiten zu ersparen.
»Ja. Und Master Leroy hat mich zu Ehren des Generals Washington genannt!«
Molly schüttelte den Kopf. Menschen, die anderen Menschen gehörten. Und sie dann auch noch nach ihren Vorbesitzern benannten. Hatte sie sich schon in Irland über das System der Großgrundbesitzer und deren armen Pächter geärgert, so kam ihr das hier noch viel absurder und menschenverachtender vor. Doch sie wurde schnell von dem Problem abgelenkt. Wieder spürte sie wie schon seit mehreren Tagen ein Ziehen im Unterleib, dass sie vorher nicht gekannt hatte. Es kam in Abständen und war immer schmerzhafter geworden. Zudem war ihr monatliches Bluten zuletzt ausgeblieben. Konnte sie etwa schwanger sein? Doch unerfahren und jung, wie sie war, konnte sie es nicht einschätzen. Auch hatte sie keine weibliche Vertrauensperson an Bord gehabt, die sie hätte fragen können, was dieses Ziehen bedeuten könnte. Mehrmals war sie mit Ben intim gewesen, und es war sehr schön gewesen. Nur beim ersten Mal hatte es etwas weh getan. Die anderen Damen an Bord, wie diese unmögliche Mrs. Longford oder gar die impertinente Mrs. Grand um Rat zu fragen, war für Molly nicht in Frage gekommen. Bestimmt würde das Ziehen bald wieder verschwinden, so wie vorher. Ein Kind zu bekommen, wäre zwar sehr schön für sie als Paar, aber mit ihrer momentan ungewissen Zukunft hatte sie davor Angst. Das Ruckeln und Holpern der Kutsche verursachte zusätzlich Stöße auf Gesäß und Rücken und mehrmals stöhnte Molly auf. Ben war sehr besorgt.
»Geht es, Molly? Es tut mir leid, dass Du das hier ertragen musst. Kutscher! Können Sie denn nicht etwas vorsichtiger fahren?«, sagte er.
»Nee, Weg ist schlecht, tut mir leid, Missie! Aber ich kann Polster machen.«
Washington hielt an und sprang vom Bock. Er hatte neben dem Weg im Wald Moos gesehen und holte ein großes Stück für Molly. Der Kutscher formt ein Kissen daraus und legte ein Stück Plane darüber, damit die Feuchtigkeit im Moos nicht durchdrückte.
»Bitte, da drauf setzten«, sagte er und sah Molly freundlich lächelnd an. Da bemerkte er, dass sie sich den Bauch hielt.
»Oh, Missie bekommt ein Baby, oder? Na, da fahre ich gleich noch vorsichtiger, versprochen!«, sagte er freundlich.
»Was? Stimmt das? Woher..? Ich meine..., wieso..., weiß der das?«, fragte Benjamin seine Frau und sah sie ungläubig an.
»Ich bin mir nicht sicher, Ben. Ja, es kann schon sein.«
»Aha. Ich...«, stammelte Ben.
»Was? Freust Du Dich denn gar nicht?«, sagte Molly etwas beleidigt.
»Doch, doch! Ich freue mich. Sehr sogar. Ich habe nur nicht damit gerechnet. Und ausgerechnet jetzt...«
»Was soll das heißen, ausgerechnet jetzt? Ich weiß selbst, dass wir nicht wissen, was morgen sein wird. Aber glaubst Du, dass ich jetzt nichts besseres zu tun habe, als ein Kind zu bekommen? Ausserdem dauert es ja eine ganze Weile, bis das Kind kommt! Oder willst Du keine Kinder?«,
Molly war jetzt wütend. Aber wenigstens das Ziehen ließ nach.
»Nein, nein, ich meine doch, natürlich! Ich bin sehr, sehr glücklich. Du musst Dich jetzt schonen. Ich sorge für Dich und das Baby. Ich liebe Dich!«, sagte Ben schnell.
»Na, dann herzlichen Glückwunsch!«, sagte einer der Soldaten, »Aber, können wir jetzt endlich weiter?«
»Natürlich! Wir sind bereit, Mr. Washington!«, sagte Ben.
Die Soldaten lachten wieder. Diese Briten. Nannten einen Sklaven Mister. Komische Vögel.
Erst sehr spät, es war schon fast dunkel, erreichten sie die Besitzungen der Familie Payton. Es war feucht und neblig geworden, man konnte kaum noch etwas sehen. Washington machte die Reisenden auf die Ankunft aufmerksam:
»Wir sind da. Payton-Plantation!«
Jetzt zeichneten sich Umrisse eines großen Gebäudes in der Dämmerung ab. Als das Fuhrwerk näher kam, staunten Molly und Ben nicht schlecht, denn in den letzten Stunden hatten sie nur kleine Gehöfte und einzelne Hütten gesehen. Das Herrenhaus hatte vier Säulen vor dem Eingang wie ein antiker Tempel. Es war sehr groß, weiß gestrichen und schien bis auf die Kamine komplett aus Holz gebaut zu sein.