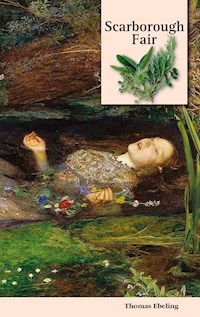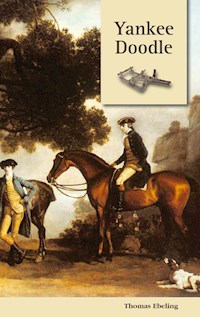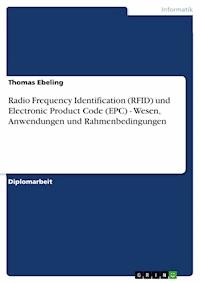Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Benjamin Jenkins
- Sprache: Deutsch
Molly Malone, die Dubliner Fischhändlerin, die durch den gleichnamigen Folksong zur Legende wurde, diente als Inspirationsquelle für diese Novelle. Ihr tragisches Ende bewegt bis heute den romantischen Irlandfan. Jedes Kind in Dublin kennt die heimliche Dubliner Nationalhymne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:
»She died of a fever, and no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone...« Wer war die Frau, die so jung am Fieber sterben musste, im Dublin Ende des 18. Jahrhunderts? Ihr wurde ein Denkmal gesetzt, und jedes Kind in Dublin kennt das Lied über sie...
Diese Geschichte ist frei erfunden. Ein Mann Namens William Godfrey war Ende des 18. Jahrhunderts tatsächlich High Sheriff in Kerry. Seinen Titel als Lord erwarb er jedoch später. Diese historische Person hat aber mit der Person in der Geschichte nichts zu tun, er diente mir nur als Inspiration. Sein Charakter und seine Verhaltensweisen sind völlig frei erfunden. Alle weiteren Namen, bis auf den der Molly Malone sind erfunden. Ähnlichkeiten zu lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
1
»Jenkins! Verdammt, wo steckt der Kerl?«, rief Sir William Godfrey, Lord of Kerry und Mitglied im Oberhaus des irischen Parlamentes seiner Majestät, König George III. von Großbritannien. Godfrey war etwa Mitte Dreißig und ein sehr gut aussehender Mann in der Blüte seiner Jahre. Er war gerade dabei, sich von seinem Diener ankleiden zu lassen und beinahe fertig. In wenigen Minuten wollte er zum Parlamentsgebäude in Dublin aufbrechen. Die Kutsche stand schon vor dem Stadthaus des Lords in der Bishop Street bereit. Sir William war etwas aufgeregt, da seine erste große Rede anstand. Sein neuer Sekretarius Benjamin Jenkins, den er aus der westirischen Provinz mitgebracht hatte, war damit beauftragt worden, sie rhetorisch zu überarbeiten. Dieser junge Mann mit den dunklen Augen und dem schwarzen Haar hatte viele Talente. Das hatte der findige anglo-irische Lord sofort bei ihrem ersten Treffen erkannt. Damit, dass der großgewachsene, schlanke Jüngling zu seinen herausragenden mathematischen Kenntnissen auch noch mit einer ausgesprochen feinen Sprachbegabung und einem äußerst scharfen Verstand gesegnet war, konnte sich der Lord sehr zufrieden schätzen. Dennoch behandelte er seinen Angestellten nicht besser als seine Lakaien, denn ein Untergebener war, was er war. Es gab eben solche und solche. Nützliche und Notwendige. Benjamin Jenkins schätzte Lord Godfrey als beides ein. Es hatte etwas gedauert, bis der junge Mann davon überzeugt werden konnte, mit ihm nach Dublin zu gehen. Einen großen Teil der Zeit im Jahr hielt sich der Lord mit seinem Gefolge in Dublin auf. Seine Gemahlin hingegen blieb mit den Kindern lieber auf dem Landgut in der Nähe von Cork. Seit der Geburt ihres ersten Kindes verabscheute sie mehr und mehr das Stadtleben mit seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen, den Bällen und der affektierten besseren Gesellschaft. Dieses falsche Spiel der feinen Ladys, die sich gepflegt unterhielten und hinter vorgehaltener Hand übereinander lästerten, war ihr ein Gräuel. So zog sie es vor, in Fillbington Hall, dem Landsitz der Godfreys zu leben. Mittlerweile hatte sie vier gesunde Kinder zur Welt gebracht und kümmerte sich um deren Erziehung und die Gärten des Schlosses. Seit einiger Zeit gab es auch einen neuen Verwalter, der den bei einer Verbrecherjagd getöteten Fowler ersetzte. Jenkins stand in schriftlicher Korrespondenz mit dem Mann, er hieß John Harper und schien sauber und loyal zu arbeiten.
»Was halten Sie von Harper, Jenkins?«, hatte Godfrey schon mehrmals gefragt. Jedesmal musste Benjamin ausweichen, denn er kannte ja nur dessen Briefe und Abrechnungen.
»Er schreibt in einem sauberen Stil, seine Abrechnungen sind in sich schlüssig«, sagte er mehr als einmal zu seinem Dienstherren.
»Aber?«, fragte dieser dann jedes mal. Sinngemäß war Jenkins Antwort immer wie diese:
»Kein Aber, Sir. Ich maße mir kein Urteil über einen Menschen an, den ich nur aus Briefen über Geschäfte und Abrechnungen kenne. Vielleicht könnte Lady Godfrey mehr über ihn sagen, Sir? Schließlich hat sie beinahe jeden Tag mit ihm zu tun.«
Ein nachdenkliches »Hm«, war meist die Reaktion Godfreys. Das hätte eine ausführlichere Korrespondenz mit der eigenen Ehefrau bedeutet, die über die üblichen Floskeln hinausging. Godfrey schien dies vermeiden zu wollen. Jedenfalls, in den Briefen, die Jenkins gesehen hatte. Und bereits mehrmals hatte der Lord das Schreiben von Briefen an die eigene Frau seinem Sekretär überlassen. Jenkins tat zwar wie geheißen, fühlte sich dabei allerdings extrem unwohl. Zudem mutmaßte Jenkins, dass die abendlichen Ausflüge Godfreys nicht nur seinem Herrenclub und dem Gasthaus oder Anstandsbesuchen zum Dinner bei der örtlichen Aristokratie galten. Vielmehr hatte der Sekretär den Verdacht, dass der Lord einige Liebschaften nebenbei unterhielt, da er oft sehr spät oder gar nicht nach Hause kam. Auch kamen immer wieder parfümierte Briefe von verschiedenen Damen hier an, die der junge Sekretär mit hochrotem Kopf seinem Herrn diskret unter die sonstige Post legte.
»Übrigens, Jenkins, Sie begleiten mich heute ins Parlament! Ich denke, es ist an der Zeit, Sie meinen Mitabgeordneten vorzustellen. Ausserdem brauche ich Ihre Expertise zu einigen Leuten in meinem Umfeld.«
»Wie, heute?«
»Ja, heute. Jetzt gleich!«
Der junge Sekretär stand mit geöffnetem Mund ungläubig da.
»Glotzen Sie nicht wie ein Schaf, Jenkins! Wir fahren in fünf Minuten!«
Benjamin Jenkins hasste solche spontanen Überraschungen. Natürlich wußte Lord Godfrey das. Es bereitete ihm einen Höllenspaß, den jungen Mann zu schockieren.
»Haben Sie nicht gehört, Jenkins? In fünf, nein, in vier Minuten. Und Sie wissen, ich hasse Unpünktlichkeit!«
Jenkins sah an sich herab. Wie immer trug er seine schwarze Kniebundhose und eine schwarze Weste. Seine Finger waren von Tinte geschwärzt und er hätte sich eigentlich noch rasieren und die Haare bürsten müssen.
Er rannte wie von der Tarantel gestochen aus dem Arbeitszimmer und hechtete die Treppe hinauf zu seiner Kammer im vierten Stock. In Windeseile wusch er sich das Gesicht und die Hände, kämmte schnell die langen, schwarzen Haare nach hinten und band sie im Genick zum Zopf. Für eine schöne Schleife blieb keine Zeit. Dann zog er seinen schwarzen Gehrock schnell vom Haken, dabei gab es ein hässliches Rissgeräusch. Da es aber in der Kammer nur schummriges Licht gab und Benjamin am Gehrock keine Beschädigung erkennen konnte, maß er diesem Geräusch keine weitere Bedeutung bei. Er rannte die Treppe hinunter und erwischte seinen Herrn gerade noch an der Haustüre.
»Keine Sekunde zu früh!«, grinste Sir William und sah auf seine Taschenuhr, »Sie haben meine Rede?«
Benjamin wurde es heiß und kalt. Er rannte zurück ins Arbeitszimmer und griff nach der Mappe mit der Rede. Er warf einen kurzen Blick hinein und sah das Schriftstück. Dann lief er so schnell er konnte zurück zum Hauseingang, stolperte dabei aber im Gang und fiel der Länge nach hin. Die Mappe rutschte ihm aus der Hand und die Blätter flogen durch den Flur. Einer der Lakaien half ihm auf und suchte mit ihm die Blätter zusammen. Immerhin waren es fünfzehn Seiten, extra groß geschrieben, denn Sir Godfreys Augen waren nicht die allerbesten. Der Sekretär seufzte. Er würde in der Kutsche die Reihenfolge nochmal prüfen müssen. Als er dann aus dem Haus trat, regnete es zu allem Übel. Godfrey, der mit Hut und Mantel unter dem Vordach gewartet hatte, wippte ungeduldig mit dem Fuß.
»Das Geld für die Wartezeit des Kutschers ziehe ich Ihnen vom Gehalt ab, Mister. Ich sagte ja, ich hasse Unpünktlichkeit!«, raunte er seinen Angestellten an.
»Jawohl, Sir!«, presste Benjamin heraus. Er ärgerte sich sehr, dass er nicht gleich an die Mappe gedacht hatte. Trotzdem war ihm auch bewusst, dass sein Dienstherr sich einen Spaß daraus machte, ihn zu schikanieren, und es sowieso unmöglich gewesen wäre, solchen Wünsche nachzukommen.
Sir William wußte hingegen genau, dass er nur durch Spontanität Jenkins überraschen konnte, hätte dieser von dem Termin gewusst, wäre er perfekt vorbereitet gewesen. Sir William war aber darauf aus, seine Untergebenen stets klein zu halten und solche spontanen und unmöglich zu erfüllenden Aufgaben empfand er als probates Mittel zu diesem Zweck.
In der Kutsche redete Sir William dann ununterbrochen, er war nun doch sehr aufgeregt und nervös wegen seiner ersten Rede vor dem hohen Haus. Es ging um einiges, wie zum Beispiel die Idee der Irish Volunteers, die als eine Art irischer Bürgerwehr gegründet werden sollten, denn immer mehr Truppen mussten wegen der aufständischen Kolonisten in Übersee aus Irland abgezogen werden. Es bestand die Befürchtung, dass Irland so schutzlos gegen feindliche Invasoren, wie zum Beispiel Frankreich, sein könnte. Da bisher keine Katholiken zum Militär zugelassen waren, ja nicht einmal Waffen besitzen durften, war dies eine heikle Frage. Nicht wenige anglo-irische Adelige und Politiker befürchteten, eine solche Vereinigung könnte der Vorläufer einer irischen Befreiungsorganisation oder gar Armee sein. Ein weiterer Punkt waren die Steuerabgaben, die noch einmal erhöht werden sollten, da der König dringend Geld brauchte, um seine Truppen in den amerikanischen Kolonien aufzustocken. Die frechen Kolonisten, sie nannten sich Patrioten, hatten sich dort erhoben und strebten die Unabhängigkeit an. Zweieinhalb Millionen Untertanen könnte der König dadurch auf einen Schlag verlieren, dazu möglicherweise alle Besitzungen in Nordamerika, von denen man einige erst wenige Jahrzehnte zuvor den Franzosen in langen, teueren Kriegen abgenommen hatte. Zudem fürchteten weitsichtige Politiker einen Flächenbrand, der gar die britischen Inseln selbst erreichen konnte. Eine »Krise apokalyptischen Ausmaßes« nannte sie Godfrey. Sein Sekretär jedoch wählte bedächtigere Worte, beschwor in der Rede die Einheit der Nation, die Stärke der Navy, die Wichtigkeit des Handels und Warenaustausches, sowie die Entsendung von Siedlern nach Übersee, gerade auch aus Irland, da hier die Bevölkerung stark wuchs, seitdem der Kartoffelanbau auf der Insel eingeführt und dadurch die Versorgung verbessert worden war. Provokationen müssten dringend unterlassen werden und eine weise und friedliche Lösung angestrebt. Godfrey hatte die Rede mehrmals durchgelesen, war zunächst wütend, tobte herum, las sie dann wieder und wieder, hinterfragte jeden Satz. Nach und nach hatte er eingesehen, dass die Rede genial war, forderte sie doch das gleiche Ergebnis ein, wie ein bewaffneter Konflikt. Alle zusammen unter einem König, freies Wirtschaften und freien Handel, Stärkung der Warenproduktion und Beherrschung der Märkte. Schließlich begann er zu verstehen, dass hier ein junger Mann am Werke gewesen war, der wohl über mehr Weitblick als das ganze Parlament zusammen verfügte. Mit so einem genialen Kopf an seiner Seite würde Sir William weiter aufsteigen können. Und das, ohne mit dem Säbel zu rasseln, wie es die Hardliner und Militärs im Beraterkreis des Königs forderten. Denn Krieg bedeutete immer immense Kosten und hohes Risiko.
»So, wir sind da. Jenkins, Sie bleiben hinter mir. Sie sprechen nur, wenn Sie gefragt werden! Vergessen Sie nicht, hier sind Sie unter Lords und Gentlemen. Es ist eine Ehre und ein Privileg für einen Mann Ihrer Herkunft, hier überhaupt eintreten zu dürfen!«, mahnte der Lord noch in der Kutsche.
»Ja, Sir. Danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben«, sagte Benjamin.
Benjamin stieg aus der Kutsche, die vor dem Haupteingang des Parlamentsgebäudes von Dublin angehalten hatte. Er hielt in der einen Hand die Mappe mit der Rede, mit der anderen hielt er den Verschlag für seinen Herren, Sir William Godfrey, auf.
Langsam und würdevoll schritt der Lord die Stufen hinauf. Trotz des Regens waren doch einige Schaulustige da, auch einige Damen waren anwesend. Sir William grüßte mit einem leichten Kopfnicken in die Runde. Oben angelangt, lief Benjamin vor, um die große Türe zu öffnen.
»Großer Gott, Jenkins! Wie sehen Sie denn aus? Ihr Gehrock ist ja hinten zerrissen! Wie können Sie es wagen, mich so zu begleiten?«, zischte der Adelige.
»Ich, Sir..., entschuldigung, ich habe es nicht bemerkt. Es muss im Dunkeln in der Kammer passiert sein«, gab Benjamin kleinlaut zurück.
»Her mit der Mappe, Sie Dummkopf! Hauen Sie ab! Gehen Sie nach Hause oder zum Schneider oder sonst wo hin! Aber lassen Sie sich nie wieder so mit mir sehen!«, raunte Godfrey dem jungen Mann zu, riss ihm die Mappe mit der Rede aus der Hand und verschwand im Gebäude.
Benjamin blieb auf den Stufen im Regen stehen. Er verspürte eine Wut in sich aufsteigen, die er nur selten erlebt hatte. Er beschloss, den Weg zurück zu laufen. Obwohl es regnete und eiskalt war, war Benjamin heiß. Er war so wütend, dass er nichts spürte. Innerhalb von Minuten war er bis auf die Haut nass. Im Stadthaus angekommen, zog er den nassen Gehrock aus und schleuderte ihn auf den Boden. Dabei brüllte er laut. Dann zog er die restlichen nassen Sachen aus und rieb sich mit einem großen Handtuch trocken. Plötzlich klopfte es an der Kammertüre. Erschrocken wickelte sich Benjamin notdürftig das Handtuch um.
»Entschuldigen Sie, Mister Jenkins, ist alles in Ordnung?«, hörte er die Stimme von Ruby, dem Stubenmädchen, welches die Kammer nebenan zusammen mit der Köchin Mrs. O‘Harra bewohnte.
»Alles in Ordnung, Ruby!«, rief Benjamin »Ich habe nur dämlicher weise meinen Gehrock zerrissen und mich etwas laut darüber geärgert. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich Sie erschreckt habe«, rief er durch die Türe.
»Kann ich helfen, Sir? Ich kann sehr gut nähen. Warten Sie, ich komme herein«, sagte Ruby und drückte die Türe auf.
»Neiiin!« rief Benjamin noch. Aber da stand sie schon im Zimmer und begutachtete, was sie da sah. Es schien ihr zu gefallen.
Mit dem Handtuch um die Hüften schob Benjamin sie wieder aus dem Zimmer.
»Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn ich mich erst anziehen dürfte, Ruby!«, sagte er, »Ich bringe Ihnen den Gehrock.«
Benjamin schüttelte den Kopf. So eine unmögliche Person. Wenn das die anderen Lakaien mitbekommen hatten, dann gab das Ärger. Oder zumindest dumme Sprüche. Rasch zog er frische Sachen an, rasierte sich und bürstete sein Haar. Diesmal band er einen akkuraten Zopf mit dem Samtband und vollendete dies mit einer perfekten Schleife. Dann nahm er etwas von seinem ersparten Geld, gab Ruby den Gehrock, dazu ein paar Pennies für das Nähen und lief die Treppe hinab. Er wies einen der Diener an, eine Kutsche zu bestellen und zog seinen guten Dreispitz und seinen Sonntagsmantel an.
Er blickte auf die Uhr in der großen Eingangshalle. Die Parlamentssitzung würde bestimmt noch eine Stunde dauern. Sein Plan war, den Lord damit zu überraschen, dass er ihn pünktlich zum Ende der Sitzung mit einer Kutsche abholte, denn wenn alle Abgeordneten gleichzeitig herauskamen, würden sie sich bei diesem Wetter um die Mietkutschen streiten. Lord Godfrey aber würde direkt einsteigen können.